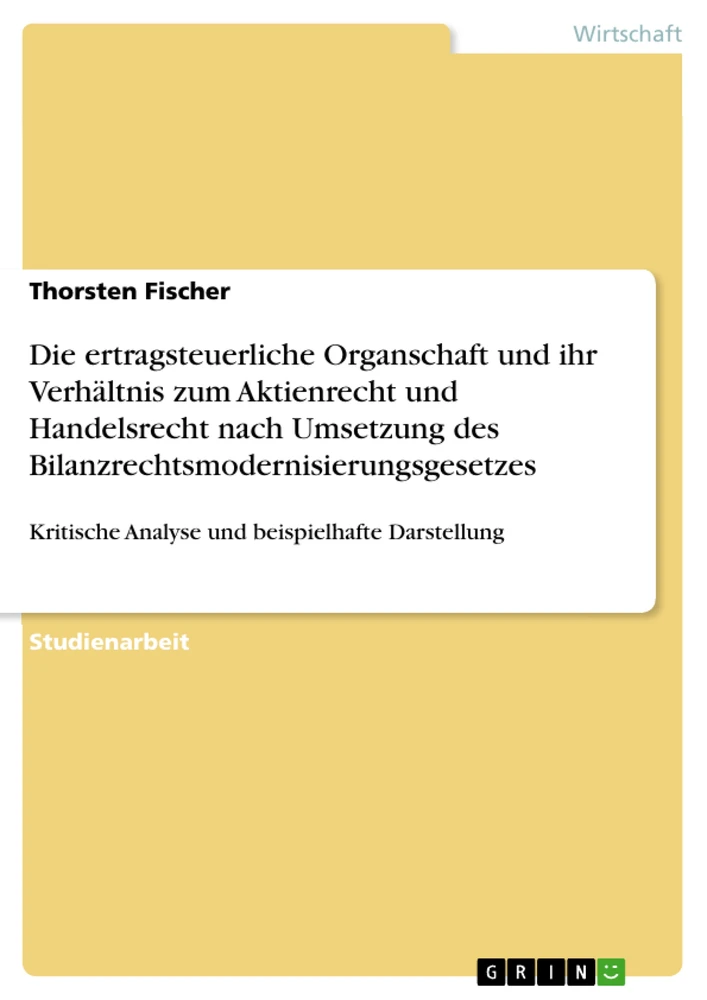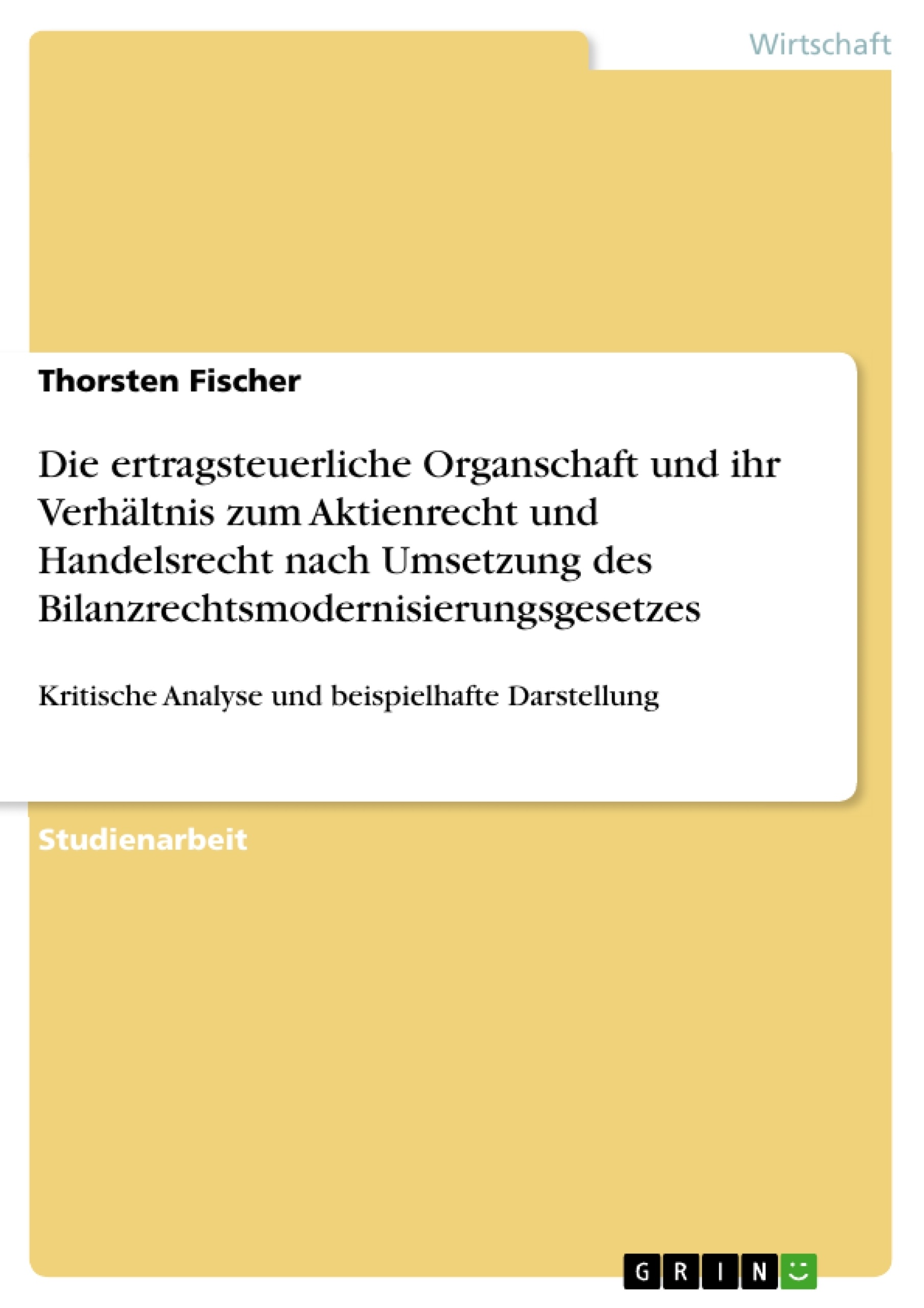Im Wettbewerb einer verflochtenen Weltwirtschaft sollten die einzelnen Staaten beachten, dass keine Doppelbesteuerung eintritt. Wirtschaftliche Nachteile durch die Doppelbesteuerung sind teilweise ein erheblicher Faktor für die gebremste Entwicklung mancher Konzerne. Dem hat der Gesetzgeber Rechnung getragen und räumt dem deutschen Steuerpflichtigen die Möglichkeit ein, die Organschaft zu institutionalisieren und damit eine latente Doppelbesteuerung von vorneherein zu vermeiden. FROTSCHER bezeichnet die Organschaft als „Herzstück“ des deutschen Konzernsteuerrechts. Dem muss man entgegenhalten das ein Konzernsteuerrecht bzw. eine Gruppenbesteuerung in Deutschland nicht vorgesehen ist. Vielmehr herrscht in Deutschland das Trennungsprinzip d. h. das Prinzip der Einzelbesteuerung vor. Das Rechtsinstitut der Organschaft gibt dem Steuerpflichtigen zumindest ansatzweise die Möglichkeit eine Gruppenbesteuerung durchzuführen.
Im Kapitel 2 wird daher das Konstrukt der Organschaft vorgestellt. Nachdem die Bestandteile und Voraussetzungen erläutert worden sind, knüpft Kapitel 3 die gesellschaftsrechtliche und aktienrechtliche Verbindung zur Organschaft. Speziell wird hier auf die Veränderungen durch das Bilanzrechtmodernisierungsgesetz (BilMoG) eingegangen. Im Kapitel 4 werden die kör-perschaftsteuerliche und gewerbesteuerliche Organschaft, sowie deren Vor- und Nachteile vorgetragen. Die Ausführungen schließen mit einem Fazit in Kapitel 5.
In dieser Seminararbeit wird nicht erschöpfend auf die internationale, grenzüberschreitende Organschaft eingegangen, sondern bis auf dezidierte Ausnahmen nur der nationale Kontext analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Konstrukt Organschaft
- Die Abgrenzung der ertragsteuerlichen Organschaft
- Die historische Entwicklung der Organschaft
- Die Organgesellschaft
- Die Organträger
- Allgemeines
- Die natürliche Person
- Die Personengesellschaften
- Die Kapitalgesellschaften
- Die ausländischen Unternehmen
- Die Holding als besondere Ausprägung
- Der Organkreis
- Die Beschreibung des Organkreis
- Die finanzielle Eingliederung
- Der Ergebnisabführungsvertrag
- Die verunglückte Organschaft
- Die gesellschaftsrechtlichen Grundlagen der Organschaft
- Die handelsrechtlichen Grundlagen
- Das Vorgehen und die Übergangsregelungen des BilMoG
- Die verbundenen Unternehmen nach § 271 Abs. 2 HGB
- Der mögliche beherrschende Einfluss nach § 290 HGB
- Die aktienrechtlichen Grundlagen
- Einordnung
- Die Konzernunternehmen
- Allgemeines
- Der faktische Konzern
- Der Vertragskonzern
- Der Eingliederungskonzern
- Der aktienrechtliche Ergebnisabführungsvertrag
- Die handelsrechtlichen Grundlagen
- Der ertragsteuerlicher Anwendungsbereich der Organschaft
- Die körperschaftsteuerliche Organschaft
- Die gewerbesteuerliche Organschaft
- Die Vor- und Nachteile einer ertragsteuerlichen Organschaft
- Die Gewinnermittlung im Rahmen der Organschaft
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der ertragsteuerlichen Organschaft und ihrer Beziehung zum Aktienrecht und Handelsrecht, insbesondere im Kontext der Umsetzung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG). Die Arbeit analysiert die rechtlichen Grundlagen und Auswirkungen der Organschaft und beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Interaktion dieser Rechtsgebiete ergeben.
- Analyse der ertragsteuerlichen Organschaft und ihrer Abgrenzung
- Untersuchung der historischen Entwicklung und der aktuellen Rechtslage
- Beurteilung der Auswirkungen des BilMoG auf die Organschaft und ihre rechtlichen Grundlagen
- Klärung des Verhältnisses der Organschaft zum Aktienrecht und Handelsrecht
- Bewertung der Vor- und Nachteile einer ertragsteuerlichen Organschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Konstrukt der Organschaft, wobei insbesondere die Abgrenzung der ertragsteuerlichen Organschaft, die historische Entwicklung und die Definition der relevanten Akteure (Organgesellschaft, Organträger, Organkreis) beleuchtet werden. Darüber hinaus werden die verschiedenen Arten von Organträgern sowie der Organkreis und seine Merkmale ausführlich erläutert. Kapitel 2 beschäftigt sich mit den gesellschaftsrechtlichen Grundlagen der Organschaft, wobei die Handelsrechtlichen und Aktienrechtlichen Grundlagen im Mittelpunkt stehen. Hier werden insbesondere die Regelungen des BilMoG, die Definition verbundener Unternehmen und der beherrschende Einfluss nach Handelsrecht analysiert. Des Weiteren wird das Verhältnis zum Aktienrecht, die verschiedenen Formen von Konzernen (faktisch, vertraglich, eingliedernd) und der aktienrechtliche Ergebnisabführungsvertrag diskutiert. Abschließend werden in Kapitel 4 die ertragsteuerlichen Auswirkungen der Organschaft, insbesondere die körperschaftsteuerliche und gewerbesteuerliche Organschaft, sowie die Vor- und Nachteile einer Organschaft und die Gewinnermittlung im Rahmen der Organschaft erläutert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themenfeldern der ertragsteuerlichen Organschaft, des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG), des Aktienrechts, des Handelsrechts und der Gewinnermittlung. Darüber hinaus werden wichtige Konzepte wie verbundene Unternehmen, beherrschender Einfluss, Organkreis, Ergebnisabführungsvertrag und die verschiedenen Formen von Konzernen beleuchtet. Die Arbeit befasst sich mit der Interaktion dieser Rechtsgebiete und den Herausforderungen und Chancen, die sich aus dieser Interaktion ergeben.
- Quote paper
- Thorsten Fischer (Author), 2009, Die ertragsteuerliche Organschaft und ihr Verhältnis zum Aktienrecht und Handelsrecht nach Umsetzung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/151135