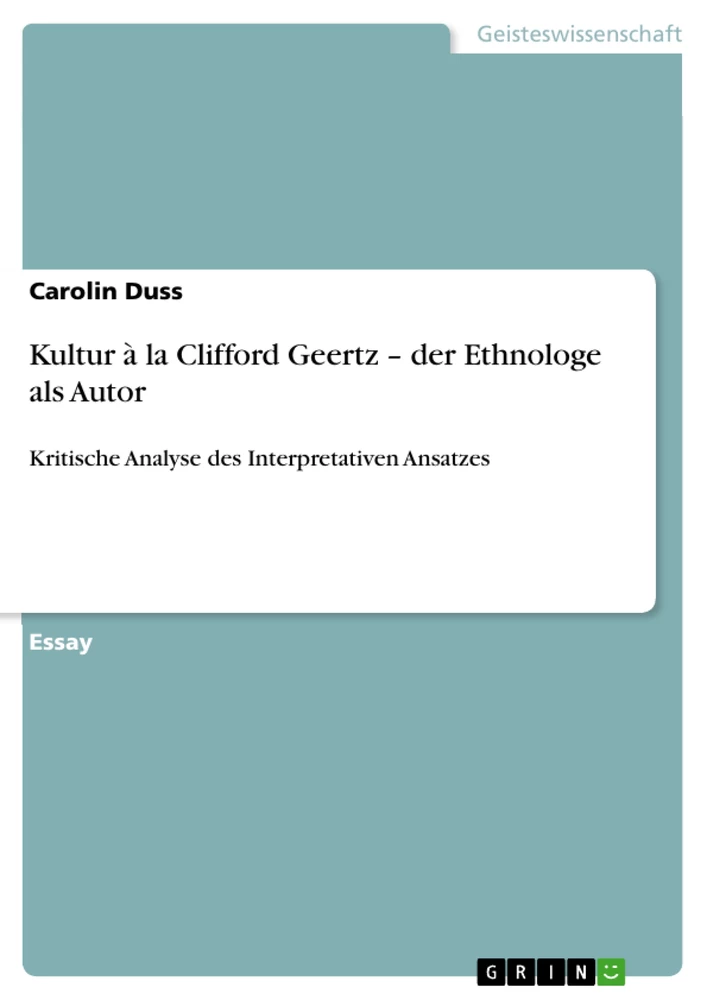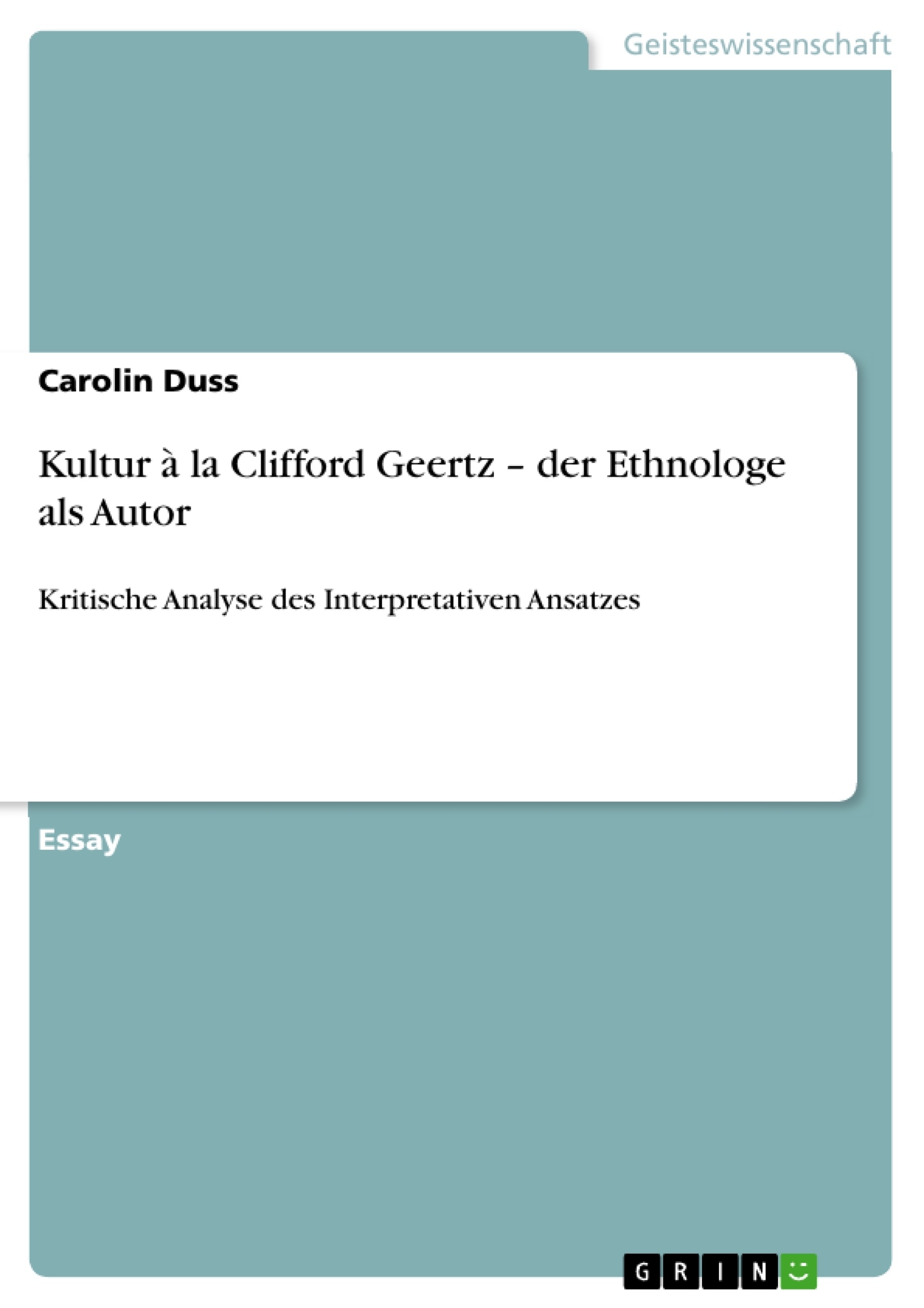Clifford Geertz (1926 - 2006) war einer der wichtigsten, wenn nicht DER wichtigste Vertreter der amerikanischen Cultural Anthropology seit den 1970er Jahren. Er war Mitbegründer und prominentester Vertreter des Interpretativen Ansatzes, welcher zum prägenden Paradigma in der Ethnologie wurde.
Um seinen Ansatz kritisch zu besprechen, werde ich mich vor allem auf folgende programmatischen Essays konzentrieren: ,Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight‘ (1972), ,Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture‘ (1973) und ,“From the Native‘s Point of View“: On the Nature of Anthropological Understanding‘ (1974). Des Weiteren beziehe ich mich hauptsächlich auf Volker Gottowik (1997/2004) und Annette Hornbacher (2005), die sich kritisch mit Geertz Art der Repräsentation Anderer auseinandergesetzt haben.
Geertz` Ziel war nicht eine allgemeine Kulturtheorie. Er wollte „lediglich“ Begriffe bereitstellen, mit denen die Rolle der Kultur im menschlichen Leben ausgedrückt werden kann. „Räumlich begrenzte Wahrheiten“ seien zu sehr an ihre Interpretation gebunden, als dass sie sich zu Großtheorien weiterentwickeln ließen. Das qualitative, besondere Material einer akribischen Feldforschung solle jedoch Großbegriffe der Sozialwissenschaft wie Konflikt, Struktur oder Bedeutung anschaulich machen.
Geertz forderte eine neue Art des Forschens und der Darstellungsform der Forschungsergebnisse. Mittels Erkenntnissen der Sprachphilosophie und Literaturanalyse strebte Geertz eine symbol- und bedeutungsorientierten Kulturwissenschaft an, er wollte sie als Geisteswissenschaft neu etablieren. Er stellt sich gegen mechanistische Erklärungen für soziales Verhalten und universelle Gesetzmäßigkeiten im Sinne der Naturwissenschaften.
Im Folgenden werde ich, von seinem Kulturbegriff ausgehend, Geertz' Interpretative Ethnologie an Hand der Schlagworte "Symbole und Bedeutung", "Dichte Beschreibung", "Kultur als Text, Ethnographie als Hermeneutik", "Interpretationen und Darstellung des Native's Point of View", "Interpretierendes Erkläen und der hermeneutische Zirkel", "Ethnographien als Fiktionen, Ethnologen als Schriftsteller" und an Hand des ethnographischen Beispiels "Hahnenkampf auf Bali" kritisch einordnen, und dabei Geertz Verdienst und die Kritk an ihm – vor allem seitens Vertreter der Writing Culture-Strömung herausarbeiten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Kulturbegriff
- II. Symbole und Bedeutung
- Kritik am Symbol- und Bedeutungsbegriff
- III. Dichte Beschreibung
- Kritik am Konzept der dichten Beschreibung
- IV. Kultur als Text, Ethnographie als Hermeneutik
- Kritik an der Textmetapher
- V. Interpretation und Darstellung des Native's Point of View
- VI. Interpretierendes Erklären und der hermeneutische Zirkel
- VII. Ethnographien als Fiktionen - Ethnologen als Schriftsteller
- VIII. Ethnographisches Beispiel - der Hahnenkampf auf Bali
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert kritisch den interpretativen Ansatz von Clifford Geertz in der Kulturanthropologie. Ziel ist es, Geertz' Konzepte – insbesondere seine Kulturdefinition, den Symbolbegriff, die "dichte Beschreibung" und die Textmetapher – nachzuvollziehen und deren Stärken und Schwächen zu beleuchten. Der Text stützt sich dabei auf Geertz' zentrale Essays und die kritische Auseinandersetzung anderer Wissenschaftler mit seinem Werk.
- Geertz' Neukonzeption des Kulturbegriffs
- Die Rolle von Symbolen und Bedeutung in Geertz' Ansatz
- Das Konzept der "dichten Beschreibung" und seine Implikationen
- Die Textmetapher als Interpretationsmodell für Kultur
- Kritik an Geertz' interpretativem Ansatz
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt Clifford Geertz als wichtigen Vertreter des interpretativen Ansatzes in der amerikanischen Kulturanthropologie vor und umreißt die zentralen Werke, auf die sich die Analyse stützt. Sie hebt Geertz' Ziel hervor, Begriffe bereitzustellen, um die Rolle der Kultur im menschlichen Leben zu beschreiben, und seine Ablehnung universeller Gesetzmäßigkeiten im Sinne der Naturwissenschaften. Die Einleitung benennt außerdem die kritischen Perspektiven von Gottowik und Hornbacher, die die Darstellung Anderer bei Geertz untersuchen.
I. Kulturbegriff: Dieses Kapitel definiert Geertz' Kulturbegriff im Abgrenzung zu funktionalistischen und strukturalistischen Strömungen. Kultur wird nicht als Bedürfnisbefriedigung, Aufrechterhaltung sozialer Strukturen oder universeller kognitiver Strukturen verstanden, sondern als historisch überliefertes, lokal unterschiedliches Orientierungssystem, das Erfahrungen Bedeutung verleiht. Geertz' Herangehensweise wird mit der Hermeneutik verglichen, wobei der Fokus auf der Erfassung der Sinnzuschreibungen der Einheimischen liegt.
II. Symbole und Bedeutung: Hier wird Geertz' weite Symboldefinition erläutert, die sich auf Susanne Langer stützt und Symbole als Ausdrucksmittel von Vorstellungen versteht. Die Verknüpfung von kulturspezifischen Symbolen zu Symbolsystemen und Vorstellungsstrukturen wird beschrieben, wobei betont wird, dass Menschen gleichzeitig Schöpfer und Geschöpfe der Kultur sind. Der Abschnitt enthält zudem eine kritische Auseinandersetzung mit Geertz' fehlender Unterscheidung in der Gewichtung von Symbolen und Ebenen ihrer Bedeutung, sowie der fehlenden Erklärung der Entstehung und Aufrechterhaltung kollektiver Symbole und Bedeutung.
III. Dichte Beschreibung: Dieses Kapitel erklärt Geertz' Konzept der "dichten Beschreibung" im Vergleich zu Ryles "dünner Beschreibung". Es wird gezeigt, wie Geertz Bedeutungsebenen in die Beschreibung einbezieht und multiple Interpretationsschichten betont. Die dichte Beschreibung soll den Interpretationsrahmen der Einheimischen offengelegen, welcher öffentlich zugänglich ist, da Menschen allen Ereignissen Symbole verleihen. Geertz grenzt sich hier von mentalistischen Ansätzen ab. Die Kritik an der Distanz, die Geertz zwischen sich und den Einheimischen etabliert, wird diskutiert, welche die Vernachlässigung der individuellen Intention der Menschen beinhaltet.
IV. Kultur als Text, Ethnographie als Hermeneutik: Dieses Kapitel erläutert Geertz' Metapher der Kultur als Text und die Ethnographie als Hermeneutik. Kultur wird als sozialer Diskurs aus Zeichen und Symbolen begriffen, deren Bedeutung aus dem Gesamtzusammenhang hervorgeht. Der Ethnograph rekonstruiert den kulturellen Kontext ("Urtext") und analysiert den sozialen Diskurs, um die Bedeutung von Handlungen und Sprechakten herauszufiltern. Die Kritik an dieser Textmetapher konzentriert sich auf die Homogenisierung unterschiedlicher und widersprüchlicher Diskurse innerhalb einer Kultur.
Schlüsselwörter
Clifford Geertz, interpretativer Ansatz, Kulturanthropologie, Kulturbegriff, Symbol, Bedeutung, dichte Beschreibung, Hermeneutik, Textmetapher, Ethnographie, Symbolische Interaktion, Interpretation, Bedeutungszuschreibung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Kritische Analyse des interpretativen Ansatzes von Clifford Geertz in der Kulturanthropologie
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert kritisch den interpretativen Ansatz von Clifford Geertz in der Kulturanthropologie. Sie untersucht seine zentralen Konzepte – insbesondere seine Kulturdefinition, den Symbolbegriff, die "dichte Beschreibung" und die Textmetapher – und beleuchtet deren Stärken und Schwächen. Die Analyse stützt sich auf Geertz' zentrale Essays und die kritische Auseinandersetzung anderer Wissenschaftler mit seinem Werk.
Welche Konzepte von Geertz werden im Detail untersucht?
Die Arbeit befasst sich eingehend mit Geertz' Neukonzeption des Kulturbegriffs, der Rolle von Symbolen und Bedeutung in seinem Ansatz, dem Konzept der "dichten Beschreibung" und seinen Implikationen, sowie der Textmetapher als Interpretationsmodell für Kultur. Die kritische Auseinandersetzung mit diesen Konzepten bildet einen zentralen Bestandteil der Analyse.
Wie definiert Geertz den Kulturbegriff?
Geertz' Kulturbegriff unterscheidet sich von funktionalistischen und strukturalistischen Ansätzen. Kultur wird nicht als bloße Bedürfnisbefriedigung, Aufrechterhaltung sozialer Strukturen oder universeller kognitiver Strukturen verstanden, sondern als historisch überliefertes, lokal unterschiedliches Orientierungssystem, das Erfahrungen Bedeutung verleiht. Seine Herangehensweise wird mit der Hermeneutik verglichen, wobei der Fokus auf der Erfassung der Sinnzuschreibungen der Einheimischen liegt.
Was versteht Geertz unter "dichter Beschreibung"?
Geertz' "dichte Beschreibung" steht im Gegensatz zu Ryles "dünner Beschreibung". Sie beinhaltet die Einbeziehung mehrerer Bedeutungsebenen und betont multiple Interpretationsschichten. Ziel ist es, den Interpretationsrahmen der Einheimischen offenzulegen, der als öffentlich zugänglich betrachtet wird, da Menschen allen Ereignissen Symbole verleihen. Geertz grenzt sich hier von mentalistischen Ansätzen ab. Die Kritik an der Distanz zwischen Geertz und den Einheimischen und die damit verbundene Vernachlässigung individueller Intentionen wird ebenfalls diskutiert.
Welche Rolle spielen Symbole und Bedeutung in Geertz' Ansatz?
Geertz verwendet eine weite Symboldefinition (basierend auf Susanne Langer), die Symbole als Ausdrucksmittel von Vorstellungen versteht. Die Verknüpfung kulturspezifischer Symbole zu Symbolsystemen und Vorstellungsstrukturen wird beschrieben. Es wird betont, dass Menschen gleichzeitig Schöpfer und Geschöpfe der Kultur sind. Kritisiert wird jedoch Geertz' fehlende Unterscheidung in der Gewichtung von Symbolen und Ebenen ihrer Bedeutung, sowie die fehlende Erklärung der Entstehung und Aufrechterhaltung kollektiver Symbole und Bedeutung.
Was ist die Textmetapher in Geertz' Werk?
Geertz verwendet die Metapher der Kultur als Text und versteht Ethnographie als Hermeneutik. Kultur wird als sozialer Diskurs aus Zeichen und Symbolen begriffen, deren Bedeutung aus dem Gesamtzusammenhang hervorgeht. Der Ethnograph rekonstruiert den kulturellen Kontext ("Urtext") und analysiert den sozialen Diskurs, um die Bedeutung von Handlungen und Sprechakten herauszufiltern. Kritisiert wird die mögliche Homogenisierung unterschiedlicher und widersprüchlicher Diskurse innerhalb einer Kultur.
Welche Kritikpunkte an Geertz' Ansatz werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit enthält verschiedene Kritikpunkte an Geertz' Ansatz, darunter die Kritik an seiner fehlenden Unterscheidung in der Gewichtung von Symbolen, die fehlende Erklärung der Entstehung kollektiver Symbole, die Kritik an der Distanz zwischen Forscher und Einheimischen, sowie die Kritik an der möglichen Homogenisierung unterschiedlicher Diskurse in der Textmetapher. Die Perspektiven von Gottowik und Hornbacher, die die Darstellung Anderer bei Geertz untersuchen, werden ebenfalls berücksichtigt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, sieben Hauptkapitel (Kulturbegriff, Symbole und Bedeutung, Dichte Beschreibung, Kultur als Text, Interpretation des Native's Point of View, Interpretierendes Erklären und der hermeneutische Zirkel, Ethnographien als Fiktionen) und ein Fazit. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit einem Aspekt von Geertz' Theorie und beinhaltet kritische Reflexionen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für das Verständnis der Arbeit?
Schlüsselbegriffe sind: Clifford Geertz, interpretativer Ansatz, Kulturanthropologie, Kulturbegriff, Symbol, Bedeutung, dichte Beschreibung, Hermeneutik, Textmetapher, Ethnographie, Symbolische Interaktion, Interpretation, Bedeutungszuschreibung.
- Quote paper
- Carolin Duss (Author), 2008, Kultur à la Clifford Geertz – der Ethnologe als Autor, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/150932