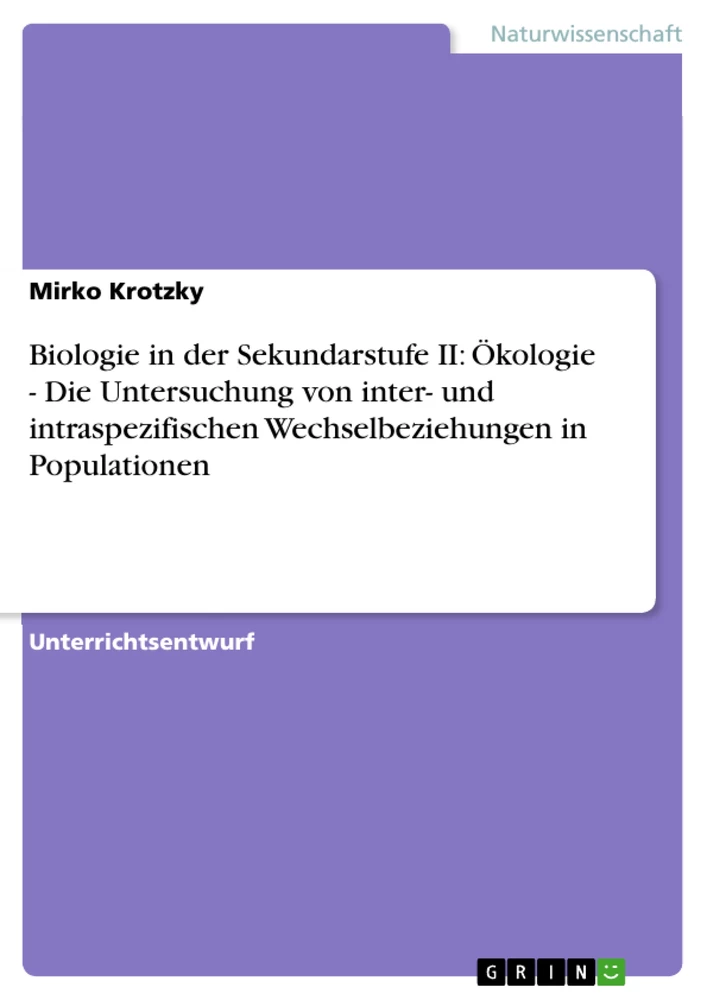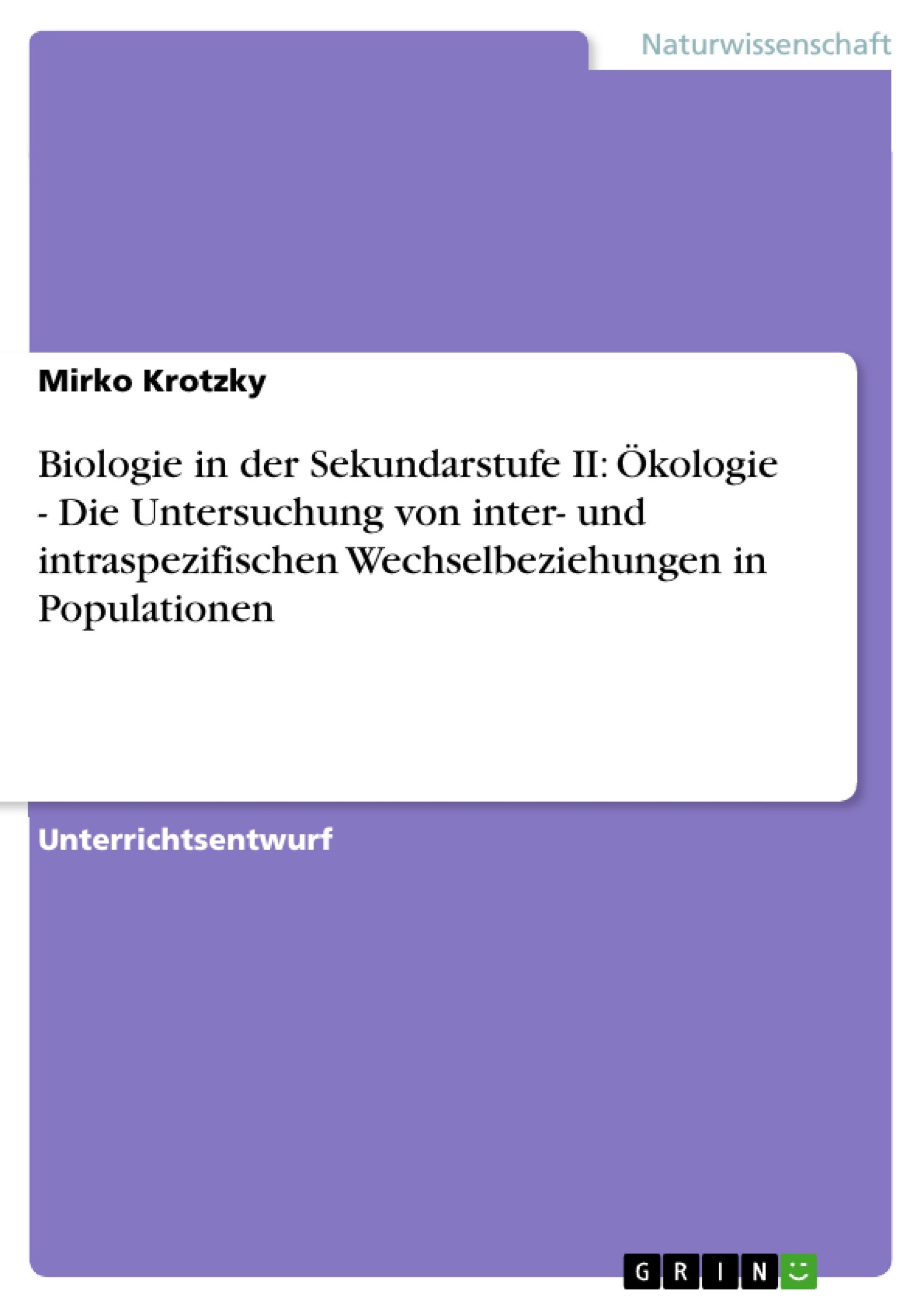Unterrichtsentwurf für die Unterrichtspraktische Prüfung in der Sekundarstufe II (Grundkurs 12) im Fach Biologie für den Erwerb des 2. Staatsexamens für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen.
Der Entwurf beinhaltet die folgenden Punkte: Thema der Unterrichtsreihe, Sachanalyse und Einordnung der Stunde in die Unterrichtsreihe, Thema der Unterrichtsstunde, Ziele der Unterrichtsstunde, Kompetenzbezüge der Lernziele, Bedinungsanalyse, Hausaufgaben, geplanter Unterrichtsverlauf, Didaktisch-methodische Begründungen, geplante Tafelbilder und Materialien sowie Quellenangaben und Versicherung.
Das zugrundeliegende Reihenthema "Biotische Faktoren" umfasst die vielfältigen Beziehungen, welche Lebewesen mit anderen Lebewesen eingehen. Die Schülerinnen und Schüler (nachstehend "SuS") haben sich bereits mit intra- und interspezifischen Beziehungen, mit Konkurrenz und verschiedenen symbiontischen Lebensweisen befasst.
Die ökologische Bedeutung des Parasitismus wird schnell offensichtlich, wenn man berücksichtigt, "dass mehr als 50% aller Lebewesen parasitär sind oder zumindest eine parasitische Phase in ihrem Leben haben." In der Auseinandersetzung mit dem einzelligen Endoparasiten Plasmodium, welcher die gefährliche Infektionskrankheit "Malaria" beim Menschen verursacht, sollen sich die SuS in der aktuellen Stunde dieser Bedeutung bewusst werden und erkennen, dass auch der Mensch von der Gefahr des Parasitenbefalls nicht ausgenommen ist.
Malaria gehört weltweit zu den wichtigsten vektorbedingten Krankheiten. Im Jahre 2001 lebten in 101 Staaten und Territorien 2,4 Milliarden Menschen oder 40% der Weltbevölkerung in malaria-gefährdeten Gebieten, 400-500 Millionen werden jährlich neu infiziert und über eine Million Menschen, meistens Kinder unter fünf Jahre, sterben jedes Jahr an einer Malaria-Infektion, weshalb die exemplarische unterrichtliche Behandlung dieser Thematik aktueller denn je erscheint.
Die SuS lernen zunächst den komplizierten Lebenszyklus des Malariaerregers Plasmodium kennen und erfassen, dass dieser für die sichere Fortpflanzung und das Auffinden eines Wirts sinnvoll ist. Durch das ausgewählte Beispiel wird deutlich, wie wichtig das Funktionieren interspezifischer Beziehungen für die Verbreitung und Erhaltung einer Art ist. Nach Erarbeitung dieser essentiellen Grundlagen sollen die SuS Möglichkeiten erfolgreicher Bekämpfungs- und Vorbeugungsmaßnahmen in Bezug auf die Malaria überlegen und diese erörtern.
Inhaltsverzeichnis
- Wer jagt denn da in meinem Revier? - Kennenlernen von interspezifischen Beziehungen, Konkurrenzvermeidung und Konkurrenz-Ausschluss-Prinzip am Beispiel des Beutespektrums von Habicht und Sperber im Vergleich.
- Liebe deinen Nächsten wie dich selbst! - Die verschiedene Formen der Symbiose (Ekto- und Endosymbiose) werden arbeitsteilig durch je zwei Gruppen erschlossen und abschließend in der Form eines Gruppenpuzzles zusammengeführt.
- Ameisen suchen ein Zuhause: die Symbionten-WG - In Form von kurzen Präsentationen stellen die SuS eingängige Vertreter beider Formen der Symbiose vor (u.a. die „Ameisenpflanze“ Myrmecodia). Ein kurzer Lehrfilm bündelt abschließend die bereits erworbenen Kenntnisse und fasst die wichtigsten Aspekte wiederholend zusammen.
- „Der Räuber lebt vom Kapital, der Parasit von den Zinsen.“ - Unterscheidung nach der Lebensweise in Halb- und Vollparasiten sowie nach dem Aufenthaltsort in Ekto- und Endoparasiten. Beispielhaft wird der Lebenszyklus des Kleinen Leberegels mit Zwischenwirten (Schnecke und Ameise) und Endwirt (Schaf) sowie dem Menschen als Fehlwirt arbeitsteilig erschlossen.
- Todkrank aus dem Urlaub: Wie kann ich mich schützen? – Malaria als Beispiel einer durch einzellige Endoparasiten hervorgerufenen Infektionskrankheit. Über den Lebenszyklus von Plasmodium entwickeln die SuS geeignete Behandlungs- und Präventionsmaßnahmen und überprüfen sie abschließend im Rahmen eines Experten-Hearings auf Plausibilität.
- Jedem das seine und mir das meiste! – Vorstellung intraspezifischer Beziehungen anhand verschiedener Mechanismen der Konkurrenzvermeidung wie Revierbildung, Jugend- und Altersformen, Sexualdimorphismus und Einsatz von Pheromonen innerhalb einzelner Tierarten. Die Teilbereiche werden von den SuS in Kurzreferaten vorgestellt.
- Schäfchen zählen leicht gemacht! Das Wachstum von Populationen wird mit Hilfe eines Computerprogramms zur Erstellung von Wachstumskurven, Wachstumsraten und Kapazitätsgrenzen simuliert und mit adäquaten Arbeitsaufträgen verknüpft.
- Fortpflanzungspotenzial vs. Durchsetzungsvermögen - And the winner is... Unterscheidung zwischen K- und r-Strategen durch exemplarische gruppenteilige Erarbeitung und Präsentation je eines typischen Vertreters, wobei auf den relativierenden Aspekt der eher restriktiv gebrauchten Strategiebegriffe besonders eingegangen wird.
- Ich hab dich zum Fressen gern! - Mit Hilfe des bereits bekannten Simulationsmoduls werden verschiedene Konstellationen zur Darstellung der Räuber-Beute-Beziehung angenommen und durch die SuS analysiert. Auf Basis der Simulationen werden die dichteabhängigen und dichteunabhängigen Faktoren abgeleitet sowie die LOTKA-VOLTERRA-Regeln formuliert.
- „Blätterzupfer“ in der Savanne: ein Beruf mit Tradition - Die SuS lernen den Begriff der „Ökologischen Nische“ sowie die Nischenerschließung durch unterschiedliche Nutzung kennen und begreifen die Spezialisierung der Arten als Mittel zur Vermeidung interspezifischer Konkurrenz.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Unterrichtsreihe zielt darauf ab, den Schülerinnen und Schülern ein umfassendes Verständnis von inter- und intraspezifischen Wechselwirkungen in Populationen zu vermitteln. Die Schüler sollen lernen, die komplexen Beziehungen zwischen Lebewesen zu analysieren und die Bedeutung dieser Beziehungen für das Überleben und die Entwicklung von Populationen zu verstehen. Die Reihe verbindet theoretische Kenntnisse mit praktischen Anwendungen und fördert die Entwicklung von analytischen und problem-lösenden Fähigkeiten.
- Interspezifische Beziehungen (Konkurrenz, Symbiose, Parasitismus)
- Intraspezifische Beziehungen (Konkurrenzvermeidung)
- Populationsdynamik (Wachstum, Kapazitätsgrenzen)
- Ökologische Nische und Nischendifferenzierung
- Malaria als Beispiel für eine parasitäre Infektionskrankheit
Zusammenfassung der Kapitel
Wer jagt denn da in meinem Revier? - Kennenlernen von interspezifischen Beziehungen, Konkurrenzvermeidung und Konkurrenz-Ausschluss-Prinzip am Beispiel des Beutespektrums von Habicht und Sperber im Vergleich.: Dieses Kapitel führt in die Thematik interspezifischer Beziehungen ein. Am Beispiel des Beutespektrums von Habicht und Sperber werden Konkurrenzvermeidung und das Konkurrenz-Ausschluss-Prinzip erläutert. Der Fokus liegt auf der Beobachtung, wie verschiedene Arten Ressourcen teilen und Konkurrenz minimieren, um Koexistenz zu ermöglichen. Die Schüler lernen die Bedeutung von Nischendifferenzierung für die Überlebensfähigkeit von Arten kennen.
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst! - Die verschiedene Formen der Symbiose (Ekto- und Endosymbiose) werden arbeitsteilig durch je zwei Gruppen erschlossen und abschließend in der Form eines Gruppenpuzzles zusammengeführt.: Dieses Kapitel behandelt verschiedene Formen der Symbiose, sowohl Ekto- als auch Endosymbiose. Durch Gruppenarbeit und ein anschließendes Puzzle wird das Verständnis der unterschiedlichen Symbiosetypen vertieft. Die Schüler lernen konkrete Beispiele kennen und analysieren die Vorteile und Nachteile der jeweiligen Symbiose für die beteiligten Arten. Der Fokus liegt auf dem wechselseitigen Nutzen und den verschiedenen Ausprägungen symbiotischer Beziehungen.
Ameisen suchen ein Zuhause: die Symbionten-WG - In Form von kurzen Präsentationen stellen die SuS eingängige Vertreter beider Formen der Symbiose vor (u.a. die „Ameisenpflanze“ Myrmecodia). Ein kurzer Lehrfilm bündelt abschließend die bereits erworbenen Kenntnisse und fasst die wichtigsten Aspekte wiederholend zusammen.: Aufbauend auf dem vorherigen Kapitel werden die erarbeiteten Kenntnisse über Symbiose durch Präsentationen und einen Lehrfilm vertieft und wiederholt. Die Schüler präsentieren selbstgewählte Beispiele, was ihr Verständnis festigt und ihre Präsentationsfähigkeiten schult. Der Lehrfilm dient der Zusammenfassung und Wiederholung der wichtigsten Aspekte der Symbiose.
„Der Räuber lebt vom Kapital, der Parasit von den Zinsen.“ - Unterscheidung nach der Lebensweise in Halb- und Vollparasiten sowie nach dem Aufenthaltsort in Ekto- und Endoparasiten. Beispielhaft wird der Lebenszyklus des Kleinen Leberegels mit Zwischenwirten (Schnecke und Ameise) und Endwirt (Schaf) sowie dem Menschen als Fehlwirt arbeitsteilig erschlossen.: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Parasitismus. Die Schüler lernen die Unterscheidung zwischen Halb- und Vollparasiten sowie Ekto- und Endoparasiten kennen. Der Lebenszyklus des Kleinen Leberegels wird als detailliertes Beispiel analysiert, um die Komplexität parasitärer Beziehungen zu verdeutlichen. Die Schüler erarbeiten die verschiedenen Stadien des Lebenszyklus und die Bedeutung der Zwischenwirte.
Todkrank aus dem Urlaub: Wie kann ich mich schützen? – Malaria als Beispiel einer durch einzellige Endoparasiten hervorgerufenen Infektionskrankheit. Über den Lebenszyklus von Plasmodium entwickeln die SuS geeignete Behandlungs- und Präventionsmaßnahmen und überprüfen sie abschließend im Rahmen eines Experten-Hearings auf Plausibilität.: Dieses Kapitel behandelt Malaria als ein Beispiel für eine durch einzellige Endoparasiten hervorgerufene Infektionskrankheit. Die Schüler erarbeiten den Lebenszyklus von Plasmodium und entwickeln auf dieser Basis geeignete Behandlungs- und Präventionsmaßnahmen. Ein Experten-Hearing dient der kritischen Überprüfung und Bewertung der entwickelten Maßnahmen.
Jedem das seine und mir das meiste! – Vorstellung intraspezifischer Beziehungen anhand verschiedener Mechanismen der Konkurrenzvermeidung wie Revierbildung, Jugend- und Altersformen, Sexualdimorphismus und Einsatz von Pheromonen innerhalb einzelner Tierarten. Die Teilbereiche werden von den SuS in Kurzreferaten vorgestellt.: Dieses Kapitel befasst sich mit intraspezifischen Beziehungen und Mechanismen der Konkurrenzvermeidung. Die Schüler erarbeiten verschiedene Strategien wie Revierbildung, Jugend- und Altersformen, Sexualdimorphismus und den Einsatz von Pheromonen. Durch Kurzreferate präsentieren sie ihre Ergebnisse und vertiefen ihr Verständnis der intraspezifischen Konkurrenz.
Schäfchen zählen leicht gemacht! Das Wachstum von Populationen wird mit Hilfe eines Computerprogramms zur Erstellung von Wachstumskurven, Wachstumsraten und Kapazitätsgrenzen simuliert und mit adäquaten Arbeitsaufträgen verknüpft.: Dieses Kapitel behandelt die Populationsdynamik. Mit Hilfe eines Computerprogramms simulieren die Schüler das Wachstum von Populationen und analysieren Wachstumskurven, Wachstumsraten und Kapazitätsgrenzen. Die Schüler lernen die Faktoren zu verstehen, die das Wachstum von Populationen beeinflussen.
Fortpflanzungspotenzial vs. Durchsetzungsvermögen - And the winner is... Unterscheidung zwischen K- und r-Strategen durch exemplarische gruppenteilige Erarbeitung und Präsentation je eines typischen Vertreters, wobei auf den relativierenden Aspekt der eher restriktiv gebrauchten Strategiebegriffe besonders eingegangen wird.: Dieses Kapitel vergleicht K- und r-Strategen und deren unterschiedliche Fortpflanzungs- und Überlebensstrategien. Durch Gruppenarbeit und Präsentationen lernen die Schüler die Vor- und Nachteile der jeweiligen Strategien kennen und verstehen die relativen Aspekte dieser Konzepte.
Ich hab dich zum Fressen gern! - Mit Hilfe des bereits bekannten Simulationsmoduls werden verschiedene Konstellationen zur Darstellung der Räuber-Beute-Beziehung angenommen und durch die SuS analysiert. Auf Basis der Simulationen werden die dichteabhängigen und dichteunabhängigen Faktoren abgeleitet sowie die LOTKA-VOLTERRA-Regeln formuliert.: Dieses Kapitel behandelt die Räuber-Beute-Beziehung mit Hilfe eines Simulationsmoduls. Die Schüler analysieren verschiedene Konstellationen und leiten dichteabhängige und dichteunabhängige Faktoren ab. Die LOTKA-VOLTERRA-Regeln werden formuliert und angewendet.
„Blätterzupfer“ in der Savanne: ein Beruf mit Tradition - Die SuS lernen den Begriff der „Ökologischen Nische“ sowie die Nischenerschließung durch unterschiedliche Nutzung kennen und begreifen die Spezialisierung der Arten als Mittel zur Vermeidung interspezifischer Konkurrenz.: Dieses Kapitel erklärt den Begriff der ökologischen Nische und die Nischenerschließung durch unterschiedliche Nutzung von Ressourcen. Die Schüler lernen, wie Spezialisierung zur Vermeidung interspezifischer Konkurrenz beiträgt.
Schlüsselwörter
Interspezifische Beziehungen, intraspezifische Beziehungen, Konkurrenz, Symbiose, Parasitismus, Populationsdynamik, ökologische Nische, Nischendifferenzierung, Malaria, Plasmodium, K-Strategen, r-Strategen, Räuber-Beute-Beziehung, LOTKA-VOLTERRA-Regeln.
Häufig gestellte Fragen zum Unterrichtsmaterial "Ökologische Wechselwirkungen"
Was ist der Inhalt des Unterrichtsmaterials "Ökologische Wechselwirkungen"?
Das Unterrichtsmaterial bietet einen umfassenden Überblick über inter- und intraspezifische Beziehungen in Ökosystemen. Es umfasst verschiedene Kapitel zu Konkurrenz, Symbiose, Parasitismus, Populationsdynamik und ökologischen Nischen. Die Schüler erarbeiten sich theoretisches Wissen und wenden es in praktischen Übungen und Simulationen an. Beispiele wie der Lebenszyklus des Kleinen Leberegels oder die Malaria-Erkrankung werden detailliert behandelt. Die verschiedenen Kapitel beinhalten Gruppenarbeiten, Präsentationen, Simulationen und ein Expertenhearing.
Welche Arten von Beziehungen zwischen Lebewesen werden behandelt?
Das Material behandelt sowohl interspezifische Beziehungen (zwischen verschiedenen Arten) wie Konkurrenz, Symbiose (Ekto- und Endosymbiose) und Parasitismus (Halb- und Vollparasiten, Ekto- und Endoparasiten), als auch intraspezifische Beziehungen (innerhalb einer Art) mit einem Fokus auf Konkurrenzvermeidung durch Mechanismen wie Revierbildung, Jugend- und Altersformen, Sexualdimorphismus und Pheromone. Die Räuber-Beute-Beziehung wird mit Hilfe eines Simulationsmodells und der Lotka-Volterra-Regeln analysiert.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Neben den oben genannten Beziehungen werden die Populationsdynamik (Wachstum, Kapazitätsgrenzen, K- und r-Strategen), der Begriff der ökologischen Nische und die Nischendifferenzierung als Mittel zur Konkurrenzvermeidung ausführlich erklärt. Die Malaria-Erkrankung dient als Beispiel für eine parasitäre Infektionskrankheit, wobei die Schüler Behandlungs- und Präventionsmaßnahmen entwickeln und kritisch bewerten.
Welche Methoden werden im Unterricht eingesetzt?
Das Material beinhaltet eine Vielzahl von didaktischen Methoden. Schüler arbeiten in Gruppen, erstellen Präsentationen, führen Simulationen mit einem Computerprogramm durch, analysieren Fallbeispiele und nehmen an einem Expertenhearing teil. Puzzle-Aufgaben und Kurzreferate fördern das Verständnis und die aktive Mitarbeit der Schüler.
Welche Lernziele werden verfolgt?
Das Material zielt darauf ab, den Schülern ein umfassendes Verständnis von inter- und intraspezifischen Wechselwirkungen zu vermitteln. Sie sollen lernen, diese Beziehungen zu analysieren und deren Bedeutung für das Überleben und die Entwicklung von Populationen zu verstehen. Analytische und problem-lösende Fähigkeiten werden gefördert.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Material verwendet?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Interspezifische Beziehungen, Intraspezifische Beziehungen, Konkurrenz, Symbiose, Parasitismus, Populationsdynamik, ökologische Nische, Nischendifferenzierung, Malaria, Plasmodium, K-Strategen, r-Strategen, Räuber-Beute-Beziehung und Lotka-Volterra-Regeln.
Wie ist das Material aufgebaut?
Das Material ist übersichtlich gegliedert und enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und eine Liste von Schlüsselbegriffen. Jedes Kapitel beschreibt die Lerninhalte, die Methoden und die angestrebten Lernergebnisse.
- Quote paper
- Mirko Krotzky (Author), 2010, Biologie in der Sekundarstufe II: Ökologie - Die Untersuchung von inter- und intraspezifischen Wechselbeziehungen in Populationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/150911