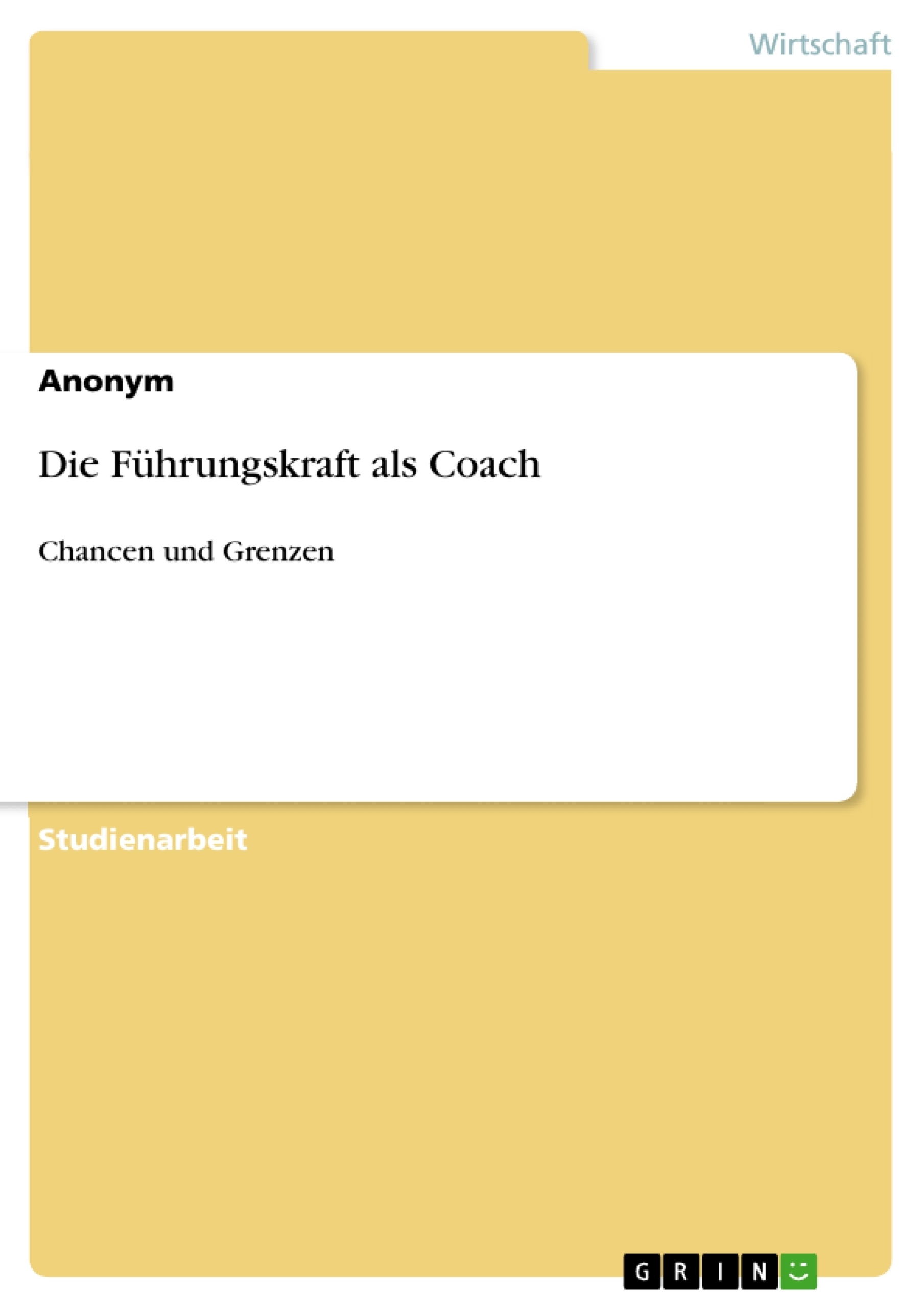„Es klingt zu schön um wahr zu sein, dass an 250 Tagen im Jahr die Arbeit erledigt wird und an 250 Tagen im Jahr jeder einzelne Mitarbeiter an seiner Entwicklung arbeitet, doch genau das erreicht der Manager als Coach.“
Anhand dieses Zitats wird die euphorische Wirkung des Coaching deutlich. Das Phänomen Coaching liegt im Trend und der Markt boomt, obwohl teilweise nicht immer eindeutig ist, was genau angeboten wird. Eine große Anzahl an Seminaren, Kursen oder Workshops werden unter dem Oberbegriff Coaching ausgeschrieben. Die Nutzung des Titels schwimmt beinahe auf einer inflationären Welle. Es lässt sich nicht immer genau ableiten was hinter dem Titel Coaching steckt: Training oder Beratung.
Dabei gibt es im Coaching unterschiedliche Sichtweisen. Zum einen auf die berufliche Perspektive bezogen und zum anderen wird das Privatleben auch mit einbezogen um die Work-Life-Balance zu betrachten. Sobald aber die Betrachtungsweise mehr auf private Probleme abzielt, wird natürlich obiges Zitat nicht mehr gültig, da in diesem die berufliche Leistungssteigerung ausdrückt.
Da Coaching nicht nur für berufliche und private Problemstellungen genutzt wird, sondern auch im Sport einbezogen wird, ist eine genaue Definition schwierig. Selbst im englischen Sprachgebrauch steht Coaching für einen Führungsstil, was wiederum eine Differenzie-rung des Begriffes Coaching nach sich zieht.
Der Begriff Führung und seine Wirkungsweise hat bisher eine viel ausgiebigere Forschung erfahren. Die englische Bedeutung des Coaching als Führungsstil wurde in den 80er Jahren mit der deutschen Sichtweise – Coaching als individuelle und begleitende Beratung - in Berührung gebracht. So ergab sich ein neues Ideal für Führungskräfte. Sie sahen sich als Coach für ihre Mitarbeiter. Dadurch wurde das Zusammenspiel zwischen Führungskraft und Mitarbeiter weiterentwickelt und aufgewertet.
Aufgrund eines steigenden Interesses an unkonventionellen Instrumenten der Personal-entwicklung in den letzten Jahren hat Coaching nun einen großen Stellenwert in diesem Bereich eingenommen. Dem Coaching werden auch zukünftig eine tragende Rolle und ein weiteres Wachstum der Bedeutung vorausgesagt. Erkennbar wird dies durch eine repräsentative Umfrage deutscher Großunternehmen des Jahres 2004. So gaben 88% der befragten Personalmanager an, dass das Coaching weiter an Bedeutung gewinnen wird. Folgerichtig kann Coaching nicht mehr nur als Trend gesehen werden,...
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG
- 2 COACHING: VON DER RAUPE ZUM SCHMETTERLING
- 2.1 HERKUNFT DES COACHING BEGRIFFES
- 2.2 ABGRENZUNG DES COACHING
- 2.3 BEGRIFFSBESTIMMUNG UND METAPHORISCHE BETRACHTUNG
- 2.4 VARIANTEN DES COACHING
- 3 DIE FÜHRUNGSKRAFT ALS COACH ALS SONDERFORM DES COACHING
- 3.1 EINFÜHRUNG IN DIE THEMATIK
- 3.2 RAHMENBEDINGUNGEN FÜR COACHING DURCH DEN VORGESETZTEN
- 3.3 ANFORDERUNGEN AN EINEN GUTEN COACH
- 4 DIE 4 COACHINGSTILE
- 5 DER COACHING-PROZESS
- 6 CHANCEN UND GRENZEN DES COACHINGSANSATZES FÜHRUNGSKRAFT ALS COACH
- 6.1 CHANCEN DES COACHINGANSATZES FÜHRUNGSKRAFT ALS COACH
- 6.1.1 Chancen der Führungskraft
- 6.1.2 Chancen für den Mitarbeiter
- 6.1.3 Chancen für das Unternehmen
- 6.2 GRENZEN DES COACHINGSANSATZES FÜHRUNGSKRAFT ALS COACH
- 6.2.1 Verstöße gegen die Grundprinzipien des Coaching
- 6.2.2 Zusätzliche Risiken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Rolle der Führungskraft als Coach, beleuchtet die Chancen und Grenzen dieses Ansatzes und analysiert dessen Bedeutung für Führungskraft, Mitarbeiter und Unternehmen. Es wird auf die Abgrenzung des Coachings zu ähnlichen Konzepten eingegangen und der Coachingprozess selbst näher betrachtet.
- Die Definition und Abgrenzung des Coaching-Begriffs
- Die Anforderungen an eine Führungskraft in der Rolle als Coach
- Die Chancen des Coaching-Ansatzes für Führungskräfte, Mitarbeiter und Unternehmen
- Die Grenzen und Risiken des Coaching-Ansatzes durch Führungskräfte
- Der Coaching-Prozess und verschiedene Coaching-Stile
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und veranschaulicht die wachsende Bedeutung von Coaching im beruflichen Kontext. Sie hebt die Notwendigkeit einer präzisen Definition von Coaching hervor und betont die zunehmende Verbreitung des Begriffs, die teilweise zu einer inflationären Verwendung führt. Die Einleitung deutet auf die unterschiedlichen Perspektiven und Anwendungsbereiche von Coaching hin, sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext.
2 Coaching: Von der Raupe zum Schmetterling: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Begriffs "Coaching", von seinen Anfängen im 19. Jahrhundert als Bezeichnung für private Tutoren bis hin zur heutigen Verwendung im beruflichen und sportlichen Kontext. Es wird die etymologische Herkunft des Wortes diskutiert und die metaphorische Bedeutung von Coaching als Begleitung auf dem Weg zum Ziel erläutert. Der Kapitel beschreibt die verschiedenen Aspekte des Coaching Prozesses, die den lösungsorientierten und dialektischen Charakter betonen.
3 Die Führungskraft als Coach als Sonderform des Coaching: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die spezifischen Aspekte des Coachings durch Führungskräfte. Es werden die Rahmenbedingungen, Voraussetzungen und Anforderungen an einen guten Coach im Führungskontext beleuchtet. Es wird dargelegt, wie Führungskräfte Coaching-Methoden effektiv einsetzen können, um die Entwicklung ihrer Mitarbeiter zu fördern und gleichzeitig die Unternehmensziele zu erreichen. Der Fokus liegt auf den besonderen Herausforderungen und Chancen, die sich aus dieser Konstellation ergeben.
4 Die 4 CoachingStile: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Coaching-Stile, ohne diese im Detail zu beschreiben (da dies für die Gesamtübersicht nicht notwendig ist). Es dient der Kontextualisierung und der Veranschaulichung der Vielfalt an Methoden, die im Coaching-Prozess eingesetzt werden können.
5 Der Coaching-Prozess: Dieses Kapitel bietet eine kurze Übersicht über den Coaching-Prozess, ohne diesen detailliert darzustellen. Es dient als Brücke zu den folgenden Kapiteln, die sich mit den Chancen und Grenzen des Ansatzes befassen.
6 Chancen und Grenzen des Coachingsansatzes Führungskraft als Coach: Dieses Kapitel analysiert detailliert die Vor- und Nachteile des Coachings durch Führungskräfte. Es werden sowohl die Chancen für Führungskraft, Mitarbeiter und Unternehmen beleuchtet, als auch die möglichen Risiken und Grenzen dieses Ansatzes, z.B. Verstöße gegen die Grundprinzipien des Coachings und zusätzliche Risiken die aus der Hierarchie entstehen. Die Zusammenfassung dieses Kapitels wird eine ausführliche Darstellung der positiven und negativen Aspekte enthalten.
Schlüsselwörter
Coaching, Führungskraft, Mitarbeiterentwicklung, Personalentwicklung, Chancen, Grenzen, Coaching-Stile, Coaching-Prozess, Selbstreflexion, Zielerreichung, Unternehmenserfolg.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Führungskraft als Coach"
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit befasst sich umfassend mit der Rolle der Führungskraft als Coach. Sie untersucht die Chancen und Grenzen dieses Ansatzes und analysiert dessen Bedeutung für Führungskräfte, Mitarbeiter und das Unternehmen. Die Arbeit beinhaltet eine Definition und Abgrenzung des Coaching-Begriffs, die Anforderungen an eine Führungskraft in der Coaching-Rolle, eine Analyse der Chancen und Risiken sowie eine Betrachtung des Coaching-Prozesses und verschiedener Coaching-Stile.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen im Detail: die historische Entwicklung des Coaching-Begriffs, die Abgrenzung des Coachings zu anderen Konzepten, verschiedene Coaching-Stile (obwohl nicht im Detail beschrieben), den Coaching-Prozess (ebenfalls in einer Übersicht), die Chancen des Coaching-Ansatzes für alle Beteiligten (Führungskraft, Mitarbeiter, Unternehmen) und die Grenzen und Risiken, insbesondere Verstöße gegen Coaching-Prinzipien und hierarchiebedingte Risiken. Der Fokus liegt auf dem Coaching durch Führungskräfte als spezielle Form des Coachings.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zur Begriffsbestimmung und Entwicklung des Coachings, ein Kapitel zum Coaching durch Führungskräfte, ein Kapitel zu verschiedenen Coaching-Stilen (kurze Übersicht), ein Kapitel zum Coaching-Prozess (kurze Übersicht) und abschließend ein Kapitel zu den Chancen und Grenzen des Coachings durch Führungskräfte.
Was sind die Zielsetzung und Themenschwerpunkte der Arbeit?
Die Zielsetzung ist die Untersuchung der Rolle der Führungskraft als Coach, die Analyse der Chancen und Grenzen dieses Ansatzes und die Bewertung dessen Bedeutung für Führungskraft, Mitarbeiter und Unternehmen. Die Themenschwerpunkte sind die Definition und Abgrenzung des Coaching-Begriffs, die Anforderungen an Führungskräfte als Coaches, die Chancen und Risiken des Ansatzes, sowie der Coaching-Prozess und verschiedene Coaching-Stile.
Welche Chancen bietet Coaching durch Führungskräfte?
Die Arbeit identifiziert Chancen für die Führungskraft (z.B. verbesserte Mitarbeiterführung), den Mitarbeiter (z.B. persönliche und berufliche Entwicklung) und das Unternehmen (z.B. gesteigerte Effizienz und Mitarbeiterbindung). Diese Chancen werden im Detail im Kapitel "Chancen und Grenzen" beleuchtet.
Welche Grenzen und Risiken birgt Coaching durch Führungskräfte?
Die Arbeit benennt verschiedene Grenzen und Risiken, z.B. Verstöße gegen die Grundprinzipien des Coachings durch die Führungskraft und zusätzliche Risiken, die aus der Hierarchiebeziehung entstehen können. Diese Risiken werden ebenfalls im Kapitel "Chancen und Grenzen" ausführlich diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Coaching, Führungskraft, Mitarbeiterentwicklung, Personalentwicklung, Chancen, Grenzen, Coaching-Stile, Coaching-Prozess, Selbstreflexion, Zielerreichung, Unternehmenserfolg.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die die wichtigsten Punkte jedes Kapitels hervorhebt und den Lesefluss erleichtert.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2008, Die Führungskraft als Coach, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/149874