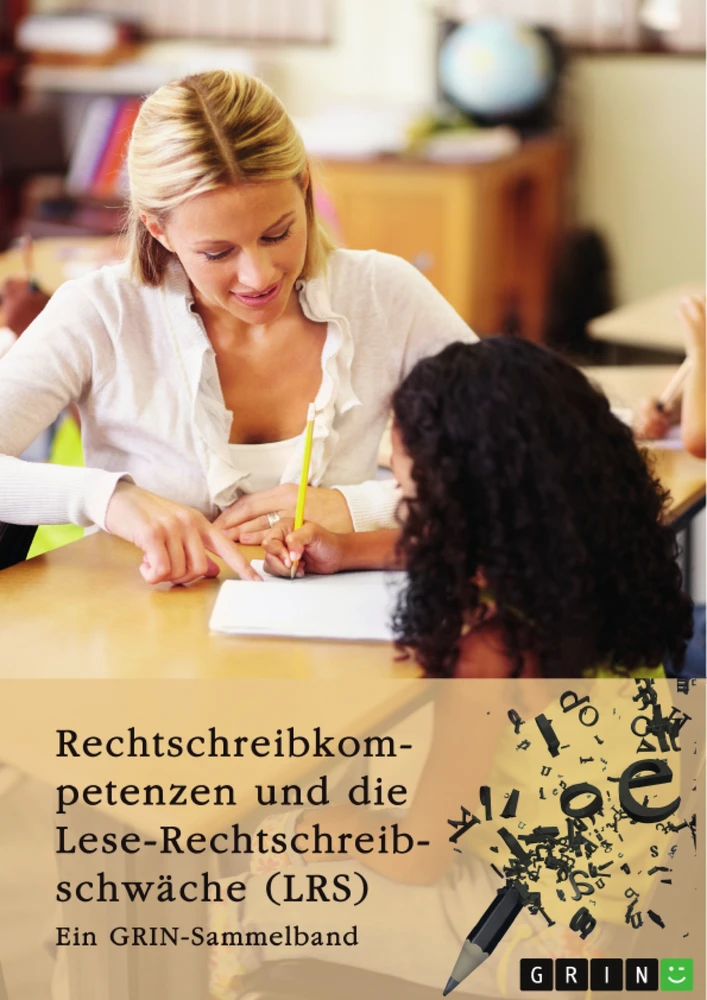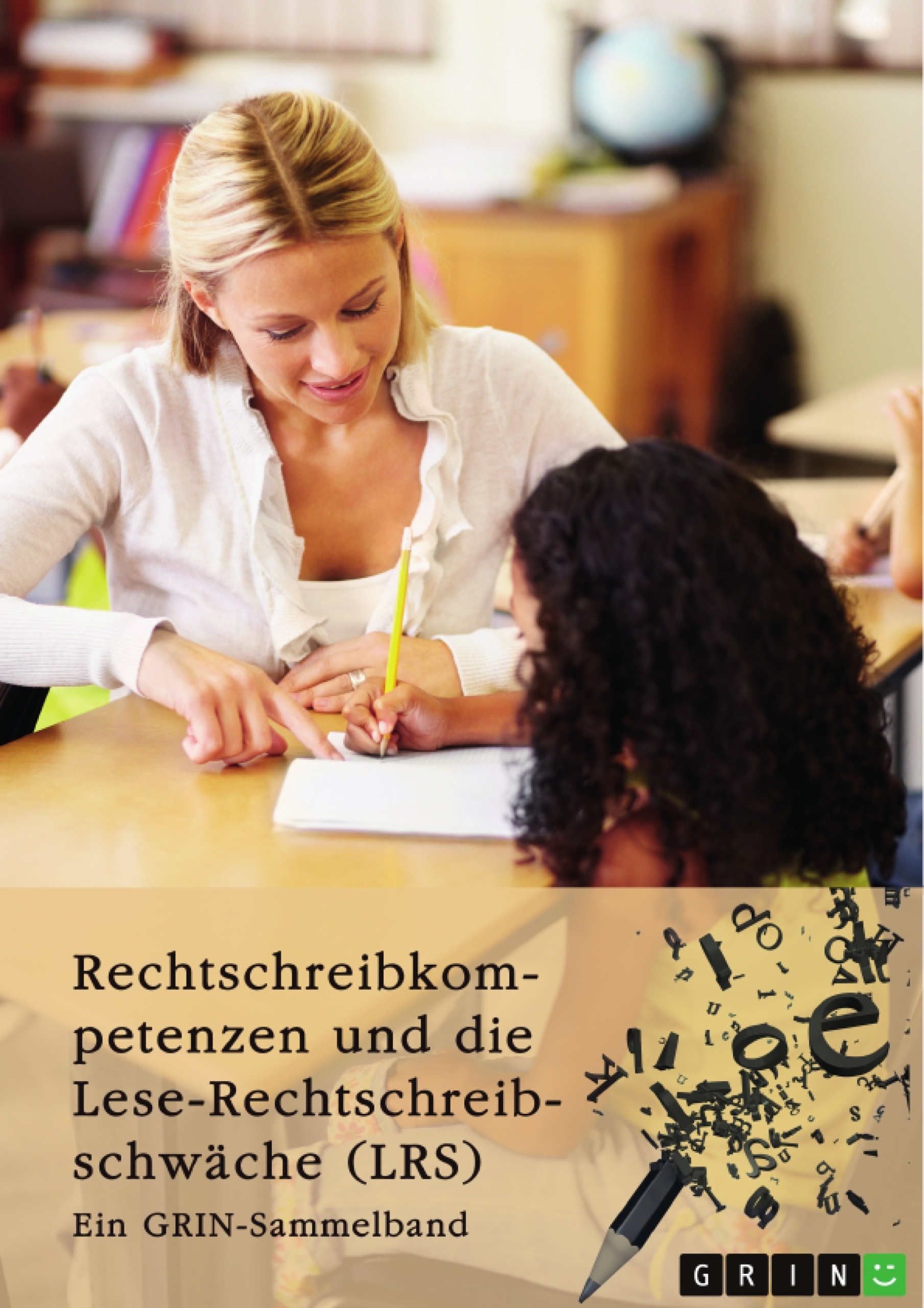Dieser Sammelband enthält sechs Hausarbeiten.
Im Laufe der Zeit wurden einige Verfahren entwickelt, Rechtschreibkompetenzen von Schülern zu ermitteln. Die erste Arbeit hat zum Ziel, die Chancen und Grenzen testabhängiger und testunabhängiger Verfahren im Hinblick auf Diagnose im Bereich der Orthografie am Beispiel der Hamburger Schreibprobe (HSP) und der Oldenburger Fehleranalyse (OLFA) zu beleuchten.
Die zweite Hausarbeit beschäftigt sich im Hinblick auf die Lese-Rechtschreibstörung (LRS) mit dem Förderprogramm des Marburger Rechtschreibtrainings. Dabei soll vorerst grundlegend auf die Problematik der Lese-Rechtschreibstörung eingegangen werden, bevor vor dem Hintergrund dessen verschiedene Fördermöglichkeiten bzw. Förderprogramme und ihre Wirksamkeit vorgestellt werden.
Die dritte Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie man bei Kindern eine Lese-Rechtschreibschwäche im schulischen Kontext in der Grundschule diagnostizieren und ihr entgegenwirken kann, damit auch sie die Schriftsprache bestmöglich erlernen können und sich in ihrem Alltag gut zurechtfinden.
Im Rahmen der vierten Arbeit wird das Thema „Was passiert beim Schreiben – Die Entwicklung des Schreibprozessmodells von Hayes und Flower im Ablauf der Zeit“ beleuchtet. Ziel dieser Arbeit ist es, dem Leser eine Antwort auf die Forschungsfrage „Inwiefern hat die Kritik am Model von Hayes und Flower die Entwicklung weiterer Schreibprozessmodelle beeinflusst?“ zu geben.
Um zu überprüfen, wie die Relevanz von Rechtschreibdidaktik als ein Schwerpunkt des Deutschunterrichtes einzuschätzen ist und ob es sich eventuell nur noch um eine Randthematik handelt, wird im fünften Text zunächst dargelegt, durch welche Prinzipien und Leitziele sich der Rechtschreibunterricht auszeichnet, also was er leisten muss.
In der sechsten Arbeit soll untersucht werden, ob es tatsächlich sinnvoll ist, sich beim Lehren von Orthographie nur am phonologischen Prinzip zu orientieren. Dazu werden zuerst alle Rechtschreibprinzipien des Deutschen vorgestellt, um einen Überblick zu gewinnen und zu verdeutlichen, dass es neben dem phonologischen eben noch andere ausschlaggebende Prinzipien gibt. Hier ist anzumerken, dass die Strukturierung der Prinzipien stark variiert und fast von Lehrbuch zu Lehrbuch unterschiedlich ist.
Inhaltsverzeichnis
- Prüfung von Rechtschreibkompetenzen. Hamburger Schreibprobe und Oldenburger Fehleranalyse im Vergleich (Hausarbeit, 2017)
- Einleitung
- Hamburger Schreibprobe
- Durchführung
- Auswertung
- Chancen und Grenzen der Hamburger Schreibprobe
- Oldenburger Fehleranalyse
- Durchführung
- Auswertung
- Chancen und Grenzen der OLFA im Vergleich zur HSP
- Fazit
- Marburger Rechtschreibtraining. Grenzen und Potenzial (Seminararbeit, 2016)
- Einleitung
- Lese-Rechtschreibschwierigkeiten
- Mögliche Fördermöglichkeiten bei LRS
- Das Marburger Rechtschreibtraining
- Ansatz und Wirksamkeit
- Studienlage und Ergebnisse
- Abgrenzung zur Lautgetreuen Lese-Rechtschreibförderung
- Grenzen und Potenziale des Marburger Rechtschreibtrainings
- Ausblick und Fazit
- Einleitung
- Diagnose und Förderung von Kindern mit Lese-Rechtschreib-Schwäche im schulischen Kontext (Hausarbeit, 2021)
- Einleitung
- Lese-Rechtschreibschwäche aus entwicklungspsychologischer Sicht
- Mögliche Symptome einer LRS
- Entwicklungspsychologisches Modell nach Uta Frith
- Vorläuferfertigkeiten
- Ursachen
- Diagnostik
- Diagnostische Möglichkeiten
- Diagnostik der Lesekompetenz
- Diagnostik der Rechtschreibkompetenz
- Schulische Förderung
- Förderung des Lesens
- Förderung des Rechtschreibens
- Exemplarische Fördermaterialien
- Prävention
- Fazit
- Was passiert beim Schreiben? Die Entwicklung des Schreibprozessmodells von Hayes und Flower im Ablauf der Zeit (Seminararbeit, 2021)
- Einleitung
- Definition von Schreibprozess
- Das Schreibprozessmodell von Hayes und Flower
- Aufgabenumgebung
- Langzeitgedächtnis
- Planung und Ausführung
- Anklang und Kritik am Urmodell von Hayes und Flower
- Anklang des Modells
- Kritik am Model von Hayes und Flower
- Weiterentwicklungen des Modells
- Modell von Hayes (1996)
- Modell von Molitor-Lübbert (1991)
- Fazit
- Rechtschreibdidaktik als Randthematik des Deutschunterrichts (Hausarbeit, 2019)
- Einleitung
- Prinzipien des Rechtschreibunterrichts
- Historische Entwicklung des Stellenwertes von „Schriftlichkeit“
- Eigene Beobachtungen zur Rechtschreibkompetenz
- Empirische Ergebnisse zur Rechtschreibkompetenz
- Kompetenz der SchülerInnen
- Kompetenz der LehrerInnen
- Methoden der Rechtschreibdidaktik
- Fazit
- Lernen der deutschen Rechtschreibung anhand des phonologischen Prinzips (Seminararbeit, 2021)
- Einleitung
- Prinzipien der deutschen Rechtschreibung
- Argumente für eine ausschließliche Orientierung am phonologischen Prinzip
- Argumente gegen eine ausschließliche Orientierung am phonologischen Prinzip
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Sammelband befasst sich mit verschiedenen Aspekten der Rechtschreibkompetenz und der Lese-Rechtschreibschwäche (LRS). Die einzelnen Beiträge beleuchten die Prüfung von Rechtschreibkompetenzen, die Diagnose und Förderung von Kindern mit LRS sowie Themen der Rechtschreibdidaktik.
- Prüfung von Rechtschreibkompetenzen
- Diagnose und Förderung von LRS
- Entwicklung und Anwendung von Rechtschreibtrainingsmethoden
- Theoretische Modelle des Schreibprozesses
- Stellenwert der Rechtschreibkompetenz im Deutschunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
- Die erste Hausarbeit analysiert die Hamburger Schreibprobe und die Oldenburger Fehleranalyse als Instrumente zur Prüfung von Rechtschreibkompetenzen. Sie vergleicht die beiden Verfahren hinsichtlich Durchführung, Auswertung und Chancen und Grenzen.
- Die zweite Seminararbeit untersucht das Marburger Rechtschreibtraining, dessen Ansatz, Wirksamkeit, Grenzen und Potenziale beleuchtet werden. Dabei wird auch die Abgrenzung zur Lautgetreuen Lese-Rechtschreibförderung thematisiert.
- Die dritte Hausarbeit beschäftigt sich mit der Diagnose und Förderung von Kindern mit LRS im schulischen Kontext. Sie beleuchtet die Entwicklungspsychologie der LRS, Vorläuferfertigkeiten, Ursachen, diagnostische Möglichkeiten und fördernde Maßnahmen.
- Die vierte Seminararbeit analysiert das Schreibprozessmodell von Hayes und Flower. Sie untersucht die Entstehung des Modells, seine Weiterentwicklungen, Anklang und Kritik.
- Die fünfte Hausarbeit behandelt die Rechtschreibdidaktik im Kontext des Deutschunterrichts. Sie analysiert Prinzipien des Rechtschreibunterrichts, die historische Entwicklung des Stellenwerts von Schriftlichkeit und empirische Ergebnisse zur Rechtschreibkompetenz.
- Die sechste Seminararbeit setzt sich mit dem Lernen der deutschen Rechtschreibung anhand des phonologischen Prinzips auseinander. Sie diskutiert Argumente für und gegen eine ausschließliche Orientierung an diesem Prinzip.
Schlüsselwörter
Rechtschreibkompetenz, Lese-Rechtschreibschwäche (LRS), Diagnostik, Förderung, Rechtschreibtraining, Schreibprozessmodell, Rechtschreibdidaktik, phonologisches Prinzip, Deutschunterricht.
- Quote paper
- GRIN Verlag (Hrsg.) (Editor), Kim Eileen Beckmannn (Author), Friederike Jung (Author), 2024, Rechtschreibkompetenzen und die Lese-Rechtschreibschwäche (LRS). Prüfung von Rechtschreibkompetenzen, Diagnose und Förderung von Kindern mit LRS und Themen der Rechtschreibdidaktik, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1497464