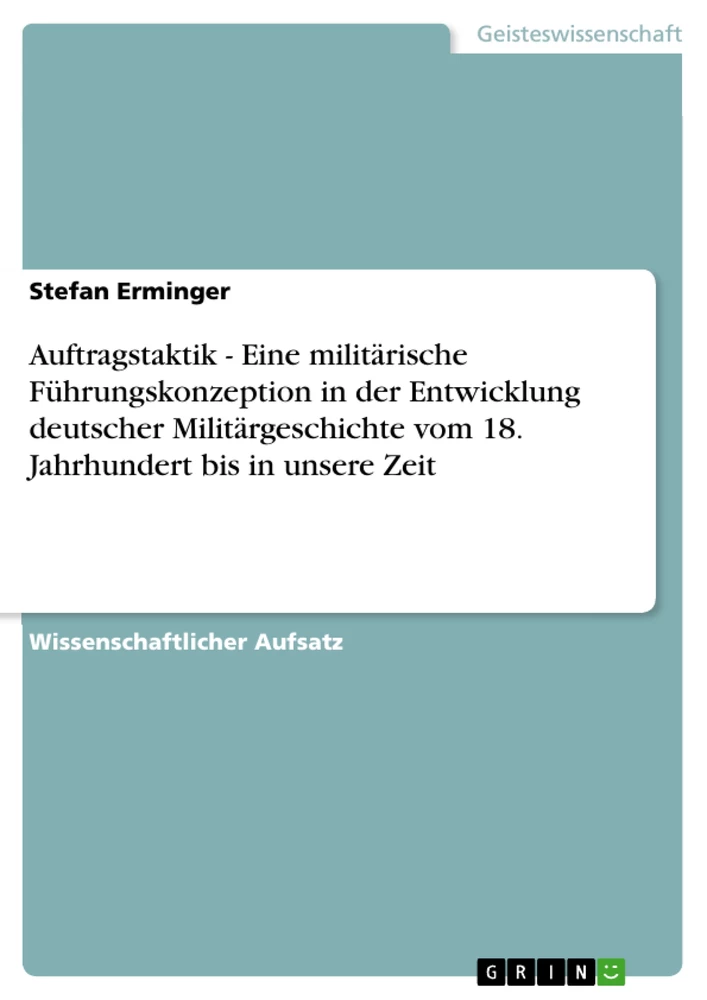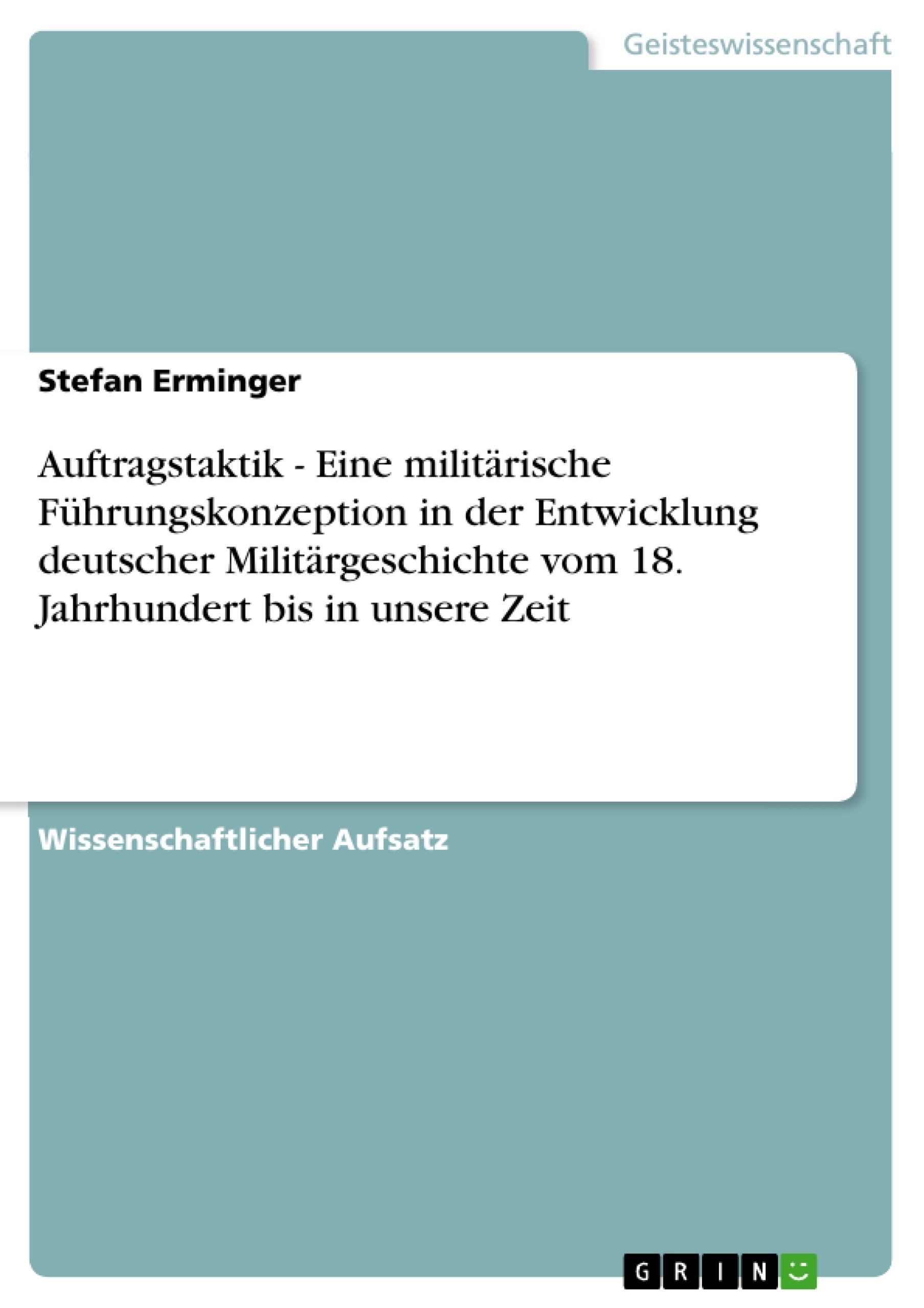Führen im Gefecht kann bedeuten: Führen durch Kommando, also mit vorgeschriebenen Wortlaut, das ein bis in die Körperhaltung festgelegtes, langfristig einexerziertes Verhalten auslöst und aufgrund der Einheitlichkeit der Bewegungen leicht kontrollierbar ist.
In seiner reinsten Form wurde dieses Führungsverhalten im Marsch und beim „Chargieren“, dem drillmäßigen Feuerkampf zur Zeit der Lineartaktik angewandt, das Kommando war häufig reduziert auf ein Trommelsignal.
Führen im Gefecht kann bedeuten: Führen durch Befehl, also durch Anweisung mit freiem Wortlaut, aber gerichtet auf exakte Koordinierung von Bewegungen und Feuer.
Wie beim Führen durch Kommando liegt die Verantwortung beim Befehlenden, für Eigeninitiative ist wenig Raum, Ziel und Weg zum Ziel werden dem Ausführenden befohlen. Dieses Verfahren ist unumgänglich, solange Linien gehalten werden müssen, seine hohe Zeit liegt im Stellungskrieg des Ersten Weltkrieges.
Führen im Gefecht kann bedeuten: Führen durch Auftrag. In diesem Fall wird ein Ziel benannt, die Mittel zu seiner Erreichung zugewiesen, der Weg zum Verwirklichen jedoch dem Ausführenden überlassen.
Diese Verfahren verlangt weitgehende Freiheit von Rücksichtnahmen auf Nachbarn, es wird am ehesten bei Handstreichen und im Angriff angewandt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Vorläufer taktischer Vorschriften
- II. Probleme der Generalstabschefs
- III. Neue Vorschriften
- IV. Einheitliches Denken
- V. Perfektionierte und zentralisierte Führung
- VI. Neuer Begriff: »Auftragstaktik«
- VII. »Verteidigung« in der T.F. 1933
- VIII. Kriegsgeschichtliche Beispiel aus dem Russlandfeldzug
- IX. Wieder zentralisierte Befehlstaktik
- Literaturnachweis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Entwicklung der Auftragstaktik in der deutschen Militärgeschichte vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Er untersucht die verschiedenen Phasen der Führungskonzeption, die von der strikten Befehlstaktik über die Einführung von flexibleren Führungsprinzipien bis hin zur Wiederherstellung einer zentralisierten Befehlstaktik reichen.
- Entwicklung der Auftragstaktik in der deutschen Militärgeschichte
- Vergleich verschiedener Führungskonzeptionen (Kommando, Befehl, Auftrag)
- Einfluss von historischen Ereignissen auf die Entwicklung der Auftragstaktik
- Bedeutung der Selbständigkeit von Führern und die damit verbundene Verantwortung
- Kritik an der traditionellen Befehlstaktik und die Suche nach flexibleren Führungsformen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die verschiedenen Führungsformen im Gefecht vor: Führen durch Kommando, Führen durch Befehl und Führen durch Auftrag. Sie zeigt die Vor- und Nachteile der jeweiligen Formen auf und stellt die Auftragstaktik als ein flexibles und eigeninitiatives Führungsprinzip dar.
Kapitel I beleuchtet die Vorläufer taktischer Vorschriften im 18. Jahrhundert. Es werden die Instruktionen von Friedrich II. und die Generalreglemente in Preußen und Österreich vorgestellt, die bereits Elemente der Auftragstaktik enthielten.
Kapitel II analysiert die Probleme, die die Generalstabschefs im 19. Jahrhundert mit der traditionellen Befehlstaktik hatten. Es wird gezeigt, wie die starre Befehlskette zu Ineffizienz und Fehlentscheidungen führte.
Kapitel III beschreibt die Einführung neuer Vorschriften, die auf eine flexiblere Führung abzielten. Es werden die Bemühungen um die Entwicklung einer Auftragstaktik im späten 19. Jahrhundert dargestellt.
Kapitel IV beleuchtet die Entstehung eines einheitlichen Denkens in der deutschen Armee, das auf die Prinzipien der Auftragstaktik basierte. Es werden die wichtigsten Vertreter dieser Denkweise vorgestellt.
Kapitel V beschreibt die Perfektionierung und Zentralisierung der Führung im frühen 20. Jahrhundert. Es wird gezeigt, wie die Auftragstaktik in der Praxis umgesetzt wurde und welche Auswirkungen sie auf die Organisation der Armee hatte.
Kapitel VI definiert den Begriff »Auftragstaktik« und stellt die wichtigsten Merkmale dieser Führungskonzeption dar. Es werden die Vorteile und Nachteile der Auftragstaktik im Vergleich zur Befehlstaktik diskutiert.
Kapitel VII untersucht die Anwendung der Auftragstaktik in der Wehrmacht im Jahr 1933. Es werden die spezifischen Herausforderungen und die Umsetzung der Auftragstaktik in der Verteidigung dargestellt.
Kapitel VIII analysiert ein kriegsgeschichtliches Beispiel aus dem Russlandfeldzug, um die Anwendung der Auftragstaktik in der Praxis zu beleuchten. Es werden die Stärken und Schwächen der Auftragstaktik im Kontext des Zweiten Weltkriegs diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Auftragstaktik, die deutsche Militärgeschichte, Führungskonzeptionen, Befehlstaktik, Selbständigkeit, Verantwortung, Flexibilität, Kriegführung, Militärreform, Generalstab, Wehrmacht, Russlandfeldzug, Zweiter Weltkrieg.
- Arbeit zitieren
- Stefan Erminger (Autor:in), 2010, Auftragstaktik - Eine militärische Führungskonzeption in der Entwicklung deutscher Militärgeschichte vom 18. Jahrhundert bis in unsere Zeit, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/149698