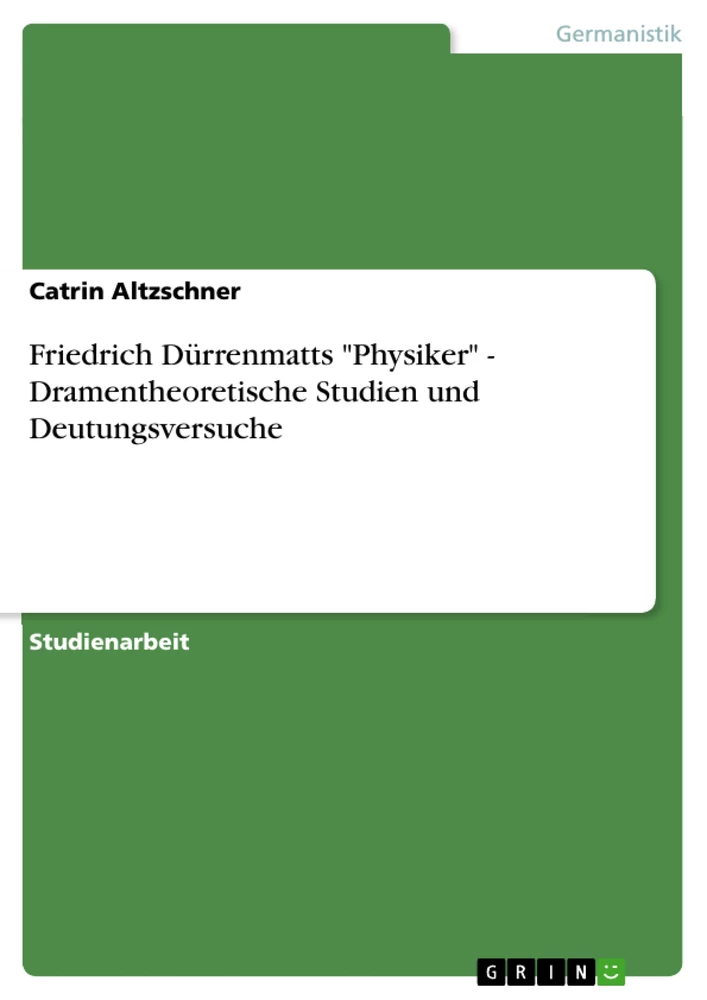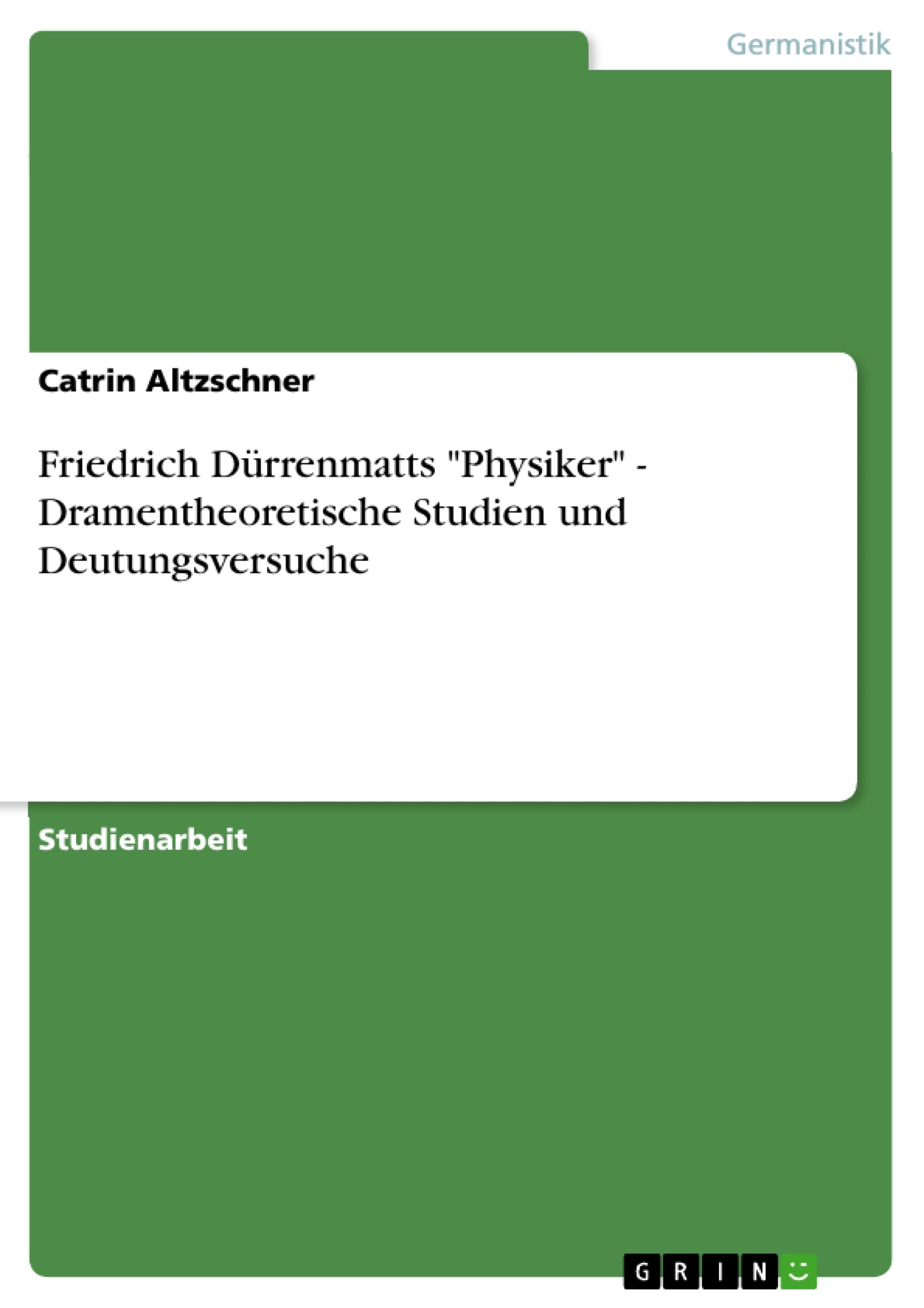1956 erschien von Robert Jungk das Buch „Heller als tausend Sonnen“, das sich mit der Entwicklung der Atombombe (dem Manhattan-Projekt) und dem Schicksal der daran beteiligten Forscher befasste. Dürrenmatt verfasste 1957 eine Rezension dieses Buchs für „Die Weltwoche“ und baute seine Gedanken später in „Die Physiker“ ein.
Mit diesem Stück sollte Dürrenmatt einen Erfolg von Weltrang erlangen. Die Genesis dieser arglistigen Komödie fiel in die Zeit des Baus der Berliner Mauer, der Zeit des Kalten Krieges und nur unerhebliche Monate nach der Uraufführung sollte es zur Kuba-Krise kommen. Am 21. Februar 1962 findet die Uraufführung im Züricher Schauspielhaus statt. Die Weltformel ward von dem genialen Physiker Möbius entdeckt worden. Dieser fürchtet sich jedoch diese Erkenntnis zur Vernichtung der Erde in die Hände einer moralisch degenerierten Menschheit fallen zu lassen. Möbius versteckt sich vor den Folgen seiner Forschungen in der Nervenheilanstalt und spielt den Irren. Was er aber nicht weiß ist, dass zwei politische Geheimdienste ihm auf der Spur sind. Am Ende bleibt nur eine Erkenntnis: Was einmal je gedacht wurde, kann nicht mehr zurückgenommen werden.
Medienberichte über eine so genannte neue atomare Bedrohung im Nahen Osten lassen „Die Physiker“ in neuem Licht erscheinen, auch die Entwicklung der Gentechnologie stellt erneut und verstärkt die Frage nach der Verantwortung der Wissenschaft, was nicht zu letzt als Anreiz gesehen werden kann, sich erneut mit diesem brisanten Theaterstück auseinander zu setzen.
Die vorliegende Hausarbeit widmet sich unter Berücksichtigung des historischen Kontexts thematischen und formalen Aspekten des Schauspiels „Die Physiker“. Wichtigsten theoretische und dramaturgische Merkmale der vom Autor entwickelten Theaterform sollen dabei aufgegriffen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- „Die Physiker“ im Blickwinkel der Dramentheorie
- Bauelemente des Dramas und dramaturgische Begriffe
- Theorie und Wirkungsabsicht des Dramas
- „Die Physiker“ – Ein Deutungsversuch
- Ausblick
- Literaturabgaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Theaterstück „Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt. Im Fokus stehen dabei die thematischen und formalen Aspekte des Stücks, betrachtet im Kontext der Dramentheorie. Die Arbeit analysiert die wichtigsten theoretischen und dramaturgischen Merkmale der von Dürrenmatt entwickelten Theaterform und beleuchtet die Verbindung von historischem Kontext und künstlerischer Gestaltung.
- Die Dramentheorie als Grundlage für die Interpretation von „Die Physiker“
- Dürrenmatts spezifische Dramenkonzeption und seine Wirkungsabsicht
- Die Rolle des Absurden in Dürrenmatts Werk
- Das Verhältnis von Wissenschaft und Moral im Stück
- Die Bedeutung des Labyrinths als Symbol für die menschliche Existenz
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich der Dramentheorie und erläutert grundlegende dramaturgische Begriffe. Dabei werden wichtige Konzepte des antiken Dramas, insbesondere die drei Einheiten von Ort, Zeit und Handlung, sowie die Entwicklung der Dramentheorie von Aristoteles über Lessing bis Brecht beleuchtet.
Das zweite Kapitel analysiert „Die Physiker“ unter Berücksichtigung der im ersten Kapitel dargestellten theoretischen Ansätze. Es werden die wichtigsten Elemente des Stücks, wie die Figuren, der Plot und die Handlung, sowie die zentrale Frage nach der Verantwortung der Wissenschaft betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Physiker, Friedrich Dürrenmatt, Dramentheorie, Absurdes, Wissenschaft, Moral, Verantwortung, Labyrinths, Theaterform, historischer Kontext, antikes Drama, Aristoteles, Lessing, Brecht.
- Quote paper
- Magistra Artium Catrin Altzschner (Author), 2008, Friedrich Dürrenmatts "Physiker" - Dramentheoretische Studien und Deutungsversuche, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/149637