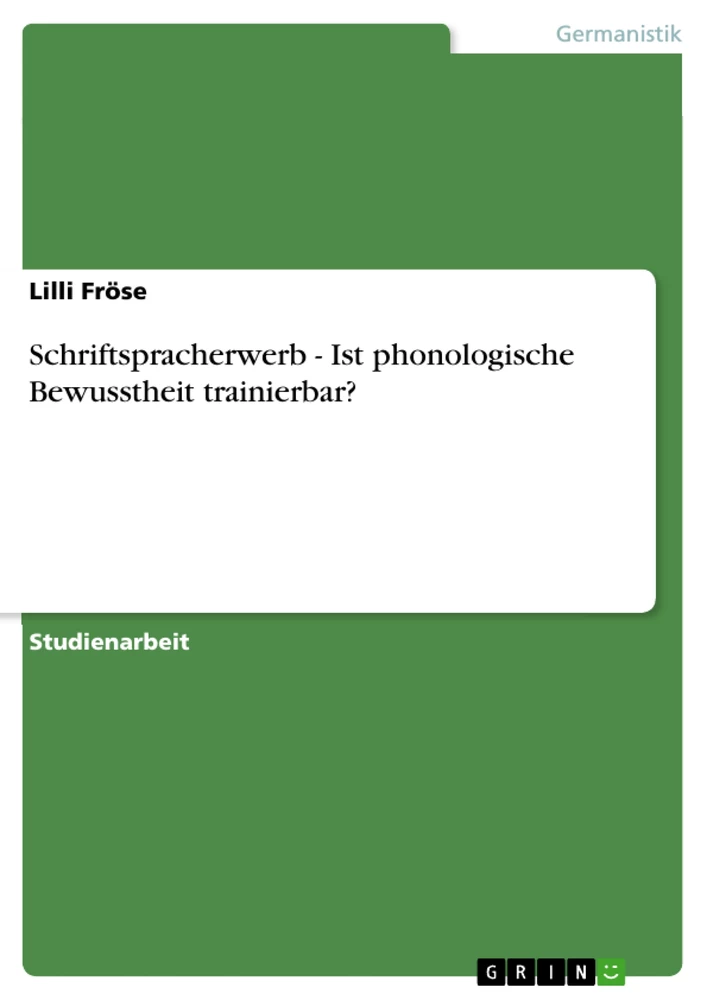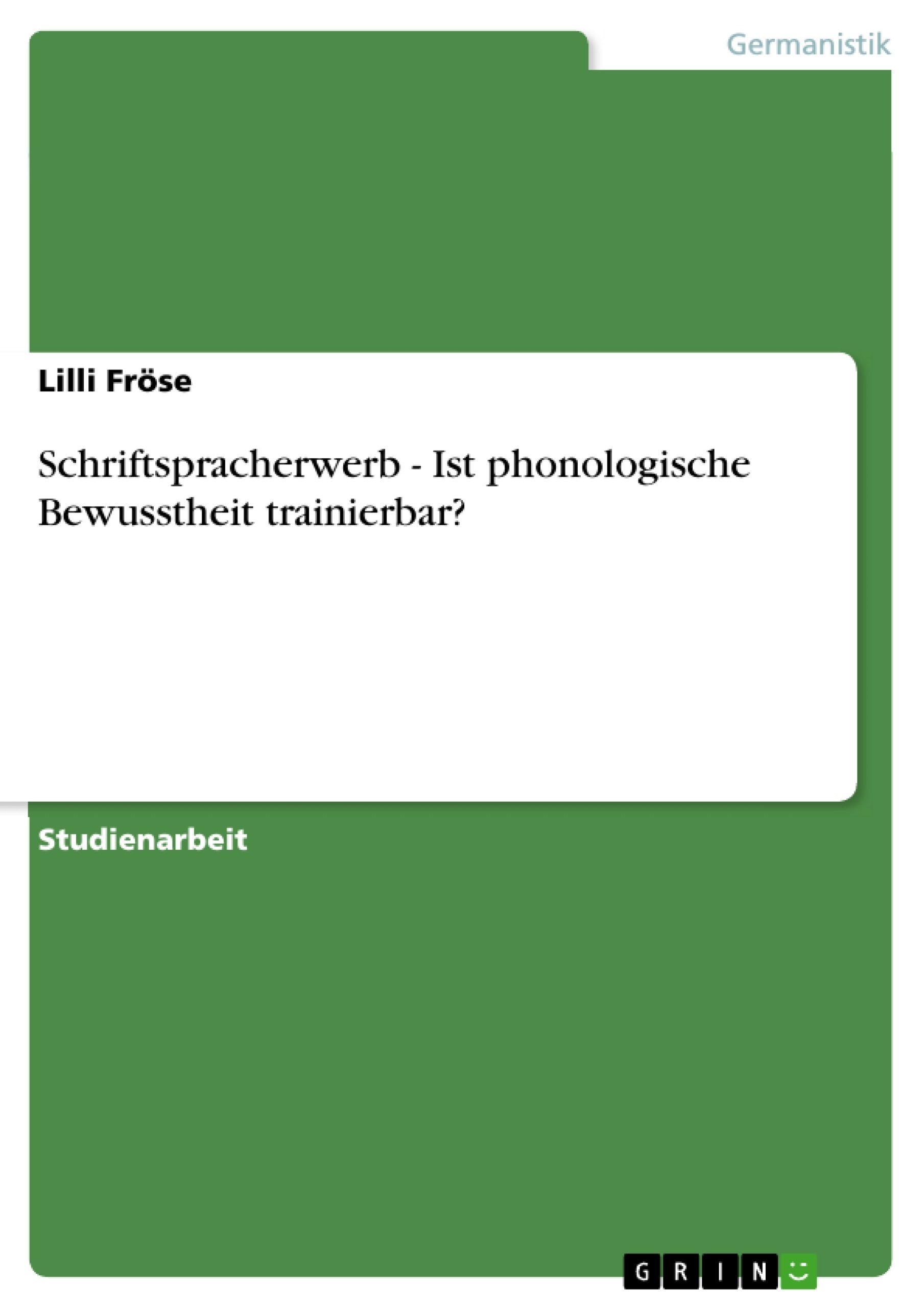Endlich ist es soweit, das Kind wird eingeschult. Mit gemischten Gefühlen schicken die Eltern ihren Erstklässler ‚ins Leben’. Viele Fragen gehen ihnen dabei durch den Sinn: Wie wird es sich entwickeln? Wird es gut mitkommen? Was ist, wenn Probleme entstehen? Andererseits, das Kind war reif für neue Herausforderungen. Zumindest hat das Gesundheitsamt diese elterliche Beobachtung bestärkt. Bei dem Schulreifetest gab es weder gesundheitliche noch sprachliche Probleme. Also kann doch nichts schief gehen – oder?
Auch der Lehrer/in hat sich emotional auf die neue Klasse einzustellen versucht. Viel Arbeit wurde in die Organisation zum problemlosen Start und für den weiteren Unterrichtsverlauf aufgewendet. Doch schon nach den Herbstferien stellt er fest, dass ein Kind trotz aller Bemühungen, Übungen und Hilfestellungen von seiner Seite und der der Eltern im Deutschunterricht überhaupt nicht mitkommt. An der Intelligenz scheint es nicht zu liegen, die hat es in den anderen Fächern genug unter Beweis gestellt. Schon das Lesen macht dem Schüler Probleme, von den vielen Fehlern beim Schreiben von so oft geübten Worten ganz zu schweigen.
Woran liegt das? Sowohl der Lehrer als auch die Eltern sind sich einig, es muss eine andere Ursache haben. Vielleicht kann hier ein Schulpsychologe helfen?
Nach ausführlichen Einzelgesprächen des Psychologen mit den Eltern und dem Lehrer schlägt der Facharzt vor, einen Test zu machen, um die Probleme des Schulanfängers genauer lokalisieren zu können. Zu diesem Zweck stellt er das Verfahren „Der Rundgang durch Hörhausen“ von Martschinke, Kirschhock & Frank vor, welches zur Diagnose und Förderung im Schriftspracherwerb vor allem für Erstklässler konzipiert wurde (ausführliche Erläuterung unter VIII. 2. 1).
Nach dem Test steht fest: Es liegt nicht an den kognitiven Fähigkeiten, sondern an der schlecht ausgebildeten phonologischen Bewusstheit des Kindes. Nun wird ein Plan erstellt, nach dem der Junge diese Fähigkeiten im Rahmen des Verfahrens üben kann…
Trotz aller Maßnahmen bleiben die Zweifel der Eltern. Zu viele Fragen beschäftigen sie noch: Was ist das eigentlich, phonologische Bewusstheit? Und ist sie überhaupt trainierbar? Macht der ganze Aufwand Sinn?
Im Folgenden wird der Antwort auf diese Fragen im Rahmen des bisherigen Forschungsstandes nachgegangen und die phonologische Bewusstheit auf ihre Eigenschaften und Bedeutung hin untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Phonologische Bewusstheit im Rahmen der Sprachbewusstheit
- II. 1 Phonologische Bewusstheit
- II. 1. 1 Definition
- II. 1. 2 Analysetypologie der Phonologischen Bewusstheit
- II. 2 Phonem-Graphem-Korrespondenz / Graphem-Phonem-Korrespondenz
- II. 3 Rekodieren / Dekodieren
- II. 4 Problem
- II. 5 Sprachbewusstheit
- II. 5. 1 Definition
- II. 5. 2 Bereiche der Sprachbewusstheit
- II. 5. 3 Fazit
- II. 1 Phonologische Bewusstheit
- III. Relevanz der phonologischen Bewusstheit
- III. 1 Vorläufermerkmale des Schriftspracherwerbs
- III. 2 Phonologisches Sprachverständnis bei Vorschulkindern
- IV. Studie zur phonologischen Bewusstheit
- IV. 1 Versuchsplan
- IV. 2 Trainingsprogramm
- IV. 3 Die Tests
- IV. 3. 1 Der Vor- und Nachtest
- IV. 3. 2 Der Metaphonologische Transfertest
- IV. 3. 3 Der Lese- und Rechtschreibtest
- IV. 4 Trainingseffekte
- IV. 4. 1 Unmittelbare Trainingseffekte – Nachtest
- IV. 4. 2 Langfristige Trainingseffekte - Metaphonologischer Transfertest
- IV. 4. 3 Langfristiger Trainingseffekt – Lese- und Rechtschreibtest
- IV. 5 Zusammenfassung der Ergebnisse
- IV. 6 Fazit
- V. Weitere Studien
- VI. Contra - Studien
- VII. Zeitpunkt für das Training der phonologischen Bewusstheit
- VIII. Phonemanalytische Kompetenzen bei Schulbeginn
- VIII. 1 Einleitung
- VIII. 2 Verfahren zur Erfassung phonemanalytischer Kompetenzen
- VIII. 2. 1 Diagnose und Förderung im Schriftspracherwerb. Der Rundgang durch Hörhausen von Martschinke, Kirschhock & Frank
- VIII. 2. 2 Das Bielefelder Screening (BISC) zur Erkennung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten von Jansen, Mannhaupt, Marx & Sowronek
- VII. 2. 3 Andere Diagnoseverfahren
- IX. Förderprogramme zur Übung phonologischer Bewusstheit
- X. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Trainierbarkeit phonologischer Bewusstheit im Zusammenhang mit dem Schriftspracherwerb. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung phonologischer Bewusstheit für den Schriftspracherwerb und analysiert Ergebnisse verschiedener Studien zu diesem Thema. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der aktuellen Forschung zu diesem Thema zu geben und die Frage nach der Trainierbarkeit zu beantworten.
- Definition und Bedeutung phonologischer Bewusstheit
- Zusammenhang zwischen phonologischer Bewusstheit und Schriftspracherwerb
- Auswertung von Studien zur Trainierbarkeit phonologischer Bewusstheit
- Methoden zur Diagnose und Förderung phonologischer Bewusstheit
- Relevanz des Timings von Fördermaßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Fall eines Schülers mit Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben trotz normaler Intelligenz. Der Fall führt zur zentralen Forschungsfrage der Arbeit: Ist phonologische Bewusstheit trainierbar? Die Einleitung motiviert die weitere Untersuchung des Themas und skizziert den Aufbau der Arbeit.
II. Phonologische Bewusstheit im Rahmen der Sprachbewusstheit: Dieses Kapitel klärt den Begriff der phonologischen Bewusstheit und setzt ihn in den Kontext der Sprachbewusstheit. Es werden verschiedene Definitionen und Perspektiven auf den Begriff diskutiert und eine einheitliche Verwendung des Begriffs für die weitere Arbeit festgelegt. Der Zusammenhang zu metaphonologischer Bewusstheit wird erläutert.
III. Relevanz der phonologischen Bewusstheit: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung phonologischer Bewusstheit als Vorläuferfähigkeit für den Schriftspracherwerb. Es werden Entwicklungsaspekte und das phonologische Sprachverständnis bei Vorschulkindern diskutiert, um den Zusammenhang zwischen phonologischer Bewusstheit und Lese-Rechtschreibleistung zu verdeutlichen.
IV. Studie zur phonologischen Bewusstheit: Dieses Kapitel beschreibt eine empirische Studie zur Trainierbarkeit phonologischer Bewusstheit. Es werden der Versuchsplan, das Trainingsprogramm und die verwendeten Tests (Vor- und Nachtest, Metaphonologischer Transfertest, Lese- und Rechtschreibtest) detailliert dargestellt. Die Ergebnisse der Studie bezüglich unmittelbarer und langfristiger Trainingseffekte werden analysiert und zusammengefasst.
V. Weitere Studien: Dieses Kapitel fasst weitere relevante Studien zum Thema zusammen. Es werden die Ergebnisse und Methoden der jeweiligen Studien verglichen und in Bezug zur Hauptstudie gesetzt.
VI. Contra - Studien: Dieses Kapitel präsentiert Studien, die gegen die Trainierbarkeit phonologischer Bewusstheit argumentieren. Die Ergebnisse dieser Studien werden im Detail analysiert und kritisch bewertet, um einen ausgewogenen Überblick über den Forschungsstand zu gewährleisten.
VII. Zeitpunkt für das Training der phonologischen Bewusstheit: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage des optimalen Zeitpunkts für die Durchführung von Trainings zur phonologischen Bewusstheit. Es werden verschiedene Aspekte und deren Bedeutung für den Lernerfolg diskutiert.
VIII. Phonemanalytische Kompetenzen bei Schulbeginn: Dieses Kapitel befasst sich mit der Diagnose phonemanalytischer Kompetenzen zu Schulbeginn. Es werden verschiedene Verfahren wie "Der Rundgang durch Hörhausen" und das Bielefelder Screening (BISC) vorgestellt und ihre Anwendbarkeit diskutiert.
IX. Förderprogramme zur Übung phonologischer Bewusstheit: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Förderprogramme, die die Übung phonologischer Bewusstheit zum Ziel haben. Die Programme werden vorgestellt und hinsichtlich ihrer Methodik und Wirksamkeit analysiert.
Schlüsselwörter
Phonologische Bewusstheit, Schriftspracherwerb, Trainierbarkeit, Lese-Rechtschreibschwierigkeiten, Diagnose, Förderung, Studien, Metaphonologie, Phonemanalyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Trainierbarkeit Phonologischer Bewusstheit
Was ist der Hauptgegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Trainierbarkeit phonologischer Bewusstheit im Zusammenhang mit dem Schriftspracherwerb. Sie beleuchtet die Bedeutung phonologischer Bewusstheit für den Schriftspracherwerb und analysiert Ergebnisse verschiedener Studien zu diesem Thema. Das Ziel ist es, ein umfassendes Bild der aktuellen Forschung zu geben und die Frage nach der Trainierbarkeit zu beantworten.
Was versteht man unter phonologischer Bewusstheit?
Die Hausarbeit klärt den Begriff der phonologischen Bewusstheit und setzt ihn in den Kontext der Sprachbewusstheit. Es werden verschiedene Definitionen und Perspektiven diskutiert und eine einheitliche Verwendung für die weitere Arbeit festgelegt. Der Zusammenhang zu metaphonologischer Bewusstheit wird erläutert.
Welche Relevanz hat phonologische Bewusstheit für den Schriftspracherwerb?
Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung phonologischer Bewusstheit als Vorläuferfähigkeit für den Schriftspracherwerb. Entwicklungsaspekte und das phonologische Sprachverständnis bei Vorschulkindern werden diskutiert, um den Zusammenhang zwischen phonologischer Bewusstheit und Lese-Rechtschreibleistung zu verdeutlichen.
Welche Studien werden in der Arbeit analysiert?
Die Hausarbeit beschreibt eine eigene empirische Studie zur Trainierbarkeit phonologischer Bewusstheit (mit Versuchsplan, Trainingsprogramm und Tests: Vor- und Nachtest, Metaphonologischer Transfertest, Lese- und Rechtschreibtest). Zusätzlich werden weitere relevante Studien zusammengefasst, deren Ergebnisse und Methoden verglichen und im Bezug zur Hauptstudie gesetzt. Auch Studien, die gegen die Trainierbarkeit argumentieren ("Contra-Studien"), werden präsentiert und kritisch bewertet.
Welche Ergebnisse liefert die empirische Studie?
Die Ergebnisse der empirischen Studie bezüglich unmittelbarer und langfristiger Trainingseffekte (Nachtest, Metaphonologischer Transfertest, Lese- und Rechtschreibtest) werden detailliert analysiert und zusammengefasst.
Wann ist der optimale Zeitpunkt für ein Training der phonologischen Bewusstheit?
Die Arbeit befasst sich mit der Frage des optimalen Zeitpunkts für Trainings zur phonologischen Bewusstheit. Verschiedene Aspekte und deren Bedeutung für den Lernerfolg werden diskutiert.
Welche Diagnoseverfahren für phonemanalytische Kompetenzen werden vorgestellt?
Die Hausarbeit stellt verschiedene Verfahren zur Diagnose phonemanalytischer Kompetenzen zu Schulbeginn vor, darunter "Der Rundgang durch Hörhausen" und das Bielefelder Screening (BISC). Ihre Anwendbarkeit wird diskutiert.
Welche Förderprogramme zur Übung phonologischer Bewusstheit werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Förderprogramme zur Übung phonologischer Bewusstheit. Die Programme werden vorgestellt und hinsichtlich ihrer Methodik und Wirksamkeit analysiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Phonologische Bewusstheit, Schriftspracherwerb, Trainierbarkeit, Lese-Rechtschreibschwierigkeiten, Diagnose, Förderung, Studien, Metaphonologie, Phonemanalyse.
- Quote paper
- Lilli Fröse (Author), 2008, Schriftspracherwerb - Ist phonologische Bewusstheit trainierbar?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/149545