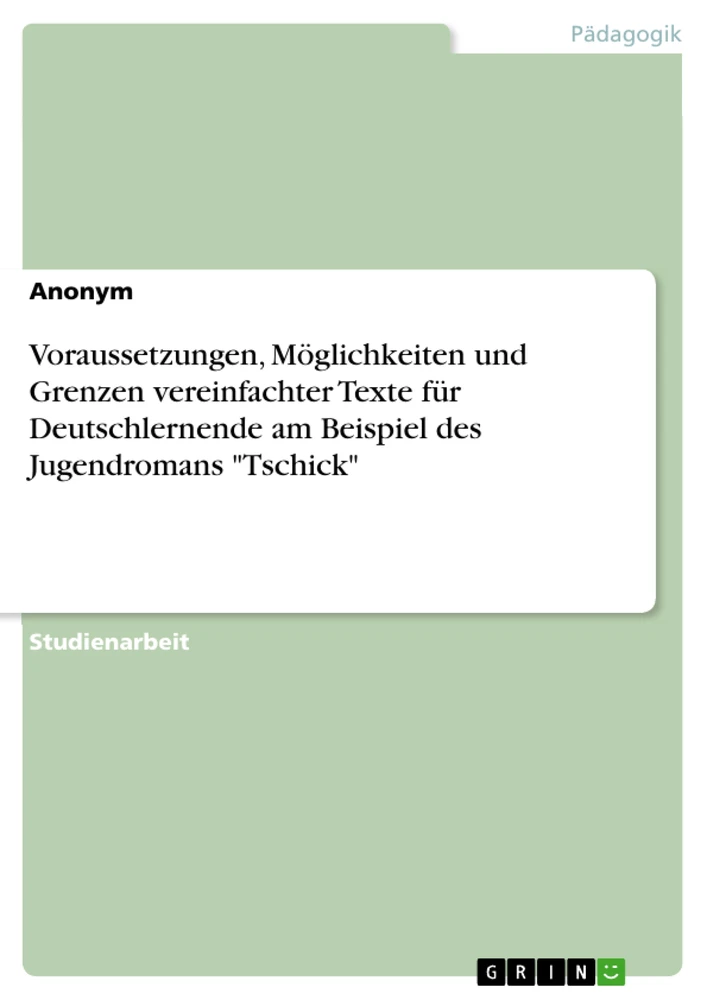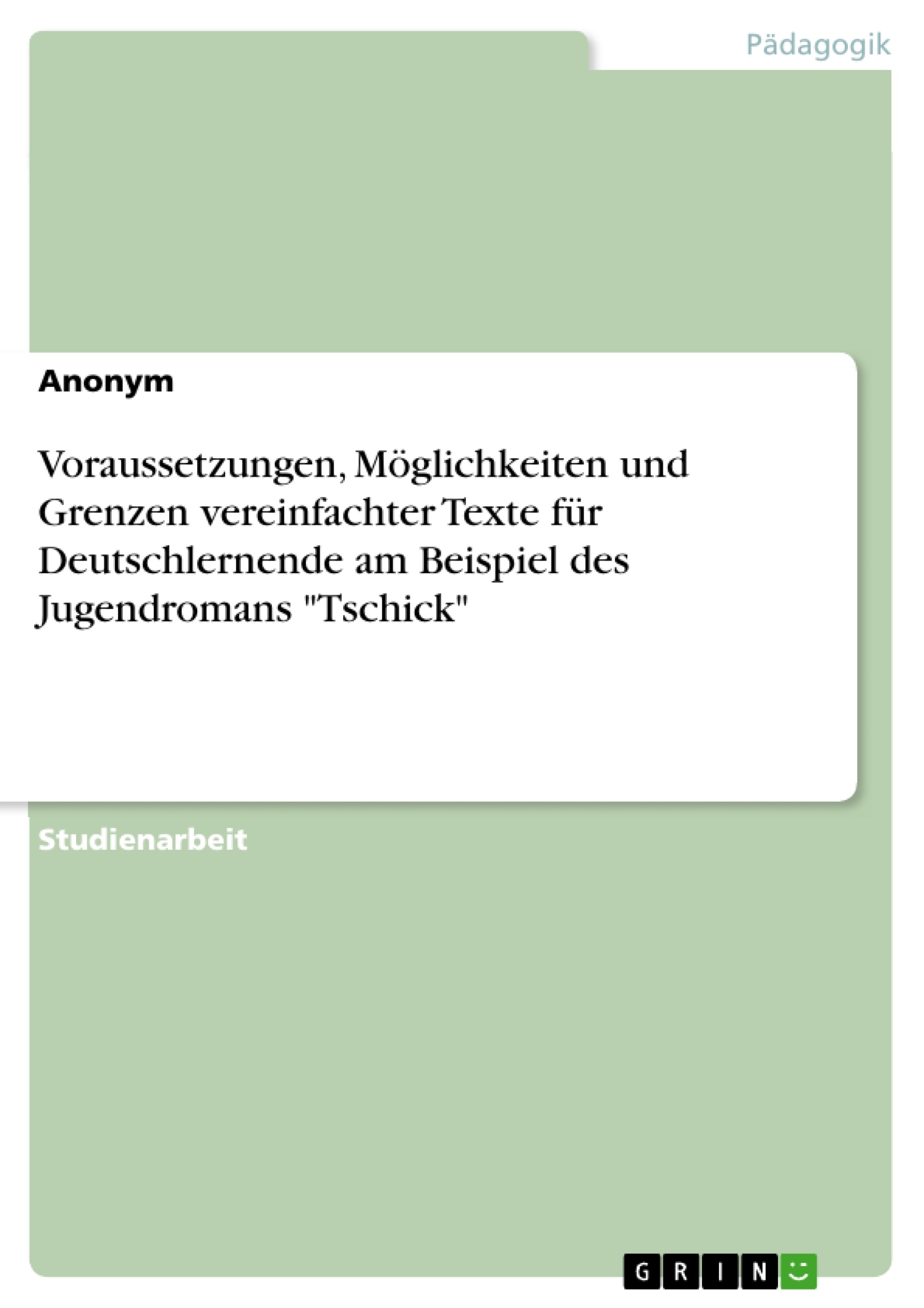Mit dem wachsenden Einfluss von Inklusion in der Gesellschaft und bildungspolitischen Diskursen erhalten Sprachvereinfachungskonzepte wie "Leichte" oder "Einfache Sprache" eine zunehmende öffentliche Aufmerksamkeit. Parallel dazu betonen die Ergebnisse der aktuellen PISA-Studie die Herausforderungen, denen jugendliche Zuwanderer und Deutschlernende gegenüberstehen: Aufgrund unzureichender Deutschkenntnisse verlieren sie den Anschluss im Bildungssystem und geraten an den Rand der schulischen Entwicklung. In diesem Kontext adressiert vereinfachte Sprache gezielt diese Teilgruppe, um eine spezifische sprachliche Förderung anzubieten. Daher widmete sich die vorliegende Studie der Frage, inwieweit die Anwendung vereinfachter Sprache das Textverständnis von Deutschlernenden fördern kann. Hierzu wurde Wolfgang Herrndorfs mittlerweile kanonisierter Jugendbuchklassiker "Tschick" als exemplarisches Beispiel herangezogen und mit seiner Adaption in Einfacher Sprache auf formaler, sprachlicher und inhaltlicher Ebene verglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sprachkonzeption: Leichte und Einfache Sprache
- Rechtliche Grundlagen, Entwicklung und historischer Hintergrund
- Zielgruppen und Funktionen von vereinfachter Sprache
- Regelwerke, Merkmale und Kriterien vereinfachter Sprache
- Vergleichende Analyse des Romans Tschick als Originaltext und in vereinfachter Sprache
- Typografische Analyse
- Sprachliche Analyse
- Schlussdiskussion: Potenzial und Grenzen von vereinfachten Texten für Deutschlernende
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wirksamkeit von vereinfachter Sprache im Kontext der Sprachförderung von Deutschlernenden. Der Schwerpunkt liegt auf der vergleichenden Analyse des Jugendromans "Tschick" in seiner Originalfassung und seiner Übersetzung in vereinfachte Sprache. Ziel ist es, das Potenzial und die Grenzen von vereinfachten Texten für die Verbesserung des Textverständnisses bei Deutschlernenden zu beurteilen.
- Rechtliche Grundlagen und Entwicklung von Leichter und Einfacher Sprache
- Zielgruppen und Funktionen der Sprachvereinfachung
- Merkmale und Kriterien vereinfachter Sprache
- Vergleichende Analyse der typografischen, sprachlichen und inhaltlichen Unterschiede zwischen Originaltext und vereinfachter Version
- Diskussion über die Effektivität von vereinfachter Sprache für Deutschlernende
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Ausgangssituation dar, indem sie auf die aktuellen Ergebnisse der PISA-Studie 2022 in Deutschland Bezug nimmt und die wachsende Bedeutung der Sprachförderung für Deutschlernende im schulischen Kontext beleuchtet. Die Arbeit zielt darauf ab, die Rolle von vereinfachter Sprache in der Sprachförderung zu untersuchen, wobei der Jugendroman "Tschick" als Beispiel dient.
Sprachkonzeption: Leichte und Einfache Sprache
Rechtliche Grundlagen, Entwicklung und historischer Hintergrund
Dieser Abschnitt beleuchtet die Ursprünge und Entwicklung der Konzepte "Leichte Sprache" und "Einfache Sprache" sowie ihre rechtlichen Grundlagen. Es werden die Entstehung der People-First-Bewegung und die Bedeutung der UN-Behindertenrechtskonvention für die Verbreitung von Leichter Sprache hervorgehoben.
Zielgruppen und Funktionen von vereinfachter Sprache
Der Abschnitt beschreibt die Zielgruppen von vereinfachter Sprache und ihre verschiedenen Funktionen. Es werden sowohl Menschen mit Lern-Schwierigkeiten als auch Personen, die nicht so gut lesen oder Deutsch sprechen können, als Zielgruppen definiert.
Regelwerke, Merkmale und Kriterien vereinfachter Sprache
Dieser Abschnitt befasst sich mit den Regeln, Merkmalen und Kriterien, die bei der Erstellung von vereinfachten Texten berücksichtigt werden. Es werden die sprachlichen und inhaltlichen Anpassungen, die vereinfachte Sprache kennzeichnen, näher beleuchtet.
Vergleichende Analyse des Romans Tschick als Originaltext und in vereinfachter Sprache
Typografische Analyse
Dieser Abschnitt analysiert die typografischen Unterschiede zwischen dem Originaltext und seiner vereinfachten Version. Es werden Aspekte wie Schriftart, Zeilenlänge und Satzbau untersucht, um die Unterschiede in der visuellen Präsentation beider Texte aufzuzeigen.
Sprachliche Analyse
Dieser Abschnitt befasst sich mit der sprachlichen Analyse der beiden Texte. Es werden die Unterschiede in Wortschatz, Satzbau, Grammatik und Syntax analysiert, um die Unterschiede in der Komplexität und Verständlichkeit der beiden Texte zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Leichte Sprache, Einfache Sprache, Sprachvereinfachung, Deutschlernende, Textverständnis, Sprachförderung, Jugendroman, "Tschick", Vergleichende Analyse, Typografie, Sprache, Inhalt, Potenzial, Grenzen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2024, Voraussetzungen, Möglichkeiten und Grenzen vereinfachter Texte für Deutschlernende am Beispiel des Jugendromans "Tschick", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1491837