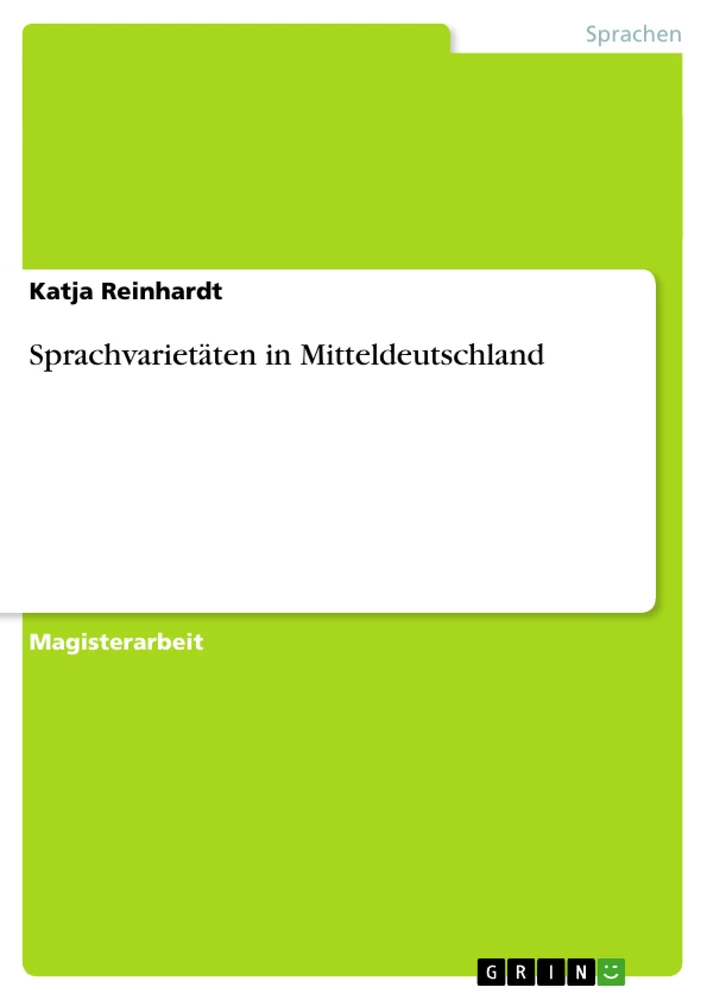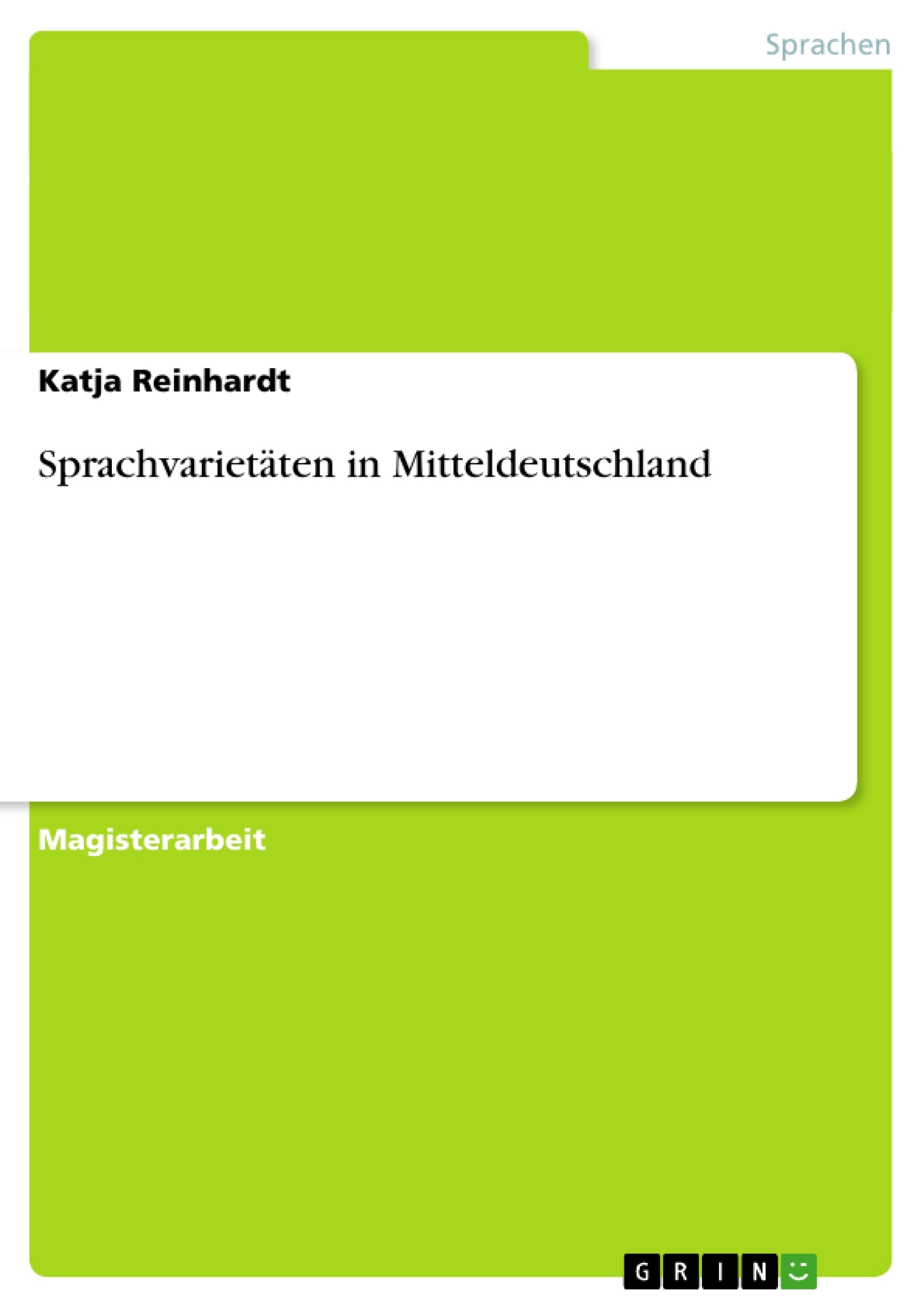In meiner vorliegenden Magisterarbeit „Sprachvarietäten in Mitteldeutschland“
beschäftige ich mich mit verschiedenen Sprachvarietäten in Mitteldeutschland,
wobei ich besonders auf das Niederdeutsche und das Ruhrdeutsche eingehen
werde.
Ich habe dieses Thema gewählt, weil ich selber aus der Region des
Ruhrgebietes stamme und ich mich schon immer für die Sprachvarietät
interessiert habe.
Zunächst werde ich einen kurzen Überblick über die Besonderheiten der
Sprache des Ruhrgebietes geben. Außerdem werde ich ausgewählte
Unterschiede des Ruhrdeutschen zum Niederdeutschen sowie Hochdeutschen,
mithilfe eines standardisierten Fragebogens herausarbeiten. Weiterhin möchte
ich mithilfe des Fragebogens herausfinden, inwieweit sich die Ruhrsprache
innerhalb ihrer eigenständigen Varietät in den letzten Jahrzehnten verändert
hat.
Zunächst folgt ein kurzer Einblick in die Region an der Ruhr mit Beispielen aus
der Geographie, Wirtschaft und Gesellschaft.
Inhaltsverzeichnis
- Überblick
- Vorwort
- Teil I:
- 1. Einleitung: Geographische, gesellschaftliche und linguistische Einteilung des Ruhrgebietes
- 1.A Geographische Einteilung des Sprachraumes Ruhrgebiet:
- 1.B Soziale und gesellschaftliche Einordnung des Ruhrdeutschen:
- 1.C Entwicklung der Sprache des Ruhrgebietes:
- 1.D Warum die Sprache der Ruhr noch keiner einstimmigen Definition unterliegt
- 2. Die Suche nach einer passenden Bezeichnung für die Ruhrvarietät
- 3. Exkurs:
- 3.A Definition Standardsprache:
- 3.B Definition Umgangssprache:
- 3.C Definition Dialekt:
- 3.D Definition Regiolekt:
- 3.E Definition Substandard:
- 4. Regionale Varietät des Ruhrgebietes – Was ist eigentlich Ruhrdeutsch? Regionale Umgangssprache, Dialekt, Regiolekt oder Substandard?
- 4.A Um welchen Sprachtyp handelt es sich beim Ruhrdeutschen?
- 4.B Das Ruhrdeutsche lässt sich als Umgangssprache der Region Ruhr einordnen
- 4.C Das Ruhrdeutsche ist ein Substandard
- 5. Die Einordnung des Ruhrdeutschen: Linguistische Charakteristika
- 5.A Die Studie von Arend Mihm: Merkmale der Ruhrsprache, die auch in anderen Regionen Deutschlands auftauchen, sowie ruhrgebietsspezifische Merkmale
- 5.B Kurzbeschreibung auf allen relevanten systemlinguistischen Ebenen:
- 5.b.1 Besondere Merkmale in der Lexik
- 5.b.2 Besondere Merkmale in der Morphologie
- 5.b.3 Besondere Merkmale in der Phonetik
- 5.b.4 Besondere Merkmale in der Syntax
- 5.C Einflüsse anderer Sprachen (Kontaktsituation)
- 5.c.1 Einflüsse aus dem Niederdeutschen nach Studien von Arend Mihm
- 5.c.2 Lexikalische Einflüsse aus dem Polnischen:
- 5.c.3 Einflüsse auf die Lexik und Morpholgie aus dem Jiddischen
- 5.c.4 Einflüsse aus den Migrantensprachen und der Jugendsprache:
- Teil II:
- 1. Das Ruhrgebietsdeutsch
- 1.1 Zur Datenerhebung
- 1.1 a Vorbereitung
- 1.2 Die empirische Untersuchung
- 1.2 a Der standardisierte Fragebogen
- 1.2.b Beschreibung der Aufgaben:
- 1.3 Ergebnissicherung der Befragung: Tabelle
- 2. Analyse der Sätze und Vergleich ausgewählter linguistischer Merkmale des Ruhrdeutschen mit dem Standarddeutschen und dem Niederdeutschen
- Geographische und soziale Einordnung des Ruhrdeutschen
- Linguistische Charakteristika des Ruhrdeutschen (Phonetik, Morphologie, Syntax, Lexik)
- Einfluss des Niederdeutschen auf das Ruhrdeutsche
- Einfluss anderer Sprachen (Polnisch, Jiddisch, Migrantensprachen, Jugendsprache)
- Empirische Untersuchung der heutigen Verwendung des Ruhrdeutschen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Sprachvarietät des Ruhrgebietes, ihre linguistischen Merkmale und Einordnung im Kontext anderer deutscher Sprachformen. Sie analysiert die Entwicklung des Ruhrdeutschen, seine Beziehungen zum Niederdeutschen und Standarddeutschen, und den Einfluss anderer Sprachen. Die Arbeit zielt auf eine detaillierte Beschreibung der Varietät und eine Klärung ihrer linguistischen Klassifizierung ab.
Zusammenfassung der Kapitel
Überblick: Diese Arbeit befasst sich mit Sprachvarietäten in Mitteldeutschland, insbesondere dem Niederdeutschen und Ruhrdeutschen. Es wird ein Überblick über die Besonderheiten des Ruhrdeutschen gegeben, und ausgewählte Unterschiede zu anderen Varietäten mithilfe eines standardisierten Fragebogens herausgearbeitet. Die Arbeit untersucht auch die Veränderungen der Ruhrsprache in den letzten Jahrzehnten.
Vorwort: Das Vorwort skizziert das Ruhrgebiet und seine stereotypen Bilder, um dann die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der regionalen Sprachvarietät zu begründen. Es betont die Bedeutung wissenschaftlicher Forschung im Ruhrgebiet und die Notwendigkeit, Vorurteilen über die Region entgegenzuwirken.
Teil I, Kapitel 1: Dieses Kapitel bietet eine Einführung in das Ruhrgebiet, indem es geographische, soziale und linguistische Aspekte beschreibt. Es definiert den Sprachraum und erläutert die soziale und gesellschaftliche Einordnung des Ruhrdeutschen, einschließlich seiner historischen Entwicklung und der Gründe für die fehlende eindeutige Definition.
Teil I, Kapitel 2: Dieses Kapitel befasst sich mit der Schwierigkeit, eine passende Bezeichnung für die Ruhrvarietät zu finden und erläutert die verschiedenen Bezeichnungen, die im Laufe der Zeit verwendet wurden.
Teil I, Kapitel 3: Kapitel 3 dient als Exkurs, in dem die Begriffe Standardsprache, Umgangssprache, Dialekt, Regiolekt und Substandard definiert werden, um eine Grundlage für die Einordnung des Ruhrdeutschen zu schaffen.
Teil I, Kapitel 4: In diesem Kapitel wird die Frage nach der linguistischen Einordnung des Ruhrdeutschen diskutiert. Es werden Argumente für eine Einordnung als regionale Umgangssprache, Regiolekt und Substandard präsentiert, wobei letztlich die Einordnung als Substandard mit niederdeutschen Substrat bevorzugt wird.
Teil I, Kapitel 5: Dieses Kapitel beschreibt die linguistischen Charakteristika des Ruhrdeutschen auf den Ebenen der Lexik, Morphologie, Phonetik und Syntax anhand eines literarischen Beispiels. Es analysiert den Einfluss anderer Sprachen wie Niederdeutsch, Polnisch und Jiddisch.
Teil II, Kapitel 1: Dieses Kapitel beschreibt die empirische Untersuchung, die mit einem standardisierten Fragebogen durchgeführt wurde, um die Merkmale des Ruhrdeutschen bei der heutigen Generation zu untersuchen. Es beschreibt die Vorbereitung, die Durchführung und die Stichprobe der Untersuchung.
Teil II, Kapitel 2: Dieses Kapitel analysiert die Ergebnisse des Fragebogens und vergleicht die linguistischen Merkmale des Ruhrdeutschen mit denen des Standarddeutschen und des Niederdeutschen. Es diskutiert die Ergebnisse im Kontext der vorherigen Kapitel und zieht Schlussfolgerungen über die Entwicklung und den aktuellen Status des Ruhrdeutschen.
Schlüsselwörter
Ruhrdeutsch, Sprachvarietät, Substandard, Niederdeutsch, Standarddeutsch, Soziolekt, Linguistik, Morphologie, Syntax, Lexik, Phonetik, Feldforschung, Fragebogen, Diglossie, Kontaktsprache, Polnisch, Jiddisch, Migrantensprachen, Jugendsprache.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: "Das Ruhrdeutsche"
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Sprachvarietät des Ruhrgebietes, das Ruhrdeutsche. Sie analysiert dessen linguistische Merkmale, Einordnung im Kontext anderer deutscher Sprachformen (Standarddeutsch, Niederdeutsch), Entwicklung, und den Einfluss anderer Sprachen (Polnisch, Jiddisch, Migrantensprachen, Jugendsprache).
Welche linguistischen Ebenen werden in der Analyse des Ruhrdeutschen betrachtet?
Die Arbeit betrachtet das Ruhrdeutsche auf den Ebenen der Phonetik, Morphologie, Syntax und Lexik. Es werden sowohl ruhrgebietsspezifische Merkmale als auch Merkmale, die auch in anderen Regionen Deutschlands vorkommen, beschrieben.
Welche anderen Sprachen haben das Ruhrdeutsche beeinflusst?
Der Einfluss des Niederdeutschen ist ein zentraler Punkt der Analyse. Zusätzlich werden Einflüsse aus dem Polnischen, Jiddisch, Migrantensprachen und der Jugendsprache untersucht.
Wie wird das Ruhrdeutsche linguistisch eingeordnet?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Einordnungen des Ruhrdeutschen (regionale Umgangssprache, Regiolekt, Substandard). Letztendlich wird eine Einordnung als Substandard mit niederdeutschen Substrat bevorzugt.
Welche Methode wurde zur Datenerhebung verwendet?
Es wurde eine empirische Untersuchung mit einem standardisierten Fragebogen durchgeführt, um die Merkmale des heutigen Ruhrdeutschen zu untersuchen. Die Ergebnisse werden mit dem Standarddeutschen und dem Niederdeutschen verglichen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile. Teil I umfasst eine Einführung in das Ruhrgebiet (geographisch, sozial, linguistisch), die Definition verschiedener Sprachtypen (Standardsprache, Umgangssprache, Dialekt, Regiolekt, Substandard) und die linguistische Beschreibung des Ruhrdeutschen. Teil II beschreibt die empirische Untersuchung (Fragebogen, Datenerhebung, -auswertung) und den Vergleich der Ergebnisse mit dem Standarddeutschen und dem Niederdeutschen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ruhrdeutsch, Sprachvarietät, Substandard, Niederdeutsch, Standarddeutsch, Soziolekt, Linguistik, Morphologie, Syntax, Lexik, Phonetik, Feldforschung, Fragebogen, Diglossie, Kontaktsprache, Polnisch, Jiddisch, Migrantensprachen, Jugendsprache.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der Kapitel?
Die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die einen Überblick über die Inhalte jedes Kapitels bietet.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt auf eine detaillierte Beschreibung des Ruhrdeutschen und eine Klärung seiner linguistischen Klassifizierung ab. Sie untersucht die Entwicklung des Ruhrdeutschen, seine Beziehungen zum Niederdeutschen und Standarddeutschen, und den Einfluss anderer Sprachen.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für Leser gedacht, die sich für Sprachwissenschaft, insbesondere für regionale Sprachvarietäten in Deutschland, interessieren. Sie eignet sich für akademische Zwecke und die Analyse linguistischer Themen.
- Quote paper
- Katja Reinhardt (Author), 2010, Sprachvarietäten in Mitteldeutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/149107