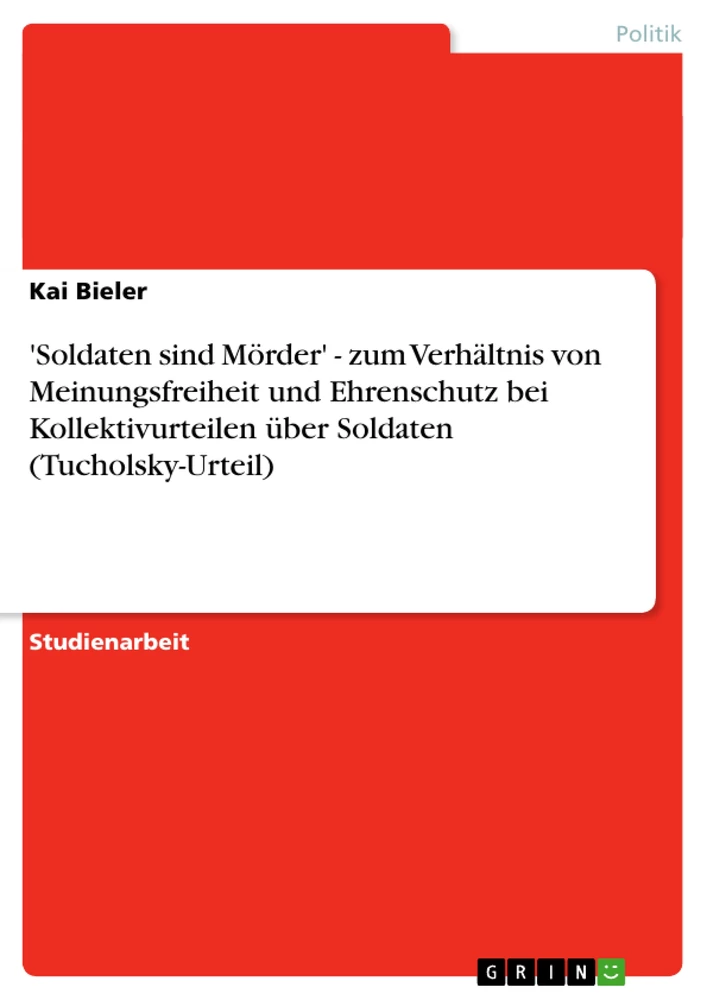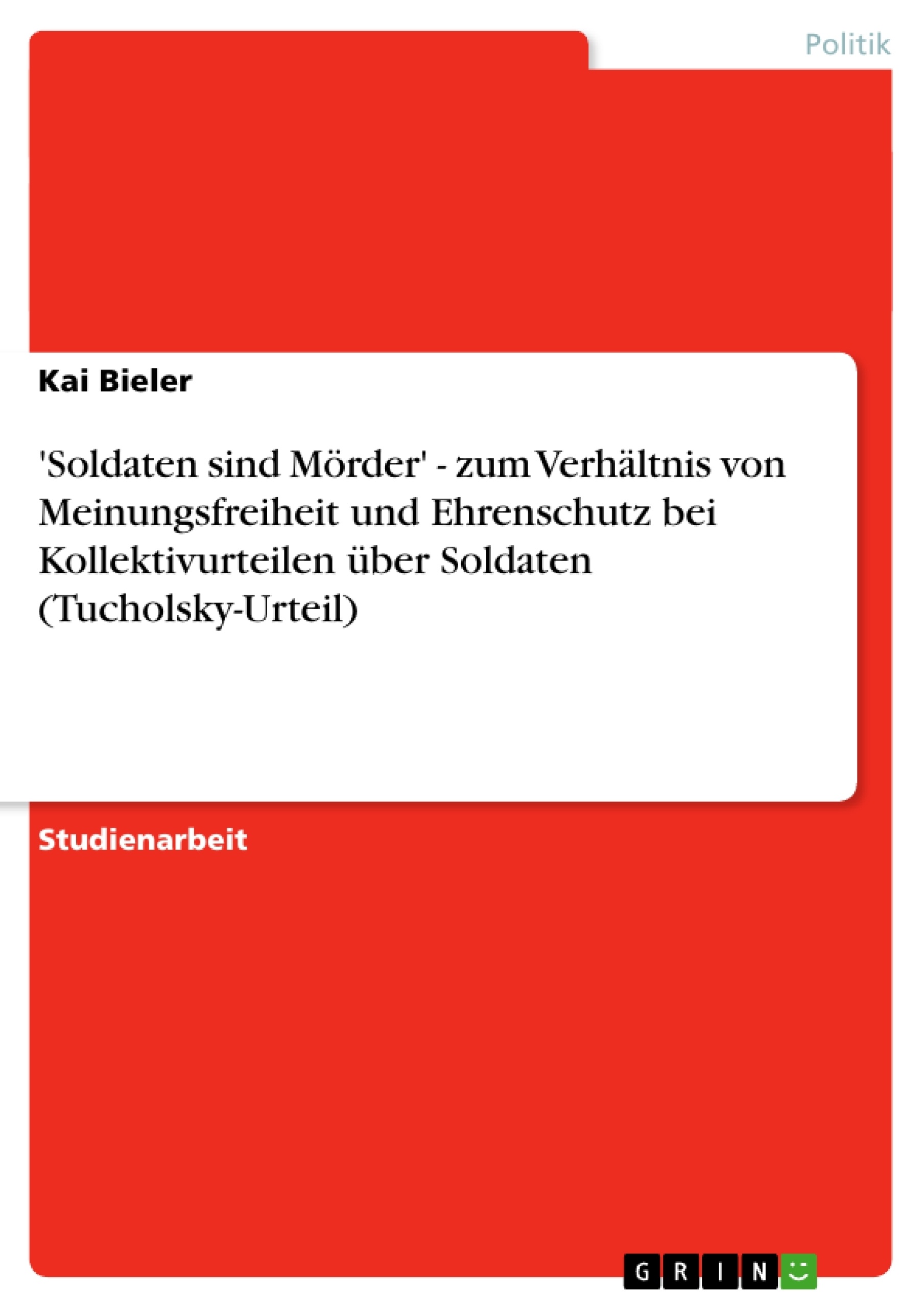Große Teile der deutschen Öffentlichkeit, die Politik und nicht zuletzt die Justiz beschäftigt der Umgang mit dem historischen Tucholsky-Zitat „Soldaten sind Mörder“ seit Jahrzehnten. Einen Höhepunkt erlebte die Diskussion als „Nebenkriegsschauplatz“ Anfang und Mitte der 90er Jahre. Grundlegend ging es dabei um die Frage nach den Implikationen der veränderten Sicherheitslage am Ende des Ost-West-Konflikts und daraus resultierend um die Rolle und das Selbstverständnis der Bundeswehr innerhalb der bundesdeutschen Demokratie. Beispielhaft seien dafür die bis heute andauernde Diskussion um die Notwendigkeit der Wehrpflicht und der Beginn der neuen Ära der „Landesverteidigung am Hindukusch“ mit den ersten Auslandseinsätzen deutscher Soldaten nach dem zweiten Weltkrieg genannt. In den Focus geriet dabei eine Institution, die seit 1951 zu den Grundpfeilern des politischen Systems der Bundesrepublik gehört: Das Bundesverfassungsgericht. Mit seinen Entscheidungen vom 25. August 1994 und vom 10. Oktober 1995 die unter den Schlagworten „Soldaten sind Mörder“ oder „Tucholsky-Urteil“ bekannt wurden, sorgte es für Aufsehen und monatelange Diskussionen.
Ziel dieser Arbeit ist es, rückblickend eine Chronologie der Ereignisse vorzunehmen. Dazu zählen der historische Entstehungszusammenhang des umstrittenen Zitats, die exemplarische Darlegung eines der verhandelten Fälle sowie die Reaktionen auf die Urteile. Im Mittelpunkt steht dabei eine Analyse der Kriterien und die ihnen zugrundliegende Abwägung der tangierten Grundrechtsnormen und Gesetze, welche das Bundesverfassungsgericht veranlassten, den Verfassungsbeschwerden stattzugeben. Dabei wird sich zeigen, dass die Urteile - entgegen des damals weitverbreiteten Eindrucks – nicht überraschend ausfielen, sondern sich in Übereinstimmung mit der Tradition der fortlaufenden Rechtssprechung des BVerfG befanden. Am Anfang der Arbeit steht jedoch eine Einführung in die politische und juristische Vorgeschichte der beiden Entscheidungen. Diese begann mehr als sechs Jahrzehnte zuvor in der Endphase der Weimarer Republik. Dies ist – über die reine Sachinformation hinaus - insofern sinnvoll, als sich bereits hier, im Jahre 1931 die grundlegenden Argumentationslinien in der Auseinandersetzung um das Zitat Kurt Tucholskys aufzeigen lassen.
Inhaltsverzeichnis
- Sind Soldaten Faxgeräte? - eine Einführung
- Mörder darf man sie nicht nennen
- Bewachter Kriegschauplatz – die publizistische und juristische Vorgeschichte
- Kleines Zitat mit großer Wirkung
- Erste Urteile und Antworten
- Bundesdeutsche Urteile seit 1984
- Kein Freispruch - Entscheidungen des BverfGG
- Kammerentscheidung vom 25. August 1994
- Eine Fallgeschichte
- Senatsbeschluss vom 10. Oktober 1995
- Schon 1958 alles gesagt - die Argumentation
- Lüth-Urteil und Wechselwirkungstheorie
- Was ist ein Mörder?
- Wer kann beleidigt werden?
- Enge Grenzen für Schmähkritik
- Die Urteilsformel
- Skandalurteil und Superrevisionsinstanz – juristische und politische Reaktionen
- Ehrenschutzgesetz gegen „Schandurteil“
- Kritisches Sondervotum
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das Verhältnis von Meinungsfreiheit und Ehrenschutz im Kontext des Tucholsky-Urteils, das sich mit der Aussage "Soldaten sind Mörder" befasst. Sie untersucht die juristische und politische Geschichte des Zitats, die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) und die Reaktionen auf diese Urteile.
- Die historische Entwicklung des Zitats "Soldaten sind Mörder"
- Die juristische Auseinandersetzung um die Meinungsfreiheit und den Ehrenschutz von Soldaten
- Die Rolle des BVerfG in der Abwägung von Grundrechten
- Die politische und gesellschaftliche Debatte um das Tucholsky-Urteil
- Die Bedeutung des Ehrenschutzes im Kontext von Kollektivurteilen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Einleitung des Themas mit einem satirischen Gedicht von Wiglaf Droste und stellt den historischen Kontext des Tucholsky-Zitats vor. Das zweite Kapitel erläutert die publizistische und juristische Vorgeschichte, beginnend mit der Veröffentlichung des Zitats in der „Weltbühne“ und den darauf folgenden Gerichtsverfahren. Es wird die Argumentation des Chefredakteurs Carl von Ossietzky in seiner Verteidigungsrede dargestellt, die bereits die Kernthemen des späteren BVerfG-Urteils aufgreift. Das dritte Kapitel beleuchtet die Entscheidungen des BVerfG im Jahr 1994 und 1995, die unter den Schlagworten „Soldaten sind Mörder“ oder „Tucholsky-Urteil“ bekannt wurden. Die Argumentation des Gerichts, die auf das Lüth-Urteil und die Wechselwirkungstheorie zurückgreift, wird detailliert erklärt. Das vierte Kapitel befasst sich mit den Reaktionen auf das Urteil, einschließlich der Kritik an der Entscheidung und der Diskussion um ein neues Ehrenschutzgesetz. Schließlich werden die wichtigsten Ergebnisse und die Relevanz der Arbeit zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Meinungsfreiheit, Ehrenschutz, Soldaten, Kollektivurteil, Tucholsky-Urteil, BVerfG, Lüth-Urteil, Wechselwirkungstheorie, Schmähkritik, Bundeswehr, Sicherheitslage, Auslandseinsätze, Grundrechte, Rechtssprechung.
- Quote paper
- Kai Bieler (Author), 2003, 'Soldaten sind Mörder' - zum Verhältnis von Meinungsfreiheit und Ehrenschutz bei Kollektivurteilen über Soldaten (Tucholsky-Urteil), Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/14844