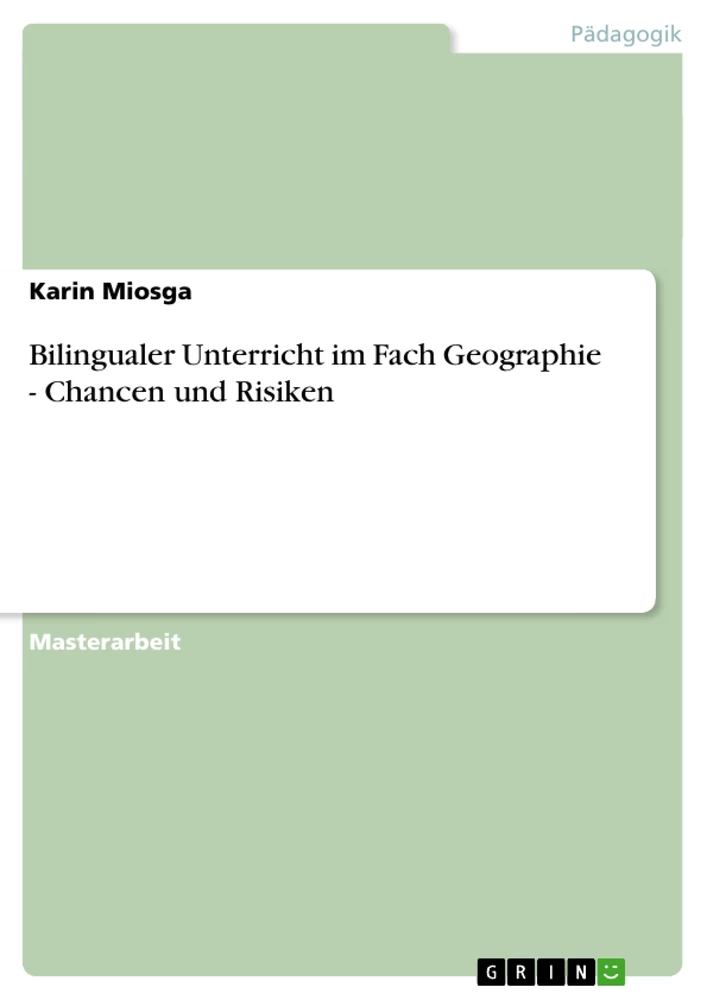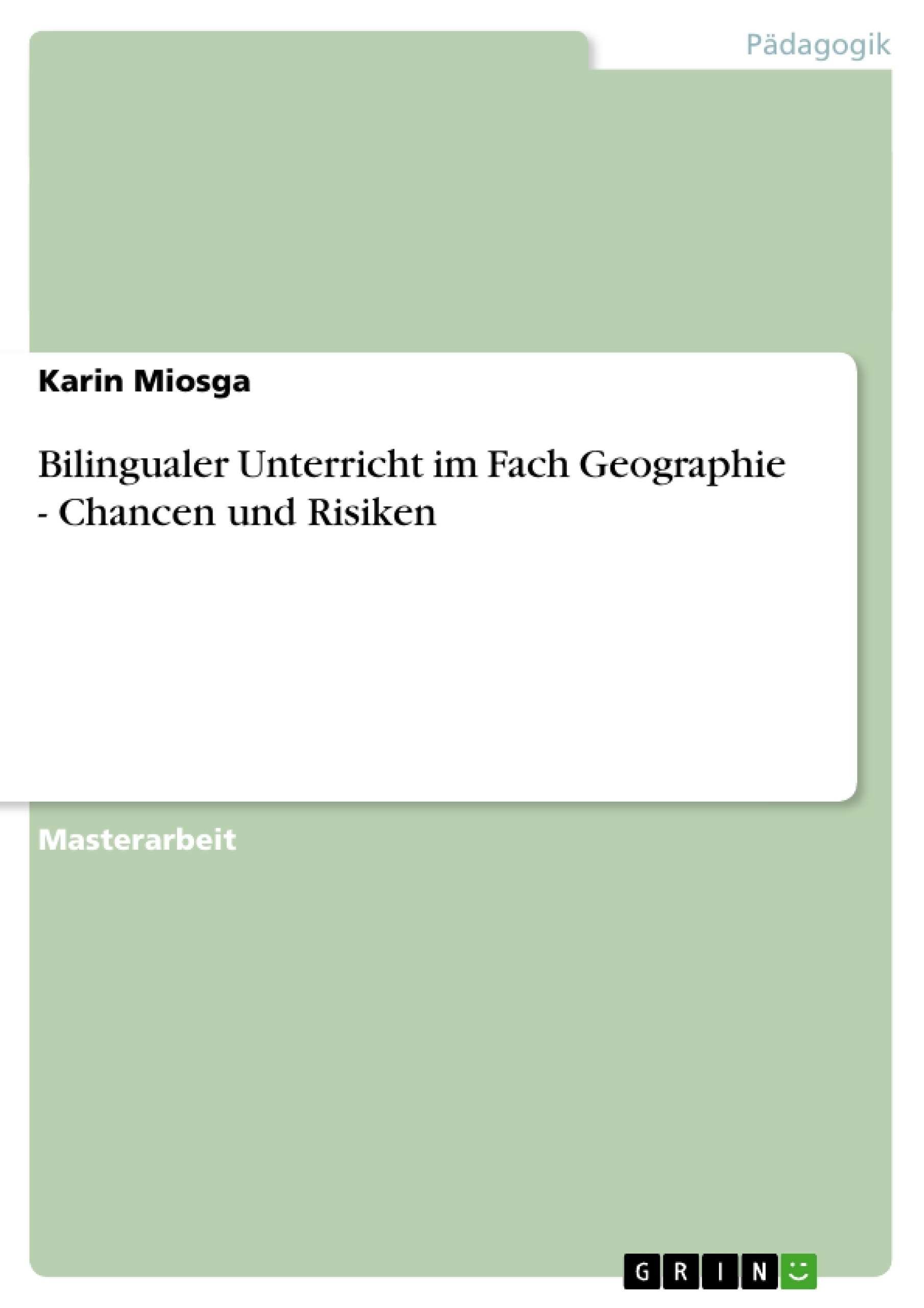1. Einleitung
Die Einführung des bilingualen Unterrichts an deutschen Schulen ist eine Erfolgsgeschichte, die bereits drei Jahrzehnte andauert. Nach der rasanten Entwicklung insbesondere in den vergangenen zehn Jahren steht heute fest, dass diese Unterrichtsform, in welcher die Fremdsprache als Arbeitssprache im Fachunterricht verwendet wird, keine reine Modeerscheinung ist, sondern eine dauerhafte Einrichtung in der deutschen Schullandschaft. Nur so kann sich der fremdsprachliche Unterricht an den Schulen in Bezug auf die Schüler als berufsqualifizierender Aspekt etablieren.
In der einen oder anderen Form wird der bilinguale Sachfachunterricht mittlerweile in allen Bundesländern angeboten. Die Zahl der Schulen wächst von Schuljahr zu Schuljahr und das Interesse der Fachdidaktik an bilingualem Unterricht ist so groß wie nie zuvor. Die Idee, die vor mehr als drei Jahrzehnten im Rahmen von deutsch-französischen Bildungsgängen geboren worden ist, findet bezogen auf die anderen Sprachen und unterschiedlichen Schulformen immer mehr Zuspruch.
Dabei beherrscht vor allem die Vielfalt die bilinguale „Szene“. In den ein-zelnen Bundesländern gibt es zum Teil sehr unterschiedliche Formen der Realisierung des zweisprachigen Unterrichts. Neben einer Konsolidierung bestehender Angebote waren die vergangen Jahre durch einen Trend zur Flexibilisierung bilingualen Unterrichts geprägt, welcher zu einer Ausweitung des Fächerangebots, aber auch zu variableren Organisationsstrukturen geführt hat.
Vor diesem Hintergrund stellt sich verstärkt die Frage nach dem konzepti-onellen Entwicklungsstand in Deutschland. Der unabdingbare interdisziplinäre Dialog hat begonnen und ist ungemein wichtig für das Bestehen des zweisprachigen Sachfachunterrichts. Eine umfassende Didaktik und Methodik des bilingualen Sachfachunterrichts liegt aber noch nicht vor – auch gerade deswegen nicht, weil es ein komplexes Unterfangen ist. Es bedarf des Miteinanders von Fremdsprachen- und Sachfachdidaktikern einerseits sowie von Theorie und bereits etablierten Strukturen der Unterrichtspraxis andererseits. Genau hier, an der Schnittstelle von Praxis und Theorie, versucht die Literatur verschiedene Beispiele aufzuzeigen, „wie die angestrebte Integration des fremdsprachlichen und sachfachlichen Lehrens und Lernens im einzelnen aussehen kann“ . [...]
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Einleitung
- 2. Content and Language Integrated Learning - Eckpunkte der Didaktik des bilingualen Sachfachunterrichts
- 2.1 Grundlagen
- 2.1.1 Einleitung
- 2.1.2 Begriffsbestimmung
- 2.1.3 Entwicklung bilingualer Angebote
- 2.2 Überlegungen zum bilingualen „Mehrwert“
- 2.2.1 Sprache
- 2.2.2 Inhalt
- 2.3 Elemente einer integrativen Didaktik und Methodik im bilingualen Sachfachunterricht
- 2.3.1 Tendenzen
- 2.3.2 Integration fachlichen und sprachlichen Lernens: Sechs Thesen
- 2.3.3 Planungsfelder für die Integration (fremd-)sprachlichen und fachlichen Lehrens und Lernens im bilingualen Sachfachunterricht
- 3. Bilingualer Geographieunterricht
- 3.1 Welche Fächer werden bilingual unterrichtet?
- 3.2 Geographie in einen bilingualen Curriculum
- 3.3 Ziele des bilingualen Geographieunterrichts
- 3.4 Didaktik des bilingualen Geographieunterrichts
- 3.5 Wann ist der Beginn des bilingualen Geographieunterrichts sinnvoll?
- 3.6 Fachrelevante Arbeitsweisen sowie Unterrichtsmaterialien
- 4. Beispiele für verschiedene Unterrichtseinheiten im bilingualen Geographieunterricht
- 4.1 „Settlement, Population and Cities in the USA“
- 4.2 „California here we come“ – Ein Beispiel für bilingualen Geographieunterricht als Frontalunterricht
- 5. Chancen und Risiken des bilingualen Geographieunterrichts
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit dem bilingualen Unterricht im Fach Geographie und untersucht dessen Chancen und Risiken. Sie soll die vielfältigen Möglichkeiten des bilingualen Unterrichts aufzeigen und dessen Mehrwert unterstreichen.
- Grundlagen und Entwicklung des bilingualen Unterrichts
- Didaktische Konzepte und Methoden im bilingualen Sachfachunterricht
- Spezifische Herausforderungen und Chancen des bilingualen Geographieunterrichts
- Beispiele für Unterrichtseinheiten im bilingualen Geographieunterricht
- Bewertung der Chancen und Risiken des bilingualen Geographieunterrichts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext und die Relevanz des Themas „Bilingualer Unterricht im Fach Geographie“ beleuchtet. Kapitel 2 stellt die Grundlagen des Content and Language Integrated Learning (CLIL) vor, beschreibt die Entwicklung bilingualer Angebote und diskutiert den Mehrwert dieser Unterrichtsform. Kapitel 3 fokussiert auf den bilingualen Geographieunterricht, beleuchtet die Ziele und die Didaktik dieser Unterrichtsform und untersucht die Frage, wann ein Beginn des bilingualen Geographieunterrichts sinnvoll ist. Kapitel 4 präsentiert Beispiele für verschiedene Unterrichtseinheiten im bilingualen Geographieunterricht, die die praktische Umsetzung des Konzepts verdeutlichen. Abschließend werden in Kapitel 5 die Chancen und Risiken des bilingualen Geographieunterrichts diskutiert.
Schlüsselwörter
Bilingualer Unterricht, Geographie, Content and Language Integrated Learning (CLIL), Didaktik, Methodik, Chancen, Risiken, Mehrwert, Sprachförderung, Fachlernen, Unterrichtsmaterialien, Unterrichtseinheiten, Praxisbeispiele.
- Quote paper
- Karin Miosga (Author), 2008, Bilingualer Unterricht im Fach Geographie - Chancen und Risiken, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/148154