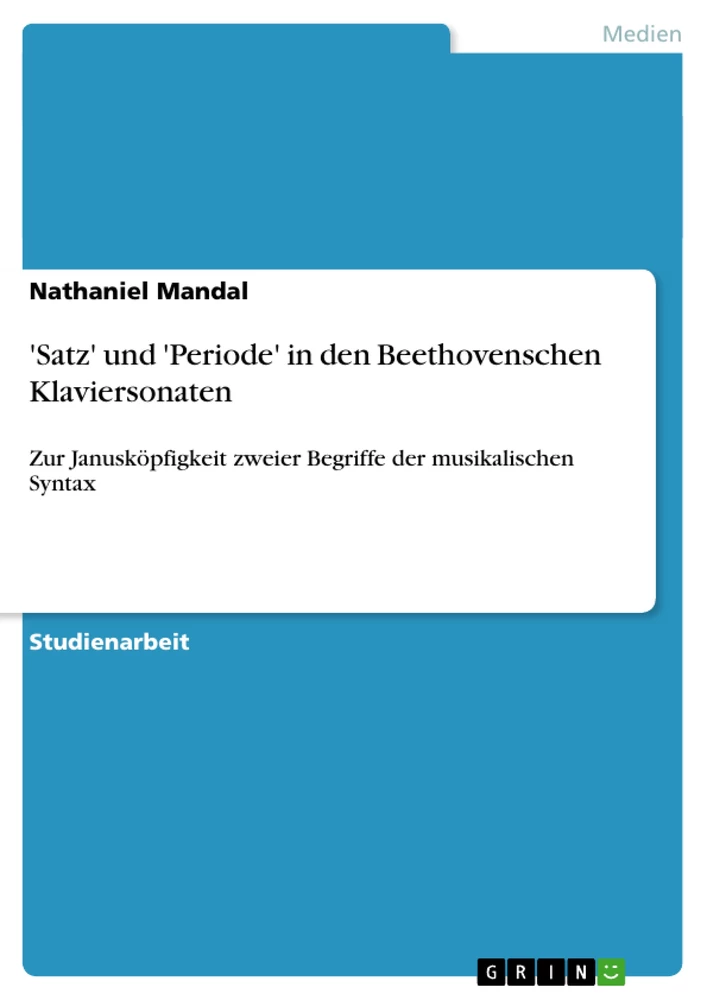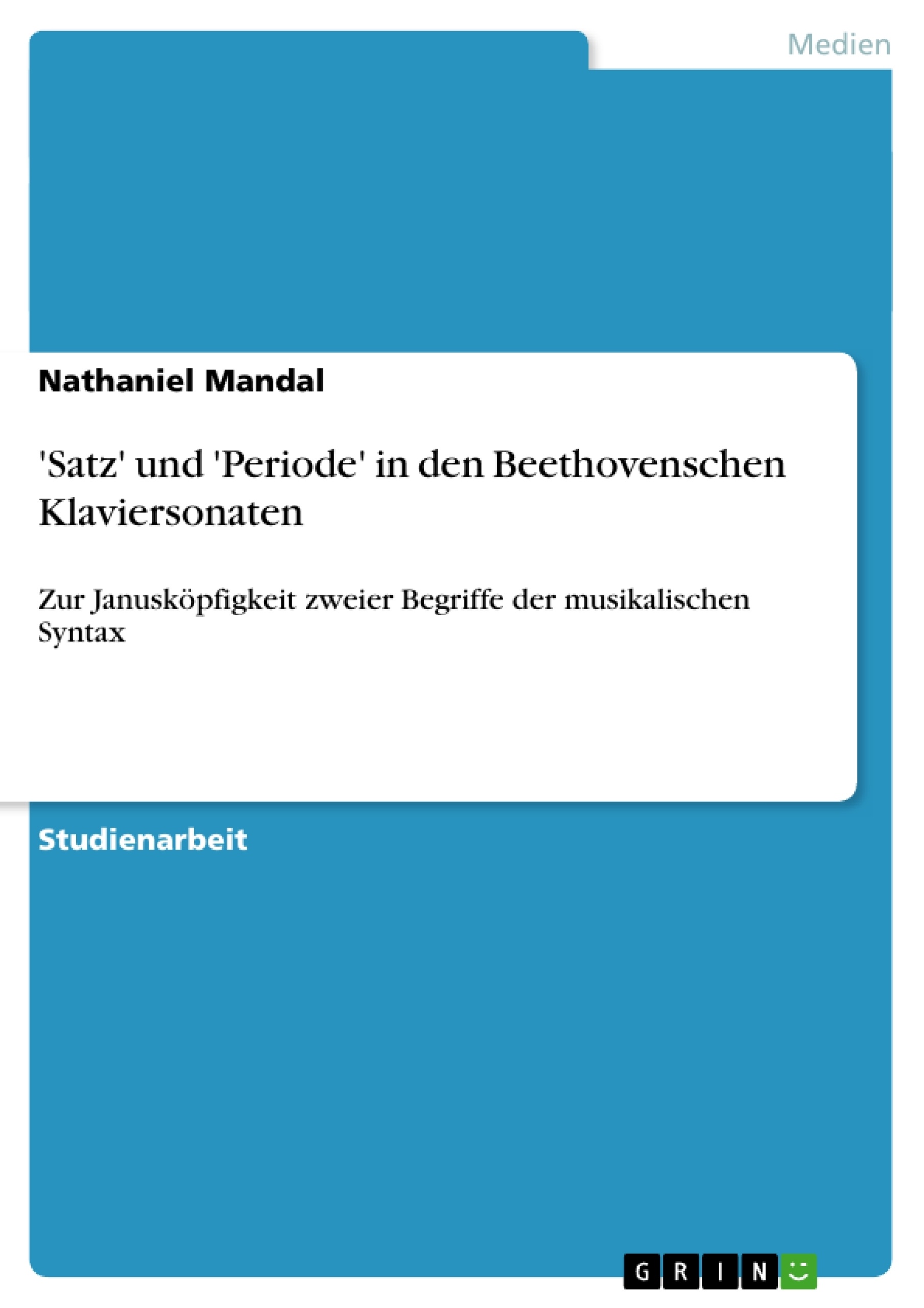„Für mich gibt’s kein größeres Vergnügen,
als meine Kunst zu treiben und zu zeigen.“
(Ludwig van Beethoven)
In dieser Arbeit will ich mich mit den beiden Termini Periode und Satz auseinandersetzen, welche beide wohl zu den grundlegendsten musikalischen Formprinzipien klassischer Musik gehören. Auf der Grundlage von Erwin Ratz Buch „Einführung in die musikalische Formenlehre“ will ich mich diesen Begriffen theoretisch nähern und sie anschließend anhand ausgewählter Beispiele aus den Beethovensonaten praktisch exemplifizieren. Im Zuge dieser Untersuchungen soll zum einen deutlich werden, von welch grundlegendem Stellenwert diese beiden Begriffe für klassische Kompositionen sind und zum anderen gezeigt werden, dass Ludwig van Beethoven mit seinen 32 Klaviersonaten einen Paradigmenwechsel in musikgeschichtlicher und vor allem kompositorischer Hinsicht eingeleitet hat, der sich besonders gut an diesen beiden Begriffen und ihrer Unterscheidung nachvollziehen lässt. Für dieses Vorhaben eignen sich die Beethovenschen Klaviersonaten deswegen so hervorragend , da „keine musikalische Gattung die Phänomenologie des Beethovenschen Sonatensatzes so deutlich, damit aber auch in seiner ganzen Vielfalt widerspiegelt, wie Beethovens Klaviersonaten.“
Bevor ich direkt in die Thematik einsteige und diese beiden wichtigen musikalischen Formprinzipien vor- und darstelle, möchte ich zu Beginn kurz auf einen Begriff eingehen, der mit der ‚Periode’ und dem ‚Satz’ eng verschränkt ist: dem Themenbegriff. Dies scheint mir insbesondere bei der Beschäftigung mit dem Beethovenschen Oeuvre äußerst angebracht, vielleicht sogar erforderlich; denn: „Der Weg der Beethoven-Analyse ist die Funktion ihrer Themenbestimmung.“
Inhaltsverzeichnis
- Satz und Periode
- Definition des Themenbegriffs bzw. Motivs nach Martin Wehnert
- ,Periode' und,Satz' in Erwin Ratz „Einführung in die musikalische Formenlehre“ - Diskussion
- I. Eindeutige Fälle
- II. Mehrdeutige Fälle
- Neues Verständnis von Satz und Periode
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Begriffen Periode und Satz, die zu den grundlegenden musikalischen Formprinzipien klassischer Musik gehören. Die Untersuchung basiert auf Erwin Ratz' Buch „Einführung in die musikalische Formenlehre“ und analysiert anhand ausgewählter Beispiele aus den Beethovensonaten die Anwendung dieser Prinzipien. Die Arbeit zeigt sowohl den Stellenwert der Begriffe für klassische Kompositionen auf als auch den Paradigmenwechsel, den Ludwig van Beethoven mit seinen 32 Klaviersonaten in musikgeschichtlicher und kompositorischer Hinsicht eingeleitet hat.
- Definition und Analyse der Begriffe Periode und Satz
- Anwendung dieser Begriffe auf die Beethovensonaten
- Der Einfluss von Beethoven auf die Entwicklung der musikalischen Form
- Die Bedeutung des Themenbegriffs für die Beethoven-Analyse
- Der Vergleich der Formprinzipien von Bach und Beethoven
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit dem Themenbegriff, der eng mit den Begriffen Periode und Satz verbunden ist. Er erläutert die Definition des Themenbegriffs nach Martin Wehnert und stellt die Bedeutung des Themas als konstitutiven Faktors in einer Komposition heraus. Der zweite Teil analysiert die Begriffe Periode und Satz nach Erwin Ratz. Er stellt die Definitionen beider Begriffe dar und untersucht ihre Anwendung auf die Beethovensonaten. Hierbei werden auch andere Autoren, die sich mit der Thematik Satz und Periode auseinandergesetzt haben, zitiert.
Schlüsselwörter
Periode, Satz, musikalische Syntax, Beethovensonaten, Themenbegriff, Erwin Ratz, klassische Musik, Form, Paradigmenwechsel, Bach, Mozart, Haydn.
- Quote paper
- Nathaniel Mandal (Author), 2009, 'Satz' und 'Periode' in den Beethovenschen Klaviersonaten, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/147914