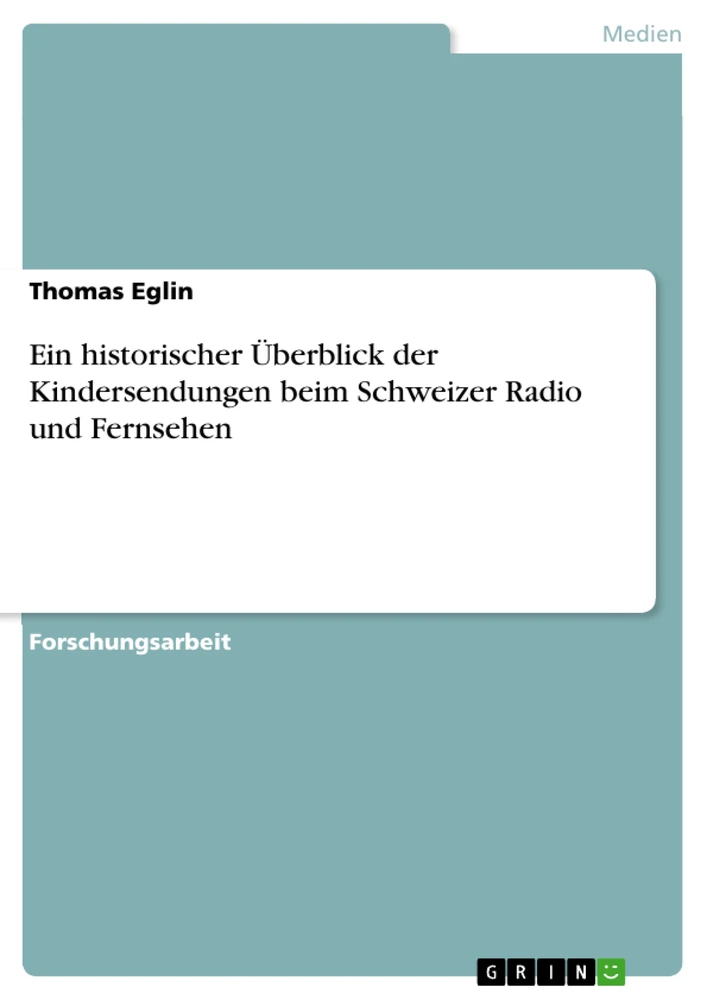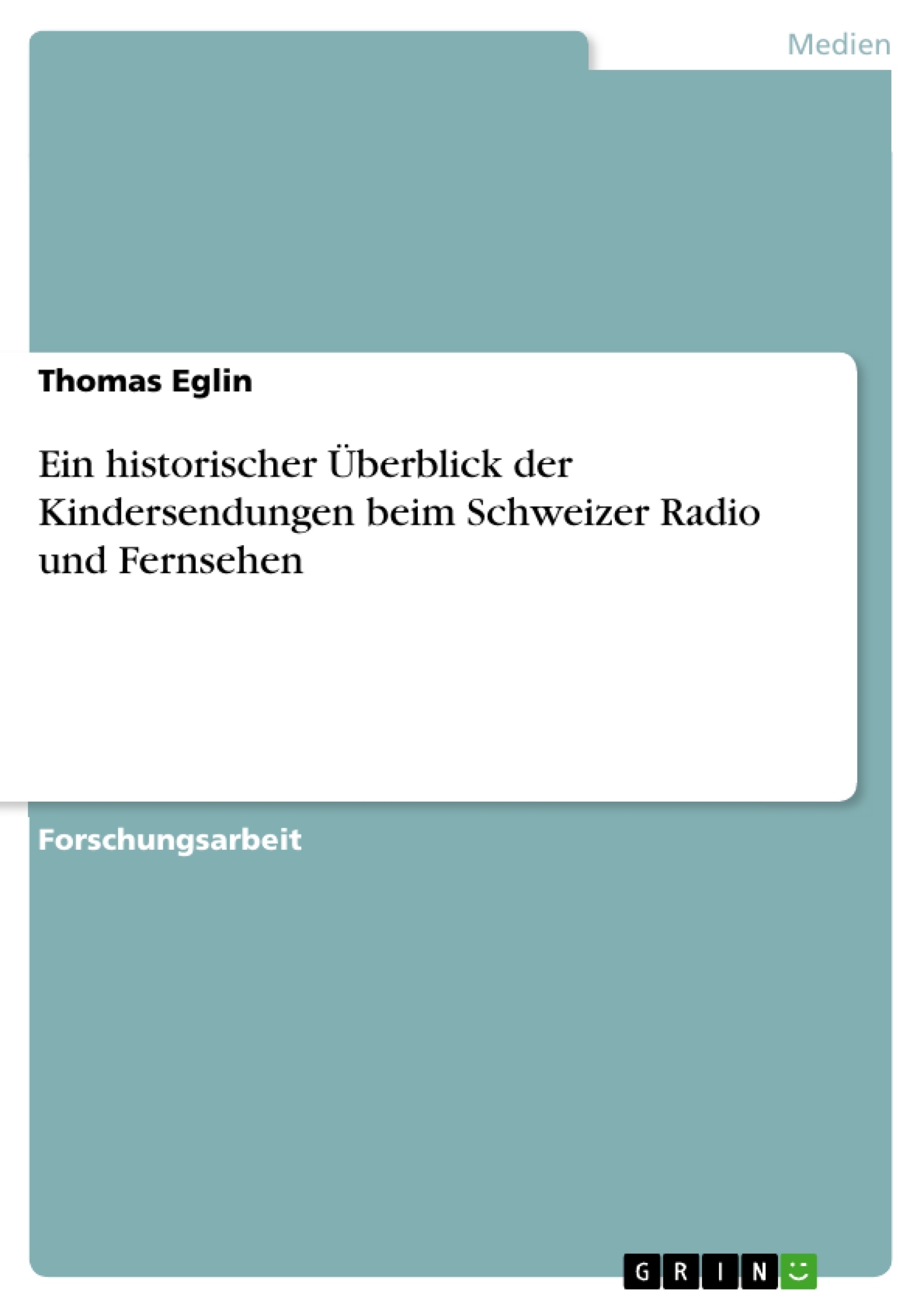Diese Forschungsarbeit, verfasst von Thomas Eglin im Frühjahrsemester 2020 an der Universität Luzern, bietet einen umfassenden historischen Überblick über die Kindersendungen des Schweizer Radios und Fernsehens (SRF). Eingereicht im Rahmen des Seminars „Ein Volk von Zeitungslesern?“, untersucht die Arbeit die Entwicklung und Vielfalt der Kindersendungen von 1931 bis zur Gegenwart.
Die Analyse beginnt mit einer theoretischen Einführung in die Systemtheorie von Niklas Luhmann, um die strukturelle Einbettung der Massenmedien zu verstehen. Es folgt eine detaillierte Darstellung der verschiedenen Formate, die über die Jahrzehnte ausgestrahlt wurden, einschließlich der „Kinderstunde“, „Jugendstunde“, „Buben- und Mädchenstunde“, „Kindernachrichtendienst“ und „Bettmümpfeli“. Besonders hervorgehoben werden neuere Formate wie „Treffpunkt Welle 2“, „Kinderclub“, „Looping“, „SiggSaggSugg“, „Pirando“ und die aktuelle Sendung „Zambo“.
Die Arbeit untersucht die Sendezeiten, Sendeplätze und inhaltlichen Schwerpunkte der einzelnen Programme und zeigt, wie sich diese im Laufe der Zeit verändert haben. Ein zentrales Thema ist die aktive Einbeziehung der Kinder in die Gestaltung der Sendungen, sei es durch Mitwirken als Kinderreporter oder durch das Einbringen von Musikwünschen und Geschichten.
Die Untersuchung basiert auf einer Vielzahl von Quellen, darunter Programmzeitschriften, Geschäftsberichte, Zeitungsartikel und direkte Gespräche mit Mitarbeitenden des SRF. Die Arbeit verdeutlicht, dass die Kindersendungen nicht nur ein fester Bestandteil der Schweizer Radiokultur sind, sondern auch ein wichtiges Instrument zur Förderung von Wissen, Kreativität und sozialem Engagement bei Kindern.
Im Fazit wird die Bedeutung der Kindersendungen für die SRF und ihre kontinuierliche Anpassung an gesellschaftliche und technische Veränderungen betont. Die Arbeit bietet wertvolle Einblicke in die Entwicklung und Vielfalt der Kindersendungen und legt den Grundstein für weitere detaillierte Untersuchungen in diesem Bereich.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Fragestellung
- 2. Theorie: Historische Untersuchung
- 2.1 Das Teilsystem der Massenmedien
- 3. Die Kindersendungen im Überblick
- 3.1 Kinderstunde
- 3.2 Jugendstunde
- 3.3 Buben- und Mädchenstunde
- 3.4 Kindernachrichtendienst
- 3.5 Bettmümpfeli
- 3.6 Treffpunkt Welle 2
- 3.7 Kinderclub am Mittag
- 3.8 Kinderclub am Sonntag
- 3.9 Kinderclub am Nachmittag
- 3.10 Looping
- 3.11 SiggSaggSugg
- 3.12 Pirando
- 3.13 Zambo
- 4. Gesamtüberblick und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Geschichte der Kindersendungen beim Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) über einen Zeitraum von knapp 90 Jahren. Das Hauptziel ist es, einen historischen Überblick über die verschiedenen Sendeformate zu geben, die Entwicklung des Kinderprogramms aufzuzeigen und zu beleuchten, ob es Phasen ohne Kinderprogramm gab und wie sich die Anzahl der Sendungen im Laufe der Zeit verändert hat. Die Arbeit dient als eine erste, kurze Übersicht und soll Anknüpfungspunkte für weitere Forschungsarbeiten liefern.
- Entwicklung der Kindersendungen im Schweizer Radio und Fernsehen
- Existenz und Wandel von Kinderprogrammen im Laufe der Zeit
- Vielfalt der Sendeformate für Kinder im Schweizer Radio
- Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen auf das Kinderprogramm
- Die Rolle der SRG im Schweizer Medienlandschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Fragestellung: Die Einleitung beleuchtet die aktuelle Debatte um das Ende der Kindersendung "Zambo" und stellt die Frage nach der Bedeutung von Kindersendungen im Kontext der Geschichte des Schweizer Radio und Fernsehens (SRG). Sie führt in die Thematik ein, indem sie den hohen Stellenwert der SRG im Schweizer Medienmarkt hervorhebt und die Kontroverse um die geplante Streichung von "Zambo" im Verhältnis zur Geschichte des Kinderprogramms einordnet. Die Einleitung definiert die Ziele der Arbeit und skizziert den Aufbau.
2. Theorie: Historische Untersuchung: Dieses Kapitel legt die theoretische Grundlage der Arbeit dar, indem es Niklas Luhmanns Systemtheorie heranzieht. Es beschreibt die Konzepte der segmentär differenzierten, stratifikatorisch differenzierten und funktional differenzierten Gesellschaft, wobei der Fokus auf der modernen, funktional differenzierten Gesellschaft liegt. Der Abschnitt erklärt das Teilsystem der Massenmedien nach Luhmann, seinen binären Code (Information/Nicht-Information) und die Selektionsmechanismen, die bestimmen, welche Ereignisse als Nachrichten präsentiert werden. Die "Newsworthiness" und "Shareworthiness" werden im Kontext der Nachrichtenselektion diskutiert, ebenso wie die Rolle von Journalisten als "Gatekeeper". Die Kapitel erläutert die unterschiedlichen Programmbereiche (Nachrichten, Unterhaltung, Werbung) und ihre Interdependenzen.
3. Die Kindersendungen im Überblick: Dieser Abschnitt bietet einen detaillierten Überblick über diverse Kindersendungen im Schweizer Radio und Fernsehen. Er analysiert die verschiedenen Formate und ihre Entwicklung über die Jahrzehnte. Die einzelnen Unterkapitel (3.1-3.13) beschreiben jeweils die einzelnen Sendungen, wobei die Kapitelüberschriften selbst bereits einen Einblick in die Vielfalt der Programme geben. Die einzelnen Sendungen werden hier nicht einzeln zusammengefasst, sondern das Kapitel als Ganzes behandelt den Gesamtüberblick der Kindersendungen im Laufe der Zeit.
Schlüsselwörter
Kinderprogramm, Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), SRG, Massenmedien, Systemtheorie (Luhmann), Medienentwicklung, historische Medienforschung, Kindermedien, Nachrichtenwerttheorie, Programmgestaltung, Medienwandel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Geschichte der Kindersendungen im Schweizer Radio und Fernsehen"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Geschichte der Kindersendungen des Schweizer Radio und Fernsehens (SRF) über einen Zeitraum von fast 90 Jahren. Sie analysiert die Entwicklung der verschiedenen Sendeformate, prüft auf Phasen ohne Kinderprogramm und untersucht die Veränderung der Anzahl der Sendungen im Laufe der Zeit. Die Arbeit dient als eine erste, kurze Übersicht und soll Anknüpfungspunkte für weitere Forschungsarbeiten bieten.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine historische Untersuchungsmethode und stützt sich theoretisch auf Niklas Luhmanns Systemtheorie. Sie betrachtet die Massenmedien als Teilsystem einer funktional differenzierten Gesellschaft und analysiert die Selektionsmechanismen (Newsworthiness, Shareworthiness) bei der Programmplanung. Die Rolle von Journalisten als "Gatekeeper" wird ebenfalls berücksichtigt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung der Kindersendungen im SRF, den Wandel von Kinderprogrammen über die Zeit, die Vielfalt der Sendeformate, den Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen und die Rolle der SRG in der Schweizer Medienlandschaft.
Welche Kindersendungen werden im Detail betrachtet?
Die Arbeit gibt einen detaillierten Überblick über verschiedene Kindersendungen des Schweizer Radio und Fernsehens, darunter "Kinderstunde", "Jugendstunde", "Buben- und Mädchenstunde", "Kindernachrichtendienst", "Bettmümpfeli", "Treffpunkt Welle 2", "Kinderclub am Mittag", "Kinderclub am Sonntag", "Kinderclub am Nachmittag", "Looping", "SiggSaggSugg", "Pirando" und "Zambo". Die einzelnen Sendungen werden nicht einzeln zusammengefasst, sondern im Kontext des Gesamtüberblicks behandelt.
Welche Fragestellung steht im Mittelpunkt der Einleitung?
Die Einleitung thematisiert die aktuelle Debatte um das Ende der Kindersendung "Zambo" und hinterfragt die Bedeutung von Kindersendungen im Kontext der Geschichte des SRF. Sie hebt den Stellenwert der SRG im Schweizer Medienmarkt hervor und ordnet die Kontroverse um "Zambo" in die Geschichte des Kinderprogramms ein.
Wie wird Luhmanns Systemtheorie angewendet?
Luhmanns Systemtheorie wird verwendet, um die Entwicklung und die Selektion von Inhalten im Teilsystem der Massenmedien zu analysieren. Die Konzepte der segmentär differenzierten, stratifikatorisch differenzierten und funktional differenzierten Gesellschaft werden erläutert, wobei der Fokus auf der funktional differenzierten Gesellschaft liegt. Der binäre Code (Information/Nicht-Information) und die Selektionsmechanismen der Massenmedien werden im Detail betrachtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kinderprogramm, Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), SRG, Massenmedien, Systemtheorie (Luhmann), Medienentwicklung, historische Medienforschung, Kindermedien, Nachrichtenwerttheorie, Programmgestaltung, Medienwandel.
Gibt es ein Inhaltsverzeichnis?
Ja, die Arbeit enthält ein detailliertes Inhaltsverzeichnis mit den Kapiteln "Fragestellung", "Theorie: Historische Untersuchung" (inkl. Unterkapitel "Das Teilsystem der Massenmedien"), "Die Kindersendungen im Überblick" (mit zahlreichen Unterkapiteln zu einzelnen Sendungen) und "Gesamtüberblick und Fazit".
- Quote paper
- Thomas Eglin (Author), 2020, Ein historischer Überblick der Kindersendungen beim Schweizer Radio und Fernsehen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1478844