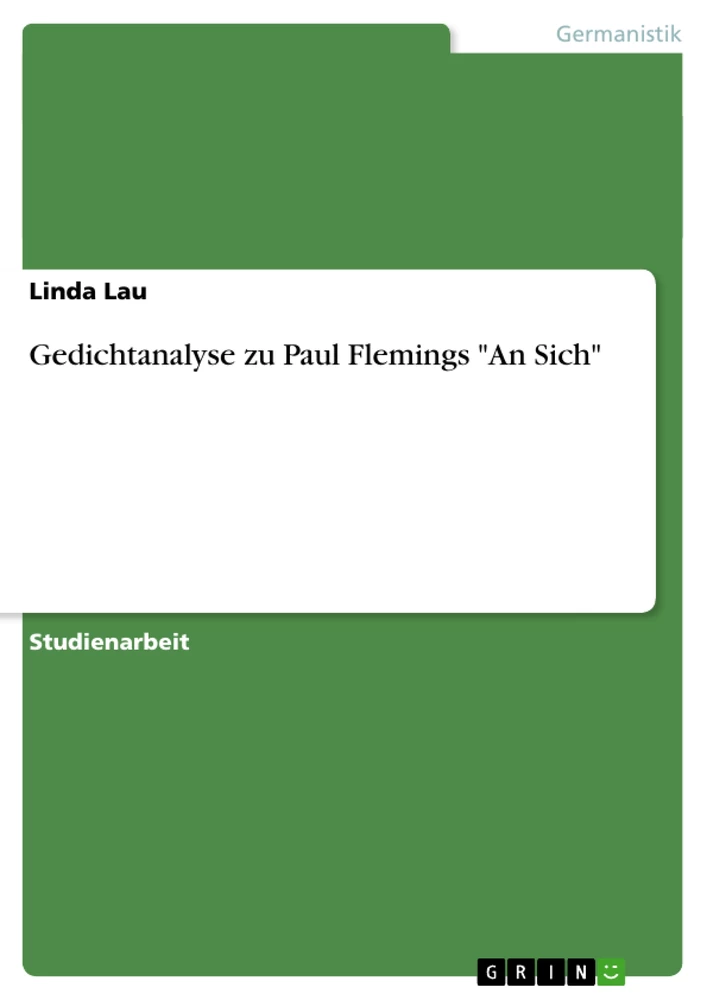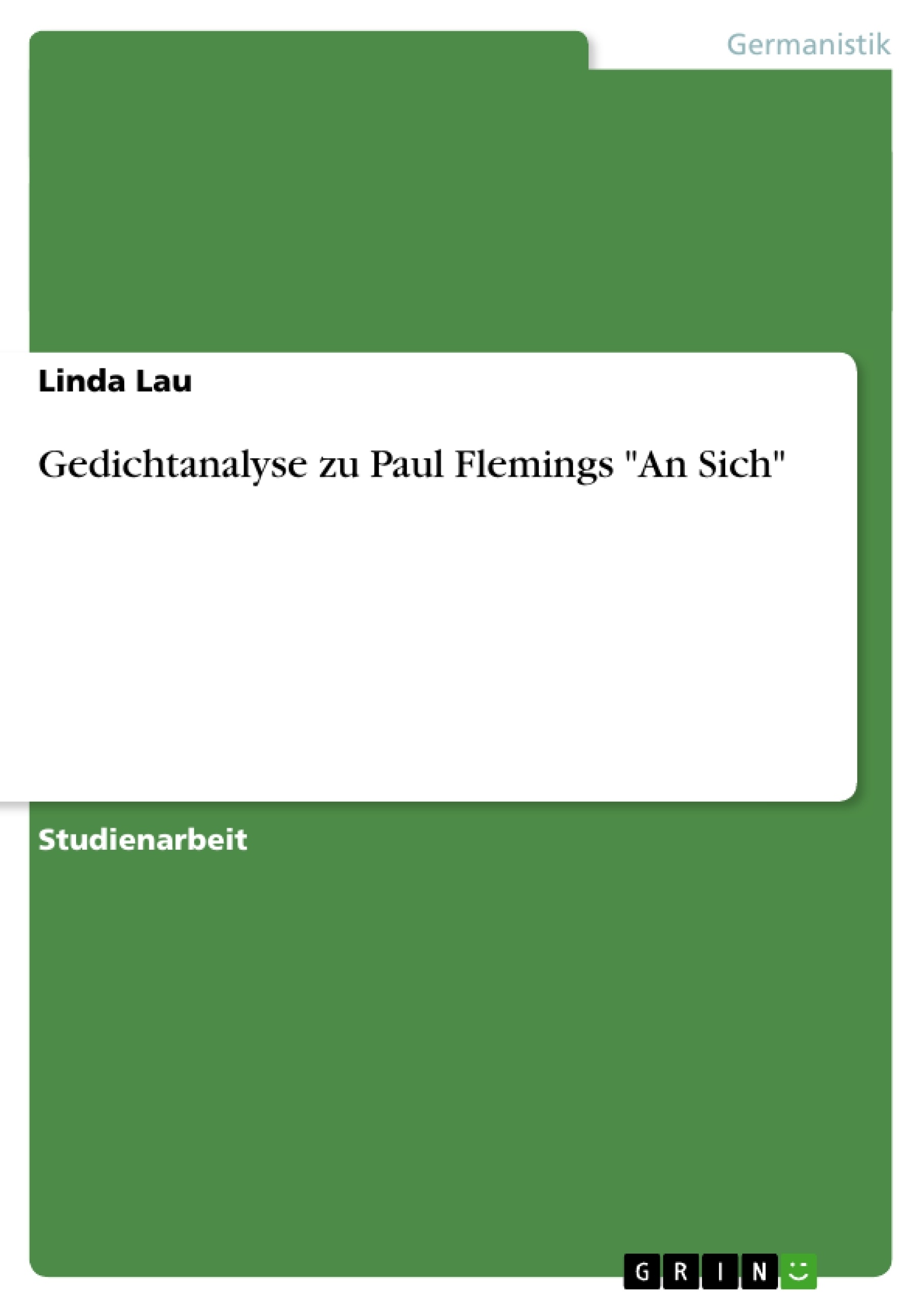„Nichts Böses kann dem guten Menschen zustoßen: Gegensätze lassen sich nicht verschmelzen. […] so ändert der Ansturm widriger Ereignisse nicht eines tapferen Mannes Charakter; er verharrt in seiner Haltung, und was immer geschieht, paßt er seinem persönlichen Wesen an; er ist nämlich mächtiger als alle Geschehnisse von außen.“ So schreibt es Seneca in seinen Philosophischen Schriften aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. Die stoische Philosophie kennzeichnet sich vor allem durch eine „freie Selbstbestimmung zu einem natur- und daher vernunftgemäßen Leben.“ Dem Stoizismus der Antike folgt im 17. Jahrhundert mit Justus Lipsius der sogenannte >Neustoizismus<, dessen Philosophie sich auch auf die neuere deutsche Literatur auswirkt. So zeigen sich Elemente der stoischen Ethik, wie beispielsweise die gleichgültige Annahme von Schicksalsschlägen, Eigenverantwortlichkeit und Selbstbeherrschung, auch in Paul Flemings Gedicht An Sich. Das Barocksonett wurde erstmalig im Jahr 1642 in Flemings Gedichtsammlung Teütsche Poemata veröffentlicht. Es soll im Folgenden einer genauen formalen und sprachlichen Analyse unterzogen werden. Ich werde den Text dabei anhand von Aufbau, Struktur und Rhetorik analysieren und mögliche Deutungsansätze mit einbeziehen. Auf die Thematik der >Selbstbeherrschung< wird dabei besonders Wert gelegt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Aufbau des Textes
- 3. Aussageinstanz
- 4. Metrum, Reimschema und Kadenzen
- 5. Vers- und Satzstruktur
- 5.1. Syntaktische Struktur
- 5.2. Syntaktische Figuren
- 6. Rhetorische Techniken
- 6.1. Klangfiguren
- 6.2. Wiederholungsfiguren
- 6.3. Hinzufügungsfiguren
- 6.4. Gedankenfiguren
- 6.5. Substitutionsfiguren
- 7. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieser Arbeit ist eine formale und sprachliche Analyse von Paul Flemings Gedicht „An Sich“, wobei besonderes Augenmerk auf die Thematik der Selbstbeherrschung gelegt wird. Die Analyse umfasst Aufbau, Struktur und Rhetorik des Textes, unter Einbezug möglicher Deutungsansätze.
- Formale Analyse des Barocksonetts (Metrum, Reimschema, Kadenzen)
- Analyse der Vers- und Satzstruktur
- Untersuchung der rhetorischen Mittel
- Bestimmung der Aussageinstanz und der Redesituation
- Interpretation des Gedichts im Kontext der stoischen Philosophie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Gedichts „An Sich“ von Paul Fleming ein und stellt einen Bezug zur stoischen Philosophie her. Sie skizziert den Ansatz der Analyse, der sich auf formale und sprachliche Aspekte konzentriert, mit besonderem Fokus auf die Selbstbeherrschung als zentrales Thema. Der Kontext des Barock und der Einfluss des Neustoizismus werden kurz angerissen, um den Hintergrund des Gedichts zu beleuchten und die Relevanz der stoischen Ethik für die Interpretation zu unterstreichen. Das Zitat von Seneca dient als einleitendes Beispiel für stoische Gedanken, die im Gedicht wiederzufinden sind.
2. Aufbau des Textes: Dieses Kapitel beschreibt den formalen Aufbau von Flemings Sonett „An Sich“. Es analysiert die Gliederung in Quartette und Terzette, die semantisch und strukturell voneinander abgegrenzt sind. Der Aufbau des Gedichts folgt den Regeln der Sonettdichtung des 17. Jahrhunderts und die Kapitel analysiert die inhaltliche Entwicklung: die Reflexion einer Ausgangssituation in den Quartetten und die Schlussfolgerung in den Terzetten. Die scheinbar unverbundene Aussage im ersten Vers wird als Ausgangspunkt für die weiteren Imperative des Gedichts gedeutet. Die Kapitel erläutert, wie die dargestellte Problematik über den Verlauf des Gedichts entwickelt und schließlich in den Terzetten aufgelöst wird.
3. Aussageinstanz: Die Analyse der Aussageinstanz untersucht die Frage, wer im Gedicht zu wem spricht. Es werden die Möglichkeiten eines reflektierenden Selbstgesprächs oder einer Appellation an ein „Du“ diskutiert. Das Kapitel hebt den überlegenen Charakter des lyrischen Ichs hervor und analysiert dessen selbstbewusste und selbstbestimmte Sprache. Die verschiedenen Lesarten des Titels („An Sich“) werden betrachtet, was zu der Interpretation führt, dass das Gedicht entweder einen Monolog des Ichs oder eine allgemeine Weltanschauung darstellt, die auf die gesamte Menschheit übertragbar ist. Der Kapitel erläutert, wie die unpersönlichen Aussagen im Gedicht die allgemeine Gültigkeit der Botschaften unterstützen.
4. Metrum, Reimschema und Kadenzen: Dieses Kapitel befasst sich mit der formalen Gestaltung des Gedichts im Bezug auf Metrum, Reimschema und Kadenzen. Es wird die Regelmäßigkeit des Metrums und des Reimschemas (abba acca, def def) herausgestellt. Die Analyse konzentriert sich auf die Besonderheiten, insbesondere auf eine Abweichung im siebten Vers, welcher die Betonung auf den Imperativ „Thu“ verstärkt. Die Interpretation des Reimschemas der Terzette wird in zwei Varianten betrachtet und es wird diskutiert, wie die besondere Gestaltung des letzten Verspaares (unreiner Reim, männliche Kadenz) zu einer hervorgehobenen Stellung und der Wirkung als Aphorismus und Moral des Gedichts beiträgt. Die Regelmäßigkeit der Form wird in Zusammenhang mit der Suche des lyrischen Ichs nach Halt in einer schwierigen Situation gebracht.
5. Vers- und Satzstruktur: Dieses Kapitel analysiert die syntaktische Struktur des Gedichts. Es beschreibt die überwiegend im Zeilenstil gehaltene Sprache, die durch eine klare und geordnete Satzstruktur gekennzeichnet ist. Der Unterschied zwischen den Quartetten (kurze, prägnante Apelle) und den Terzetten (paarweise verbundene Sätze) wird hervorgehoben. Die Vermeidung von verschachtelten Sätzen trägt zu dem geordneten Gesamtbild bei. Die Kapitel beleuchtet den Zusammenhang zwischen der formalen Gestaltung und dem Ausdruck der Gedanken des lyrischen Ichs.
Schlüsselwörter
Paul Fleming, An Sich, Barocksonett, Stoizismus, Selbstbeherrschung, Metrum, Reimschema, Kadenzen, Versstruktur, Satzstruktur, Rhetorik, Aussageinstanz, Imperativ, Selbstreflexion, Allgemeine Gültigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Paul Flemings "An Sich"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Paul Flemings Gedicht "An Sich" formal und sprachlich. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Thema der Selbstbeherrschung und der Einbettung des Gedichts in den Kontext der stoischen Philosophie.
Welche Aspekte des Gedichts werden analysiert?
Die Analyse umfasst den Aufbau, die Struktur und die Rhetorik des Textes. Es werden Metrum, Reimschema, Kadenzen, Vers- und Satzstruktur sowie rhetorische Mittel untersucht. Zusätzlich wird die Aussageinstanz und die mögliche Redesituation beleuchtet.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Aufbau des Textes, Aussageinstanz, Metrum, Reimschema und Kadenzen, Vers- und Satzstruktur, Rhetorische Techniken und Schlussbemerkung. Jedes Kapitel widmet sich einem spezifischen Aspekt des Gedichts.
Was ist die Zielsetzung der Analyse?
Die Zielsetzung ist es, durch eine detaillierte sprachliche und formale Analyse ein tieferes Verständnis von Flemings Gedicht "An Sich" zu erreichen und dessen Bedeutung im Kontext der stoischen Philosophie zu interpretieren.
Wie wird der Aufbau des Gedichts analysiert?
Der Aufbau des Barocksonetts (Quartette und Terzette) wird detailliert beschrieben. Die semantische und strukturelle Abgrenzung der Quartette und Terzette wird untersucht, ebenso wie die inhaltliche Entwicklung vom Ausgangspunkt (Reflexion) zur Schlussfolgerung.
Wie wird die Aussageinstanz bestimmt?
Die Analyse der Aussageinstanz untersucht, wer im Gedicht zu wem spricht. Es werden die Möglichkeiten eines Selbstgesprächs oder einer Appellation an ein „Du“ diskutiert und der Charakter des lyrischen Ichs herausgestellt.
Wie werden Metrum, Reimschema und Kadenzen analysiert?
Das Kapitel untersucht die formale Gestaltung des Gedichts bezüglich Metrum, Reimschema (abba acca, def def) und Kadenzen. Besondere Aufmerksamkeit wird auf Abweichungen (z.B. im siebten Vers) und deren Wirkung gelegt.
Wie wird die Vers- und Satzstruktur analysiert?
Die Analyse der Vers- und Satzstruktur konzentriert sich auf den Zeilenstil, die klare Satzstruktur und den Unterschied zwischen Quartetten (kurze, prägnante Apelle) und Terzetten (paarweise verbundene Sätze).
Welche rhetorischen Techniken werden untersucht?
Die Analyse umfasst verschiedene Kategorien rhetorischer Figuren, darunter Klangfiguren, Wiederholungsfiguren, Hinzufügungsfiguren, Gedankenfiguren und Substitutionsfiguren. Der Einfluss dieser Figuren auf die Wirkung des Gedichts wird untersucht.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Paul Fleming, An Sich, Barocksonett, Stoizismus, Selbstbeherrschung, Metrum, Reimschema, Kadenzen, Versstruktur, Satzstruktur, Rhetorik, Aussageinstanz, Imperativ, Selbstreflexion, Allgemeine Gültigkeit.
Welche Rolle spielt der Stoizismus in der Interpretation?
Der Stoizismus bildet einen wichtigen Kontext für die Interpretation des Gedichts. Die stoische Philosophie wird herangezogen, um die Thematik der Selbstbeherrschung im Gedicht zu verstehen und zu erläutern.
- Arbeit zitieren
- Linda Lau (Autor:in), 2010, Gedichtanalyse zu Paul Flemings "An Sich", München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/147622