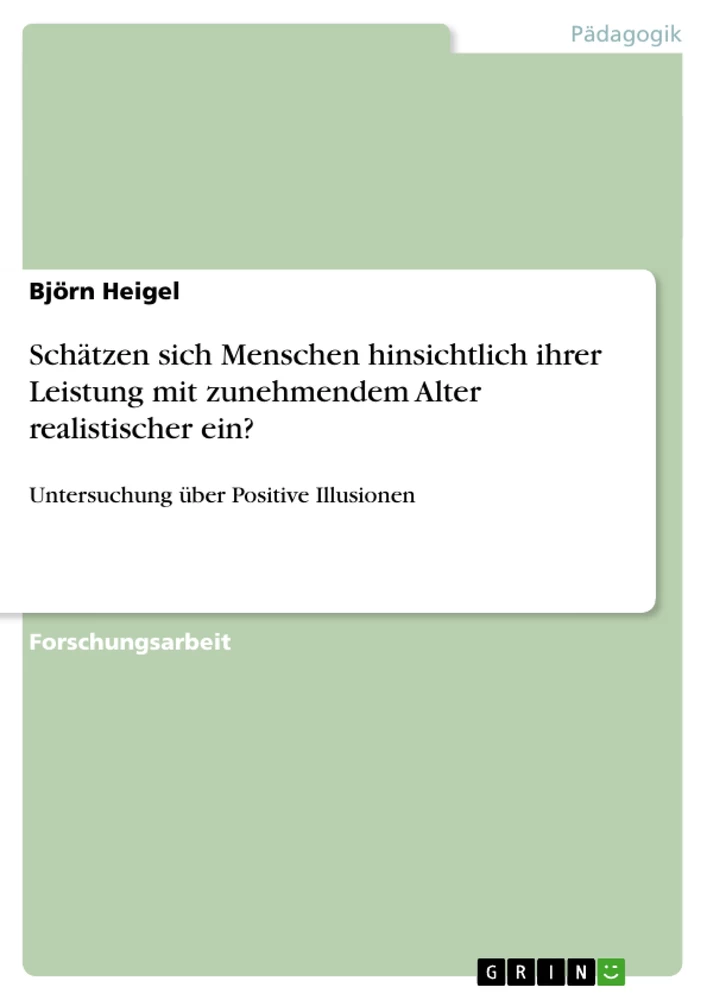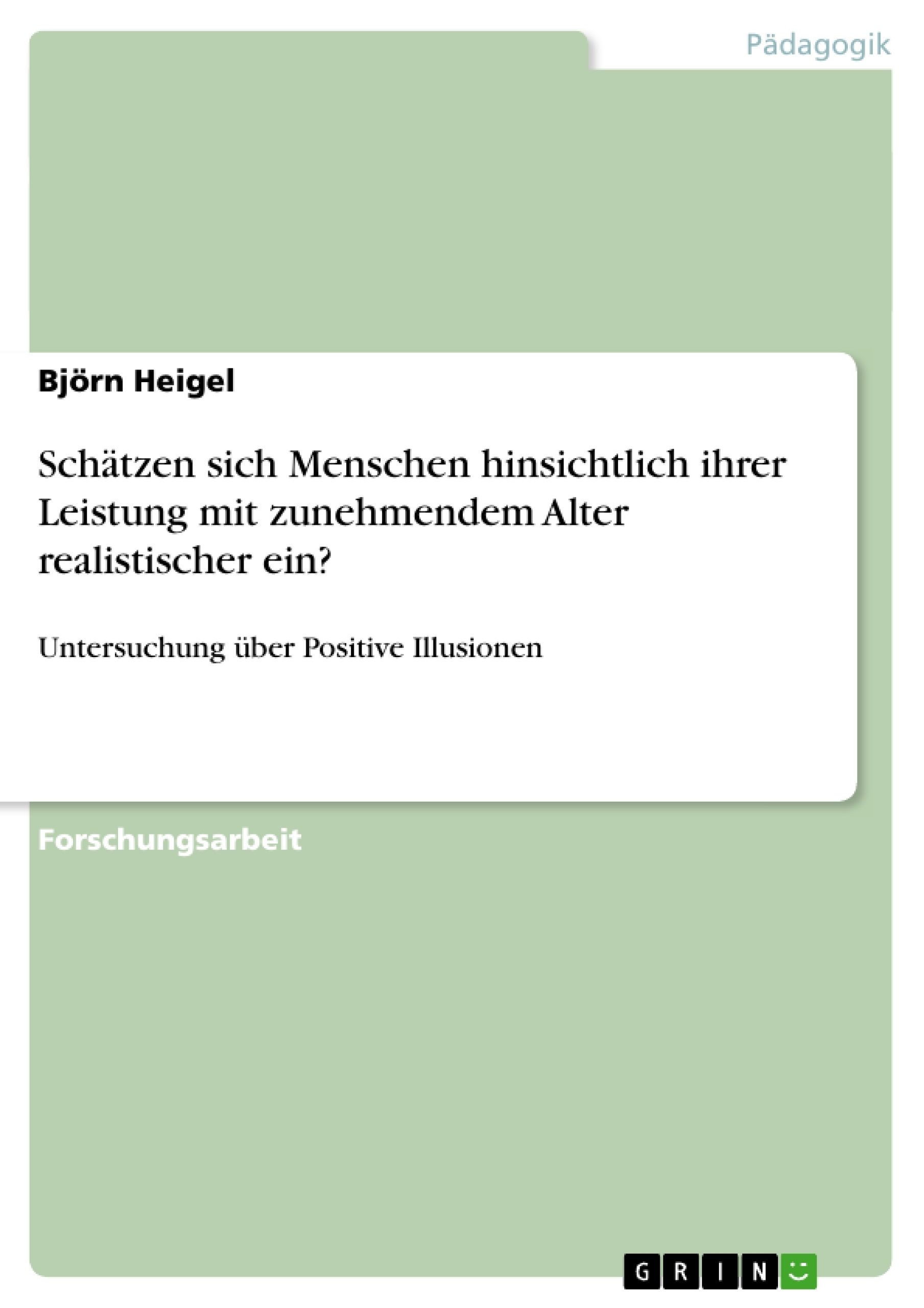Die Psychologie bezeichnet gewisse Überzeugungen, die keine realistische Einschätzung darstellen, sondern bei der Mehrheit der psychisch gesunden Menschen positiv verzerrt vorliegen als Positive Illusionen. Die meisten Menschen schätzen sich besser ein als eine durchschnittliche Person, was laut einer objektiven Wahrnehmung im Sinne des Common Sense nicht sein kann. Die geläufige Forschungsmeinung besteht in der Vermutung, dass positve Illusionen nicht nur einfache Fehleinschätzungen sind, sondern wichtige Funktionen erfüllen und dabei helfen, Alltagsherausforderungen und außergewöhnliche Belastungen zu bestehen.
Das Positive, was die Illusion am Beispiel unserer Theorie ausmacht, ist die Tatsache, dass die (verzerrte) Selbstwahrnehmung in eine bestimmte, und zwar positive Richtung verläuft, während negative Informationen ausgeblendet oder als weniger bedrohlich, als sie in objektiver Wahrnehmung sind, verstanden werden.
Diese Arbeit beschäftigt sich im Anschluss an das Seminar „Positive Illusionen“ mit eben genannten Thema und legt die Methodik, Durchführung und Diskussion unserer Studie unter der Frage dar, ob sich Menschen hinsichtlich ihres Leistungsvermögens mit zunehmendem Alter realistischer einschätzen. Ziel der hier vorliegenden Untersuchung ist es also, die psychologisch-pädagogische Forschungshypothese zu begründen, sie angemessen zu präzisieren und sie mithilfe empirischer Methodik zu untersuchen. Nach der Darstellung eben jener Methodik im sechsten Abschnitt dieses Berichtes folgt im Anschluss daran das Design sowie der Aufbau unserer Untersuchung. Im achten Teil des Gesamtberichtes werden die Ergebnisse der Befragung erörtert. Diesem schließt sich ein umfangreicher Diskussionsteil an, der sich vorrangig mit der kritischen Auseinandersetzung der Untersuchung sowie methodischen Mängeln und Störfaktoren beschäftigt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Fragestellung
- 2 Theorie
- 2.1 Erörterung des Forschungsstandes
- 2.2 Theoretischer Hintergrund
- 3 Hypothesen
- 5 Methoden der Datengewinnung
- 5.1 Design der Untersuchung
- 5.2 Aufbau des Fragebogens
- 5.3 Begründung der Fragestellungen (Items)
- 6 Durchführung der Untersuchung
- 7 Datenauswertung
- 8 Interpretation der Daten
- 8.1 Deskriptive Ergebnisse
- 8.1.1 Auswertung der Daten der 5. Klassen
- 8.1.2 Auswertung der Daten der 10. Klassen
- 8.2 Analytische Ergebnisse
- 8.2.1 Signifikanz
- 8.2.2 Korrelation
- 8.1 Deskriptive Ergebnisse
- 9 Diskussion
- 9.1 Interpretation der Ergebnisse
- 9.2 Einfluss der Störvariablen
- 9.3 Abschließende Kritik
- 9.4 Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Hypothese, ob Menschen mit zunehmendem Alter ihr Leistungsvermögen realistischer einschätzen. Ziel ist die Begründung und Präzisierung dieser psychologisch-pädagogischen Forschungshypothese mittels empirischer Methoden. Die Studie beinhaltet die Methodik, Durchführung und Diskussion der Ergebnisse einer Befragung.
- Positive Illusionen und deren Einfluss auf die Selbstwahrnehmung
- Realismus der Selbsteinschätzung im Hinblick auf das Leistungsvermögen in Abhängigkeit vom Alter
- Empirische Überprüfung der Forschungshypothese mittels Fragebogen
- Methodische Analyse und kritische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen
- Identifizierung und Diskussion von Störvariablen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Fragestellung: Dieses Kapitel führt in die Forschungsarbeit ein und beschreibt das zentrale Forschungsziel: die Untersuchung der Hypothese, ob die Selbsteinschätzung des eigenen Leistungsvermögens mit zunehmendem Alter realistischer wird. Es skizziert den Aufbau der Arbeit, beginnend mit der Darstellung der theoretischen Grundlagen, der Methodik, der Durchführung, der Auswertung und Interpretation der Ergebnisse, und schließt mit einer kritischen Diskussion der Untersuchung ab.
2 Theorie: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es beleuchtet den aktuellen Forschungsstand zu positiven Illusionen und deren theoretischen Hintergrund, der in den 1970er Jahren in Harvard seinen Ursprung hat. Es werden verschiedene Arten von positiven Illusionen (unrealistisch positiver Blick auf sich selbst, Kontrollillusion, unrealistischer Optimismus) erläutert und deren Auswirkungen auf das Wohlbefinden diskutiert. Der Fokus liegt auf der Frage, wie positive Verzerrungen der Selbstwahrnehmung von krankhaften Selbstüberschätzungen abgegrenzt werden können.
3 Hypothesen: Dieses Kapitel präsentiert die zentrale Forschungshypothese, die auf der Arbeit von Taylor und Brown basiert. Die Hypothese wird im Kontext der bereits vorgestellten theoretischen Grundlagen und des Forschungsstandes positioniert, um den wissenschaftlichen Rahmen der Studie zu verdeutlichen. Der Abschnitt dient als Brücke zwischen der theoretischen Fundierung und der empirischen Untersuchung.
Schlüsselwörter
Positive Illusionen, Realistische Selbsteinschätzung, Leistungsvermögen, Alter, Empirische Forschung, Fragebogen, Psychologische Forschung, Pädagogische Psychologie, Selbstüberschätzung, Kontrollillusion, Unrealistischer Optimismus, Wohlbefinden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Untersuchung der Realistischen Selbsteinschätzung des Leistungsvermögens im Alter
Was ist das zentrale Thema dieser Forschungsarbeit?
Die Arbeit untersucht die Hypothese, ob Menschen mit zunehmendem Alter ihr Leistungsvermögen realistischer einschätzen. Es wird geprüft, ob die Selbsteinschätzung des eigenen Leistungsvermögens mit zunehmendem Alter realistischer wird.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit stützt sich auf die Theorie der positiven Illusionen, deren Ursprung in den 1970er Jahren in Harvard liegt. Es werden verschiedene Arten von positiven Illusionen (unrealistisch positiver Blick auf sich selbst, Kontrollillusion, unrealistischer Optimismus) erläutert und deren Auswirkungen auf das Wohlbefinden diskutiert. Ein Fokus liegt auf der Abgrenzung von positiven Verzerrungen der Selbstwahrnehmung von krankhaften Selbstüberschätzungen.
Welche Methodik wird verwendet?
Die Studie verwendet empirische Methoden, speziell eine Befragung mittels Fragebogen. Die Arbeit beschreibt das Design der Untersuchung, den Aufbau des Fragebogens und die Begründung der Fragestellungen (Items). Die Durchführung und die Auswertung der Daten werden detailliert dargestellt.
Welche Daten werden ausgewertet und wie?
Die Datenauswertung umfasst deskriptive und analytische Ergebnisse. Deskriptive Ergebnisse werden getrennt für die 5. und 10. Klassen ausgewertet. Analytische Ergebnisse befassen sich mit Signifikanz und Korrelation der Daten.
Welche Hypothesen werden geprüft?
Die zentrale Forschungshypothese basiert auf der Arbeit von Taylor und Brown und wird im Kontext der vorgestellten theoretischen Grundlagen positioniert. Das Kapitel "Hypothesen" dient als Brücke zwischen Theorie und empirischer Untersuchung.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in die folgenden Kapitel: Fragestellung, Theorie (mit Erörterung des Forschungsstandes und theoretischem Hintergrund), Hypothesen, Methoden der Datengewinnung (Design der Untersuchung, Aufbau des Fragebogens, Begründung der Fragestellungen), Durchführung der Untersuchung, Datenauswertung, Interpretation der Daten (deskriptive und analytische Ergebnisse), Diskussion (Interpretation der Ergebnisse, Einfluss von Störvariablen, abschließende Kritik und Schlusswort).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Positive Illusionen, Realistische Selbsteinschätzung, Leistungsvermögen, Alter, Empirische Forschung, Fragebogen, Psychologische Forschung, Pädagogische Psychologie, Selbstüberschätzung, Kontrollillusion, Unrealistischer Optimismus, Wohlbefinden.
Welche Ergebnisse werden diskutiert?
Die Diskussion der Ergebnisse umfasst die Interpretation der Daten, den Einfluss von Störvariablen, eine abschließende Kritik der Methodik und ein Schlusswort. Der Abschnitt bewertet die Ergebnisse kritisch und setzt sie in den Kontext der bestehenden Literatur.
- Quote paper
- Björn Heigel (Author), 2010, Schätzen sich Menschen hinsichtlich ihrer Leistung mit zunehmendem Alter realistischer ein?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/147594