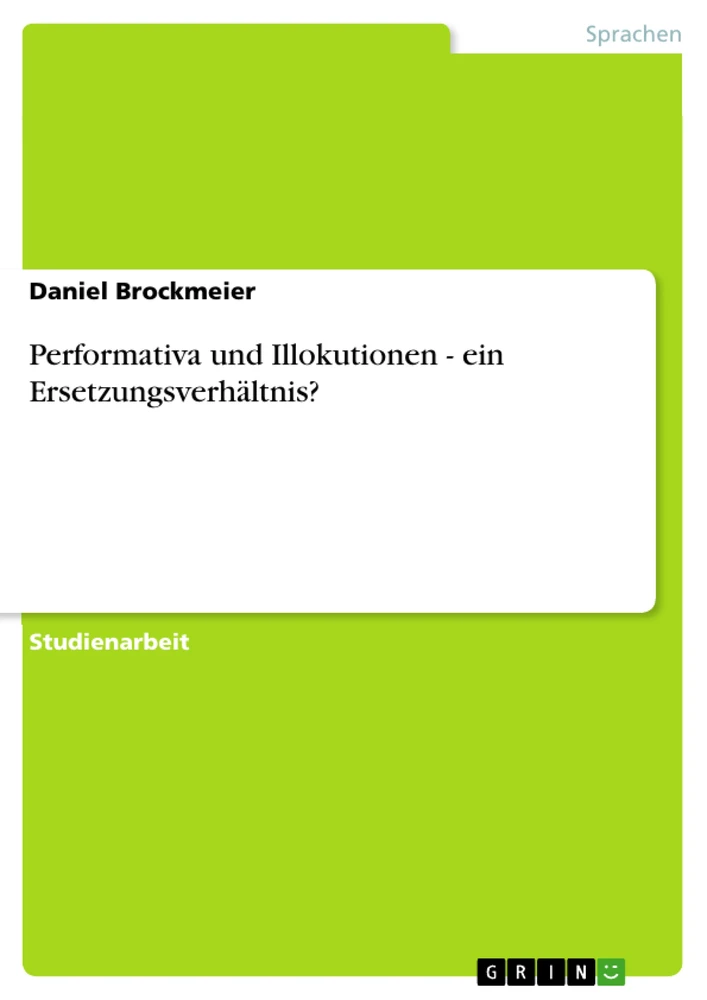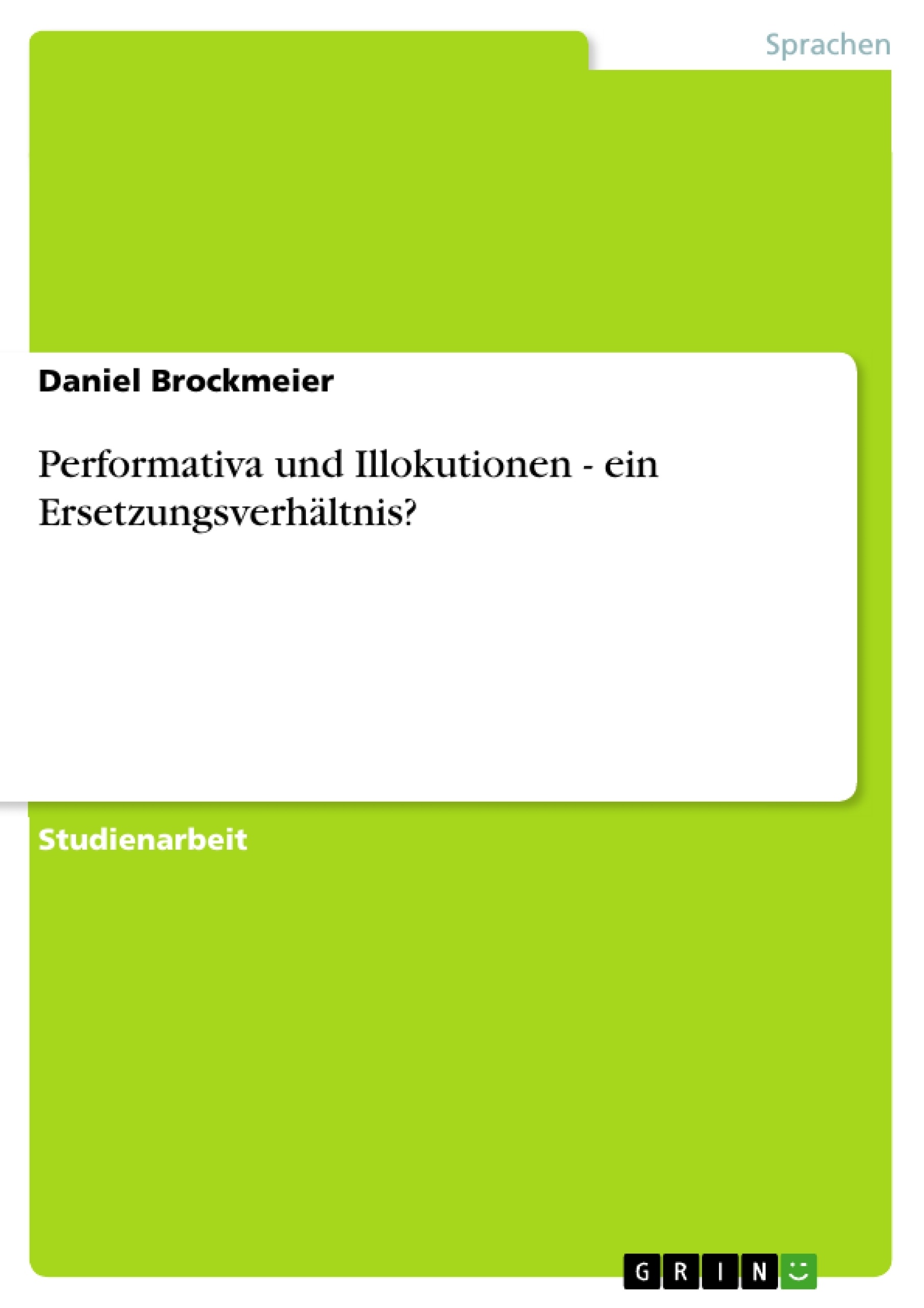Die Hausarbeit befasst sich mit der Sprechakttheorie John Langshaw Austins unter dem Gesichtspunkt, ob dieser die Unterscheidung zwischen performativen und konstativen Äußerungen zurecht zusammenbrechen lässt. Austin verwies als erster darauf, dass Sprechen unter bestimmten Bedingungen zugleich Handeln bedeuten kann. Er explizierte dies in seinem Hauptwerk: „How to do things with words“, indem er zunächst zwischen konstativen Äußerungen, welche wahr oder falsch sein können und performativen Äußerungen, Handlungen, die gelingen oder misslingen können, unterschied.
Im Laufe seiner Untersuchung stellte Austin jedoch fest, dass sich diese Unterteilung nicht aufrecht erhalten ließ, stattdessen unterschied er fortan bei jeder menschlichen Äußerung drei simultan ablaufende Sprechakte: die Lokution, die Illokution und die Perlokution.
Diese Arbeit stellt die erste Unterteilung Austins seiner zweiten gegenüber. Die zentrale Frage dabei lautet:
Warum lässt sich die ursprüngliche Unterteilung nicht aufrecht erhalten?
Austins Arbeit wird zunächst in einen zeitgeschichtlichen Kontext gestellt. Dieser erste Teil wird allerdings relativ knapp abgehandelt, zugunsten des Hauptteils. In diesem werden sowohl beide Modelle Austins ausführlich vorgestellt, als auch die Gründe die zum Zusammenbruch der Theorie von den Performativa führten. Im Anschluss wird als Gegenthese Sybille Krämers Modell vorgestellt und diskutiert.
Dabei wird besonders interessieren, warum Austin, die erste Unterteilung überhaupt in die Theorie der Sprechakte aufnahm, wenn er sie anschließend doch zusammenbrechen lässt. Abschließend soll die Frage geklärt werden, ob Austins inszenierter Zusammenbruch notwendig war, außerdem wird der Überlegung nachgegangen, ob die neuere Darstellung „auch als ein Verlust interpretierbar ist(...)“.
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG
- 2 ZEITLICHER KONTEXT
- 2.1 SPRACHWISSENSCHAFT IM 20. JH.
- 2.1.1 Linguistik Turn
- 2.1.2 Ordinary Language Philosophy
- 2.1 SPRACHWISSENSCHAFT IM 20. JH.
- 3 DIE SPRECHAKTTHEORIE
- 3.1 DIE FORM DER SCHRIFT
- 3.2 KONSTATIVA UND PERFORMATIVA
- 3.2.1 Die überholte Theorie
- 3.2.2 Die Ausgangsüberlegungen
- 3.3 LOKUTIONEN, ILLOKUTIONEN UND PERLOKUTIONEN
- 3.4 DER ZUSAMMENBRUCH
- 3.5 DIE ANTITHESE – ES HANDELT SICH UM ZWEI VERSCHIEDENE PHÄNOMENE
- 3.5.1 Kritik an der Antithese
- 3.6 WARUM NAHM AUSTIN DIE THEORIE VON DEN PERFORMATIVA IN DIE SCHRIFT AUF?
- 4 FAZIT - WAS BLEIBT VOM PERFORMATIVA?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Sprechakttheorie John Langshaw Austins, insbesondere die Frage nach dem vermeintlichen "Zusammenbruch" seiner Theorie der Performativa. Die Arbeit analysiert Austins Entwicklung, von der anfänglichen Dichotomie von konstativen und performativen Äußerungen bis zu seinem Drei-Akte-Modell (Lokution, Illokution, Perlokution).
- Entwicklung und Wandel von Austins Sprechakttheorie
- Analyse der Dichotomie von konstativen und performativen Äußerungen
- Die Rolle der Illokution in Austins Modell
- Kritik an Austins Theorie und alternative Ansätze
- Bewertung der Bedeutung von Austins Werk für die Sprachphilosophie
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem vermeintlichen Scheitern von Austins Theorie der Performativa vor. Sie skizziert den methodischen Ansatz, der Austins Werk in einen zeitgeschichtlichen Kontext einbetten und beide Modelle Austins detailliert vorstellen wird, bevor die Gründe für den "Zusammenbruch" der Performativ-Theorie untersucht werden. Schließlich wird die Arbeit die Kritik an Austin und alternative Ansätze diskutieren.
2 Zeitlicher Kontext: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen Kontext von Austins Arbeit, beginnend mit den antiken griechischen Philosophen und ihrem Verständnis von Sprache und Wahrheit. Es zeigt den langen Einfluss aristotelischer Dogmen auf und wie Austins Werk als Bruch mit dieser Tradition zu verstehen ist. Der Fokus liegt auf der Entwicklung sprachphilosophischen Denkens und der Entstehung der "Ordinary Language Philosophy", die Austins Arbeit maßgeblich beeinflusst hat. Der kopernikanische Wende wird als Metapher für den Paradigmenwechsel in der Sprachphilosophie genutzt, der Austins Werk ermöglichte.
3 Die Sprechakttheorie: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und präsentiert ausführlich Austins Sprechakttheorie. Es beginnt mit der anfänglichen Unterscheidung zwischen konstativen und performativen Äußerungen und analysiert die Schwierigkeiten und Widersprüche, die zu deren Aufgabe führten. Das Kapitel beschreibt detailliert Austins Drei-Akte-Modell (Lokution, Illokution, Perlokution) und erklärt dessen Bedeutung für das Verständnis von Sprechakten. Schließlich wird die Kritik an Austins Theorie und die darauffolgende Diskussion um alternative Modelle behandelt.
Schlüsselwörter
Sprechakttheorie, John L. Austin, Performativa, Konstativa, Illokution, Lokution, Perlokution, Ordinary Language Philosophy, Sprachphilosophie, Aristoteles.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Sprechakttheorie John L. Austins
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit analysiert die Sprechakttheorie von John Langshaw Austin, insbesondere die Frage nach dem vermeintlichen "Zusammenbruch" seiner Theorie der Performativa. Sie untersucht Austins Entwicklung von der anfänglichen Unterscheidung zwischen konstativen und performativen Äußerungen bis hin zu seinem Drei-Akte-Modell (Lokution, Illokution, Perlokution).
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Entwicklung und den Wandel von Austins Sprechakttheorie; die Analyse der Dichotomie von konstativen und performativen Äußerungen; die Rolle der Illokution in Austins Modell; Kritik an Austins Theorie und alternative Ansätze; und die Bewertung der Bedeutung von Austins Werk für die Sprachphilosophie. Der historische Kontext, insbesondere die "Ordinary Language Philosophy", wird ebenfalls beleuchtet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, die das Thema und die Forschungsfrage einführt; ein Kapitel zum zeitlichen Kontext, das Austins Arbeit in die Geschichte der Sprachphilosophie einbettet; ein zentrales Kapitel zur detaillierten Darstellung von Austins Sprechakttheorie, einschließlich der Kritik an seinem Modell; und schließlich ein Fazit, das die bleibenden Aspekte der Performativ-Theorie zusammenfasst.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden gegeben?
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz vor. Kapitel 2 beleuchtet den historischen Kontext, inklusive des Einflusses der "Ordinary Language Philosophy". Kapitel 3 präsentiert ausführlich Austins Sprechakttheorie, von der Unterscheidung zwischen Konstativa und Performativa bis zum Drei-Akte-Modell und der darauf folgenden Kritik. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Sprechakttheorie, John L. Austin, Performativa, Konstativa, Illokution, Lokution, Perlokution, Ordinary Language Philosophy, Sprachphilosophie, Aristoteles.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage ist, ob und inwiefern Austins Theorie der Performativa tatsächlich "zusammengebrochen" ist, und welche Aspekte seiner Theorie dennoch relevant bleiben.
Wie wird der historische Kontext berücksichtigt?
Der historische Kontext wird betrachtet, indem die Entwicklung des sprachphilosophischen Denkens vom antiken Griechenland bis zur "Ordinary Language Philosophy" des 20. Jahrhunderts beleuchtet wird. Der Fokus liegt auf dem Einfluss dieser Entwicklungen auf Austins Werk.
Welche Kritikpunkte an Austins Theorie werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Kritik an der anfänglichen Dichotomie von Konstativa und Performativa und die Kritik an verschiedenen Aspekten des Drei-Akte-Modells. Alternative Ansätze zur Sprechakttheorie werden ebenfalls diskutiert.
Welche Bedeutung hat Austins Werk für die Sprachphilosophie?
Die Arbeit bewertet die Bedeutung von Austins Werk für die Sprachphilosophie, indem sie die bleibenden Einflüsse und die Weiterentwicklungen seiner Ideen untersucht.
- Quote paper
- Daniel Brockmeier (Author), 2003, Performativa und Illokutionen - ein Ersetzungsverhältnis?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/147524