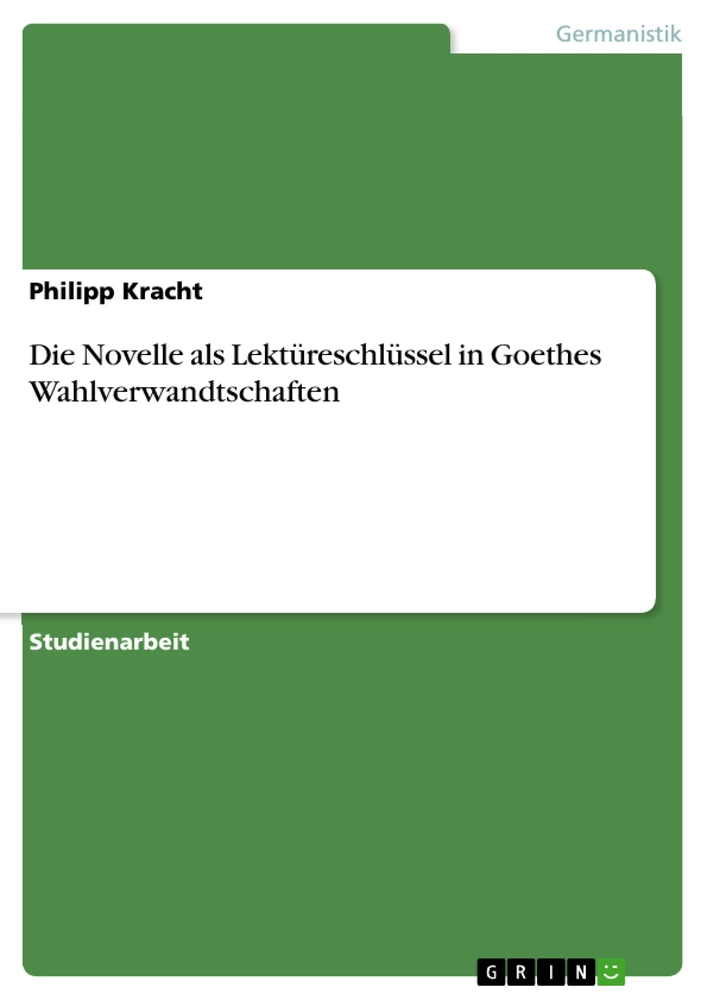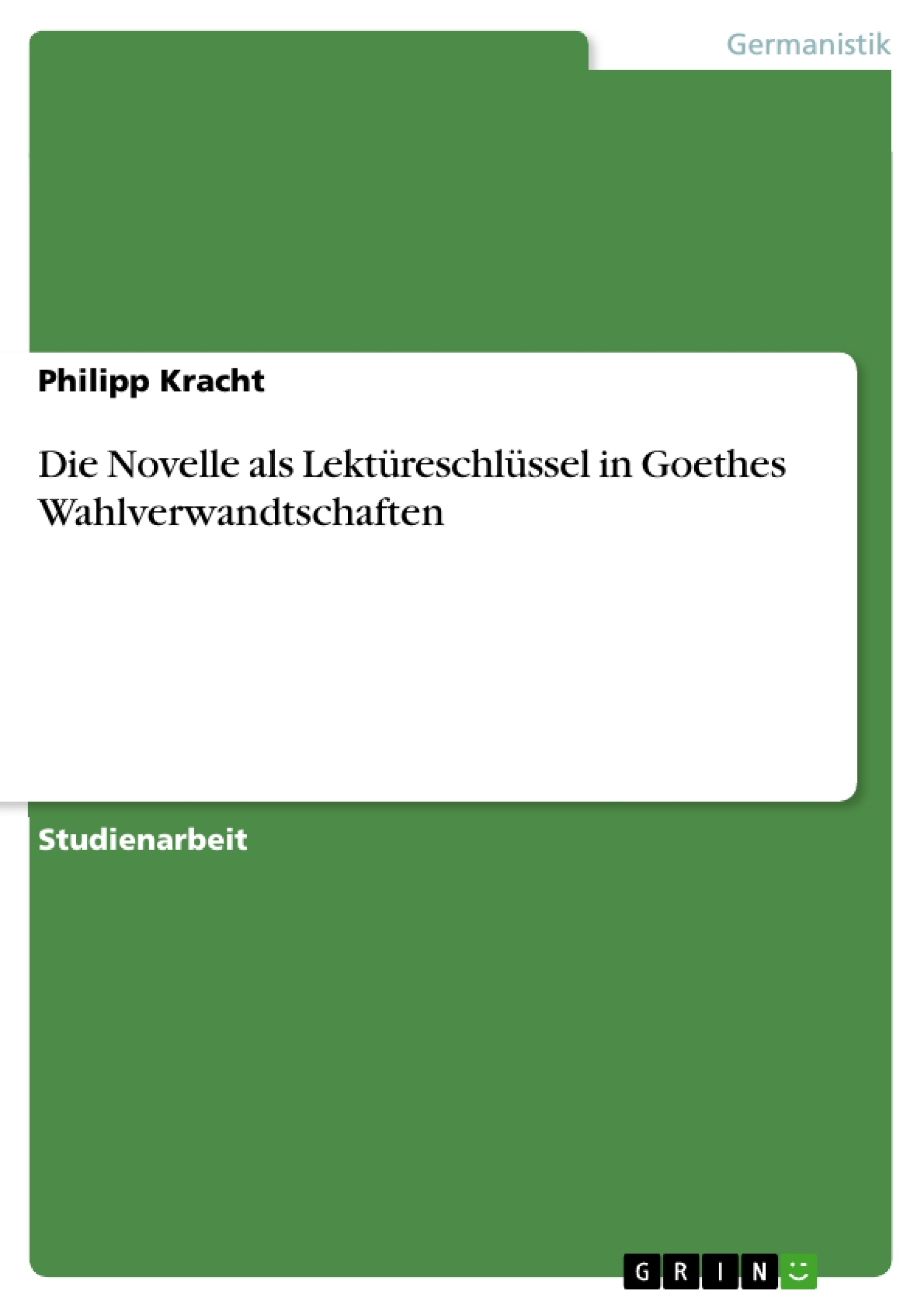Diese Hausarbeit im Rahmen des Goethe-Proseminars im Sommersemester 2008 befasst sich mit der Novelle Die wunderlichen Schulkinder in Goethes Roman Die Wahlverwandtschaften aus dem Jahr 1805.
Neben einer kurzen Darstellung der Struktur und des Inhalts der Novelle, welche sich im zehnten Kapitel des zweiten Teils befindet, soll zunächst geklärt werden, inwiefern es sich hierbei um eine mise en abyme handelt, und wie diese im Bezug zum Haupttext steht. Es soll ferner überprüft werden, inwiefern sie mit dem Roman als solchem, seiner Handlung, interagiert.
Im weiteren Verlauf wird primär darauf hin gearbeitet, zu entschlüsseln, inwiefern Goethe dem Leser mit der Novelle eine Interpretationshilfe an die Hand geben will. Insbesondere soll gezeigt werden, dass gerade durch die von anderen Literaturwissenschaftlern wie Benjamin oder Wiethäuser oftmals als Antithese dargestellte Novelle, die Hauptfiguren in den Wahlverwandtschaften noch wesentlich genauer charakterisiert werden und außerdem bestimmte Thematiken, wie die der Ehe oder des freien Willens umgedeutet oder erweitert werden können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum reinen Inhalt der Novelle
- Kurzzusammenfassung
- Anmerkung zur Zusammenfassung
- Theorie zur Novelle und der Spiegelung
- Die Novelle bei Goethe
- Lucien Dällenbach in „Le recit spéculaire"
- "Die wunderlichen Nachbarskinder" einfach nur als Positiv des Romans?
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Verliebten in der Novelle mit den Protagonisten des Romans
- Eduard und Charlotte: nur auf den ersten Blick die Nachbarskinder ...
- Der Hauptmann als Retter in Novelle und Roman - mit entscheidenden Unterschieden.
- Was die Novelle über Thematiken des Romans aussagen kann......
- Zum Erzähler der Novelle.....
- Der Nachbarsjunge ohne freien Willen?. _
- Die Novelle zur Ehe
- Ergebnisse & Fazit ......
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Novelle „Die wunderlichen Schulkinder“ innerhalb von Goethes Roman „Die Wahlverwandtschaften“. Sie untersucht die Funktion der Novelle als mise en abyme und ihre Interaktion mit dem Haupttext. Die Arbeit beleuchtet, wie die Novelle als Interpretationshilfe für den Roman dient und die Charakterisierung der Hauptfiguren sowie Thematiken wie Ehe und freier Wille erweitert.
- Die Funktion der Novelle als mise en abyme
- Die Interaktion der Novelle mit dem Haupttext
- Die Novelle als Interpretationshilfe für den Roman
- Die Erweiterung der Charakterisierung der Hauptfiguren durch die Novelle
- Die Umdeutung und Erweiterung von Thematiken wie Ehe und freier Wille durch die Novelle
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Novelle „Die wunderlichen Schulkinder“ als Gegenstand der Analyse vor und skizziert die Forschungsfragen der Arbeit. Sie beleuchtet die Bedeutung der Novelle als mise en abyme und ihre Interaktion mit dem Haupttext. Die Einleitung stellt die These auf, dass die Novelle als Interpretationshilfe für den Roman dient und die Charakterisierung der Hauptfiguren sowie Thematiken wie Ehe und freier Wille erweitert.
Der zweite Abschnitt widmet sich dem reinen Inhalt der Novelle. Er bietet eine Kurzzusammenfassung der Geschichte zweier Nachbarn, die in ihrer Kindheit eine enge Beziehung pflegen, sich dann aber in einer Hassliebe gegenseitig schaden. Getrennt aufwachsend, verlobt sich das Mädchen mit einem angesehenen Mann, während der Junge zum erfolgreichen Herrn heranwächst. Bei einem Wiedersehen erkennt die Verlobte ihre Liebe zum Nachbarn, doch er ist mit sich im Reinen und geht nicht auf ihre Andeutungen ein. Sie beschließt, sich vor seinen Augen das Leben zu nehmen, um ihn zu bestrafen und sich mit seiner Einbildungskraft und Reue zu vermählen. Als sie sich in den Fluss stürzt, rettet er sie mit Hilfe eines jungen Ehepaares. In die alten Hochzeitskleider des Ehepaares gekleidet, treten sie vor die Schiffsbesatzung und erbitten deren Segen.
Der dritte Abschnitt befasst sich mit der Theorie zur Novelle und der Spiegelung. Er beleuchtet Goethes Definition der Novelle als „unerhörte Begebenheit“ und zeigt, wie die Novelle „Die wunderlichen Schulkinder“ diese Definition erfüllt. Der Abschnitt diskutiert die Frage, ob die Geschichte als wirklich möglich angenommen werden kann, und beleuchtet die Tatsache, dass die Novelle für den Leser neu ist, aber für Charlotte und den Hauptmann bereits bekannt ist. Der Abschnitt bezieht sich auf Lucien Dällenbachs Theorie der mise en abyme und zeigt, wie die Novelle als Spiegelung des Romans fungiert, sowohl inhaltlich als auch formal.
Der vierte Abschnitt untersucht die Frage, ob die Novelle „Die wunderlichen Schulkinder“ als Positiv des Romans betrachtet werden kann. Er analysiert die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Verliebten in der Novelle mit den Protagonisten des Romans. Der Abschnitt beleuchtet die Figuren von Eduard und Charlotte sowie den Hauptmann als Retter in Novelle und Roman und zeigt die entscheidenden Unterschiede zwischen den beiden Texten auf.
Der fünfte Abschnitt untersucht, was die Novelle über Thematiken des Romans aussagen kann. Er analysiert den Erzähler der Novelle, die Frage des freien Willens des Nachbarsjungen und die Bedeutung der Novelle für die Thematik der Ehe. Der Abschnitt zeigt, wie die Novelle als Interpretationshilfe für den Roman dient und die Charakterisierung der Hauptfiguren sowie Thematiken wie Ehe und freier Wille erweitert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Novelle „Die wunderlichen Schulkinder“, Goethes Roman „Die Wahlverwandtschaften“, mise en abyme, Spiegelung, Interpretationshilfe, Charakterisierung, Ehe, freier Wille, Thematiken, Romananalyse, Literaturwissenschaft.
- Quote paper
- Philipp Kracht (Author), 2008, Die Novelle als Lektüreschlüssel in Goethes Wahlverwandtschaften, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/147014