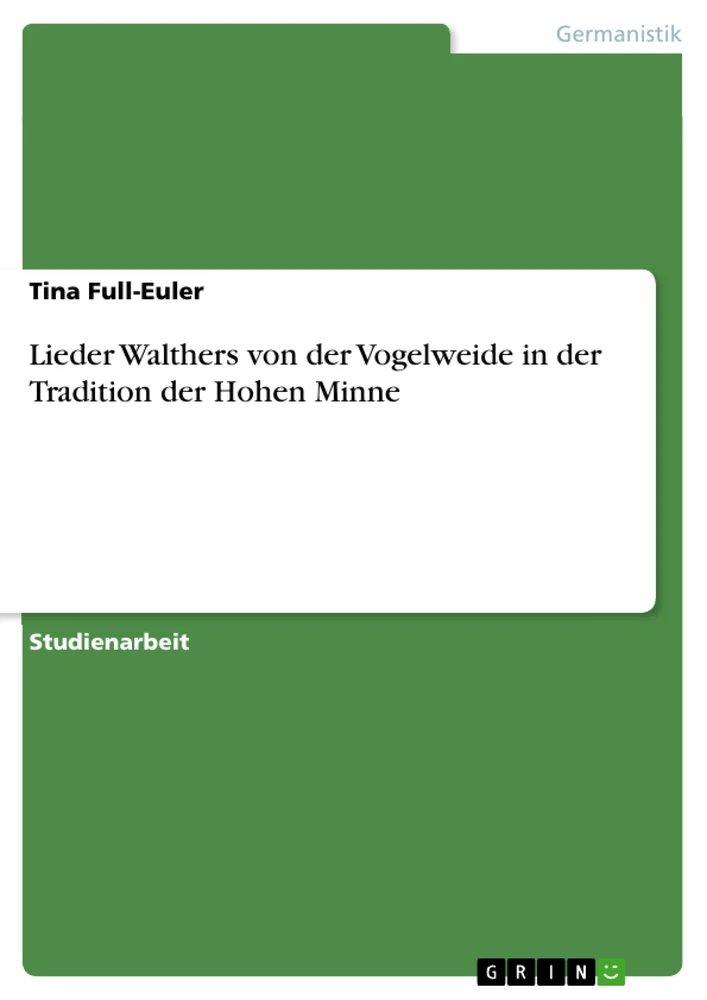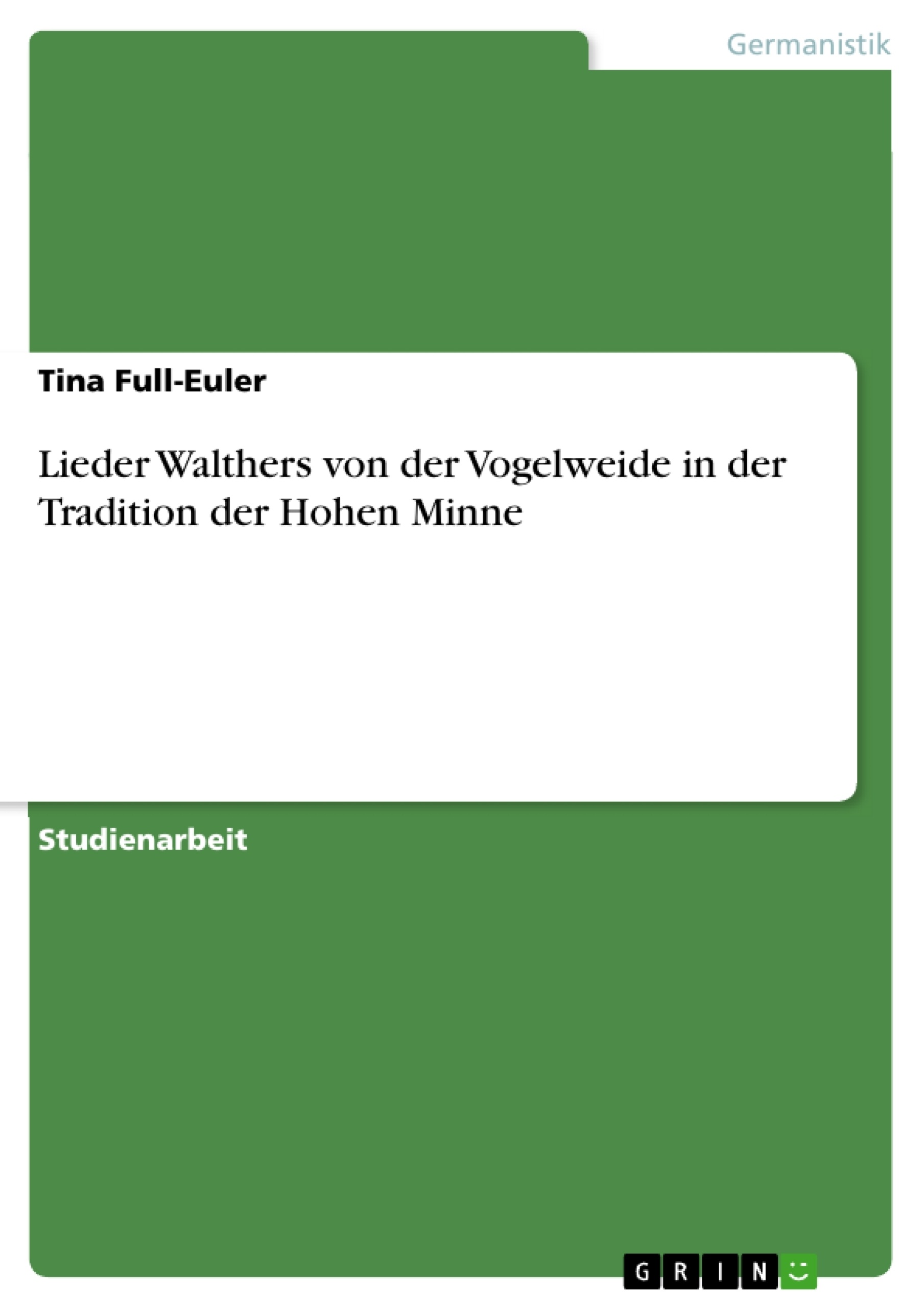Die in dieser Arbeit zu interpretierenden Texte in der Tradition der Hohen Minne werden dem frühen Walther, der noch unter Einfluss Reinmars singt, zugeordnet bzw. seinem Spätwerk, in dem er sich der Hohen Minne in neuem Kontext wieder zuwenden wird. Exemplarisch ausgewählt wurden als frühe Lieder „Hêrre got, gesegene mich vor sorgen“ und „Maniger frâget, waz ich klage“, als Lied im Kontext der „ebenen“ oder neuen Hohen Minne „Aller werdekeit ein füegerinne“.
Walther von der Vogelweide wird gleichgesetzt mit dem Höhepunkt und der Überwindung dessen, was als Hohe Minne bezeichnet wird. Eine lineare Entwicklung in Walthers Werk vorausgesetzt, kann man von einem Weg über Minnelieder im Stile Reinmars, die Walther zu einer Art „Vollendung“ bringt, zu Liedern der kritischen Reflexion des Minnekonzeptes sprechen: Neue Minnekonzeptionen werden entworfen, von den so genannten Mädchenliedern bis zur Rückkehr zur „ebenen“ oder neuen Hohen Minne.
Inhalt
1. Einleitung
2. Frühe Lieder Walthers in der Tradition der Hohen Minne
2.1 Zu Hêrre got, gesegene mich vor sorgen (L 115,6)
2.2 Zu Maniger frâget, waz ich klage (L 13,33)
3. Lieder Walthers der ebenen oder neuen Hohen Minne: zu Aller werdekeit ein füegerinne (L 46,32)
4. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Walther von der Vogelweide wird gleichgesetzt mit dem Höhepunkt und der Überwindung dessen, was als Hohe Minne bezeichnet wird.1Setzt man eine lineare Entwicklung in Walthers Werk voraus, dann kann man wohl von einem Weg über Minnelieder im Stile Reinmars, die Walther zu einer Art „Vollendung“2bringt, zu Liedern der kritischen Reflexion des Minnekonzeptes sprechen: Neue Minnekonzeptionen werden entworfen, von den sogenannten Mädchenliedern bis zur Rückkehr zurebenenoder neuen Hohen Minne. Allerdings bricht Walther nicht aus dem rationalen Minnediskurs aus wie etwa später Neidhart. Natürlich birgt dieser Ansatz einer impliziten Entwicklung Probleme, da Walthers Minnelieder in ihrer zeitlichen Abfolge schwer einzuordnen sind. Publikumsorientiert betrachtet, wäre jedes Lied zu jedem Zeitpunkt denkbar.3
Es mag sein, daß Walther im Laufe der Zeit von einer Minne-Konzeption zu einer anderen wechselte, daß sich also in verschiedenen Liedern literarische Entwicklungen spiegeln. Einige Äußerungen Walthers sprechen auch dafür, wenn er beispielsweise zurückblickt und auf Lieder früherer Zeit verweist. Es ist indes auch denkbar, daß unterschiedliche Konzepte eine synchrone Koexistenz hatten und daß lediglich Anlaß, Ort oder Publikum den Wechsel der Thematik motivierten.4
Doch ist jeder Text „Teil einer umfangreichen Textkultur“5und steht in intertextuellem Bezug zu anderen. Deswegen unterstellen folgende Interpretationen verschiedene Schaffensphasen Walthers; die zu interpretierenden Texte in der Tradition der Hohen Minne werden dem frühen Walther, der noch unter Einfluß Reinmars singt, zugeordnet bzw. seinem Spätwerk, in dem er sich der Hohen Minne in neuem Kontext wieder zuwenden wird. Exemplarisch ausgewählt wurden als frühe LiederHêrre got, gesegene mich vor sorgen(L 115,6) undManiger frâget, waz ich klage(L 13,33), als Lied im Kontext derebenenoder neuen Hohen MinneAller werdekeit ein füegerinne(L 46,32). Sie sind für ihre jeweiligen Phasen typisch und so diesem Ansatz recht eindeutig unterzuordnen. Problematisch wird der Ansatz bei Liedern, die Elemente aus verschiedenen zeitlichen Perioden Walthers verbinden und dadurch, was Zeitpunkt und Minnekonzeption betrifft, indifferent bleiben.
2. Frühe Lieder Walthers in der Tradition der Hohen Minne
„Eher konventionell“6und mit „einer Tendenz, diefröide-Möglichkeit zu betonen“7bezeichnet Hahn den frühen Sang Walthers. Konventionell meint hier, daß die für die Hohe Minne typischen Elemente überwiegen.
Typisch ist8der transzendente, vertikale Bezug zur Minne bzw. Dame, die festgelegte Rollenbeziehung zwischen lyrischem Ich und umworbener Frau, das Ungleichgewicht zwischen den Parteien: „Minnesang ist wesentlich Rollenlyrik“9, und die Rollenträger handeln in einem „[...] eigengesetzlichen poetischen Raum, in dem die männlichen und weiblichen Figuren wie auf einer Bühne nach bestimmten Ritualen agieren, rollen- und gattungstypisch sich äußern“10.
Die Dame bleibt namenlos und wird nach der platonischen Ideenlehre zur Repräsentantin der obersten Idee des Guten stilisiert. Durch ihre ethisch überhöhte Position rückt sie für das Ich als „Projektion seines Ideals“11in unerreichbare Ferne; trotzdem bietet es der Dame seinendienestan und hofft auf Lohn. „Aus dieser Unterwerfungsgeste resultieren ethische und gesellschaftliche Werte: Steigerung des Lebensgefühls und Anerkennung in der Gesellschaft.“12Davon kann nun auch die Gesellschaft wiederum profitieren. Somit ergibt sich eine paradoxe Grundhaltung: Treue trotz ausbleibenden Lohnes. Deswegen ist der Sang der Hohen Minne eine Lyrik der unerfüllbaren Liebe, er ist Leidsang und zugleich Bewährungsminne. Der Hohe Sang betont im Gegensatz zum frühen Minnesang statt der äußeren die inneren Hemmnisse, die die Kontaktaufnahme zur Frau so schwierig werden lassen. Dadurch wird die „ursprüngliche Geschlechterbalance“13aus dem Gleichgewicht gebracht.
Die unterschiedliche Akzentuierung von Thematiken und Motiven machen aus dem Minnesang eine Variationskunst.14Je nach Betonung überwiegt dann Dienstminne, Frauenpreis, Leidsang,wân-Minne, Entsagungsminne, Läuterungsminne oder Kompensationsminne.
Walther modifiziert literarische Welten, ihre Strukturen, ihr Personal. Der Mann ist nicht mehr der bedingungslos Dienende, die Frau nicht mehr die bedingungslos Fordernde.15
Von diesem Paradigmenwechsel spürt man in Walthers Frühwerk noch sehr wenig, wenngleich sich im Vergleich mit Reinmar durchaus schon feine Unterschiede erkennen lassen.
Die LiederHêrre got, gesegene mich vor sorgen16(L 115,6) undManiger frâget, waz ich klage17(L 13,33) zählen im Allgemeinen zu Walthers Frühwerk in der Tradition der Hohen Minne. Im Folgenden sollen diese Texte interpretiert werden, und die Tradition, für die sie gattungstypisch stehen, ist mit ihren unterschiedlichen Akzentuierungen herauszuarbeiten.
2.1 Zu Hêrre got, gesegene mich vor sorgen (L 115,6)
Das MinneliedHêrre got, gesegene mich vor sorgenist isostrophisch gebaut und gehört zu den subjektiven Gattungen18, d. h., es spricht ein lyrisches Ich, keine typisierte Figur und nicht etwa der Dichter. Es zählt zu einer der häufigsten Gattungen der Minnelyrik19: dem Minne- oder Werbelied, meist als monologische Aussprache eines männlichen lyrischen Ichs. Bei dem zu betrachtenden Minnelied handelt es sich um ein indirektes Werbe- oder Klagelied bzw. eine Minneklage. Es richtet sich nicht unmittelbar mit direkter Adressierung an eine Frau. Zum Publikum kann - wie in diesem Fall - Kontakt aufgenommen werden.
Trotz der Unnahbarkeit der Frau bietet ihr der Mann seinendienestan, was natürlich eng mit seinen Lohnerwartungen verknüpft ist. In diesem Text wird als zu erwartender Lohn ganz klar diefröide-spendende Kraft der Frau wegen ihrer inneren Werte und ihrer äußeren Schönheit hervorgehoben. Auch dieses Phänomen ist typisch für den Hohen Sang, denn zumeist ist Frauen- bzw. Minnepreis mit Minneklage verbunden.20
Was die Strophenform betrifft, verwendet Walther dem rationalen Grundduktus entsprechend die Stollen- oder Kanzonenstrophe nach romanischem Vorbild, ein rationales Gebilde durch ihre zweiteilige Bauweise. Sie entwickelt sich zu der Form der Lyrik der Hohen Minne, ist sie doch zugleich klar strukturierbar und variabel zu handhaben: klar strukturierbar durch die zwei metrisch und musikalisch gleich gestalteten Stollen des Aufgesangs, variabel durch den Abgesang, der keinerlei Gesetzen unterliegt.21
Hêrre got, gesegene mich vor sorgen(1,1): Wie ein Gebet beginnt die Minneklage mit der Apostrophe Gottes, ein Stilmittel zur Verlebendigung und Veranschaulichung. Gerade als ob sich der Werbende, das lyrische Ich seiner Erhörung und Glücksfindung in der Minneidee nicht sicher sein dürfte. Im Kontext der Hohen Minne bedeutet diese Anrede eine relativierende Komponente. Doch gleich darauf ist das Ich sich wieder sicher: Es nimmt mit einer Frage, die keine rhetorische ist, den Kontakt zum Publikum auf (1,2 f.) und bietet einen imaginären Tauschhandel der Freude. Die Begegnung von Publikum und Ich kann man also als glückstiftend und emotional beschreiben. Das Ich muß folgerichtig über eine wunderbare Freudenquelle verfügen, schließlich erhofft es sich von seinem Tauschhandelein teil(1,8) zurück und ist sich dabei ziemlich sicher, woher sein Glück nehmen. In der zweiten Strophe wird die Freudenquelle genannt:Al mîn fröide lît an einem wîbe(2,1).
Daß auch ihm Glück aus der Tauschbeziehung zukommt, davon ist das Ich überzeugt, denn es hat viel einbezahlt:wan ich liez ir wunder dâ(1,6) und hat also allen Grund, auf Gegenleistung zu hoffen. Entsprechend rational drückt sich der Minnende auch aus:mit sinnen(1,7), ‘mit Klugheit’ - so übersetzt Schweikle - erhofft er sich sein Glück. Dieses Glück hätte dann wiederum positive Wirkung auf die Gesellschaft, der Sänger möchte es eintauschen und verhilft so der Gesellschaft zur Vollkommenheit. Hier wird der kompensatorische Aspekt der Minne in den Vordergrund gestellt. Die Dame steht im gesellschaftlichen Kontext, das Ich spricht über die Dame im Hinblick auf die Gesellschaft.
Das rationale Momentmit sinnenverweist schon auf den rationalen Umgang mit dem Liebesphänomen, das hier für die Gesellschaft intellektuell verarbeitet wird. Konsequenterweise können Emotionen nur als Gegenstand der Reflexion ausgedrückt werden. Damit steht dieses Lied im philosophisch-rationalen Diskurs der Hohen Minne, es ist rationales Konstrukt in einem ästhetisch-fiktionalen Raum.
Die zweite Strophe beginnt mit Frauenpreis. Beschrieben wird eine Frau,
der herze ist ganzer tugenden vol,
und ist sô geschaffen an ir lîbe,
daz man ir gerne dienen sol.(2,2-4)
Durch ihre ethische und äußere Vollkommenheit, durch ihre Existenz ruft die Fraufröidein dem Ich hervor, aber auch die Dienstminne trägt ihren Teil dazu bei. Damit rechtfertigt das Ich seinendienest, der sich zwangsläufig und damit geradezu auf existentielle Weise durch das Wesen der Frau ergeben muß. Das Dienstangebot „als Bild für die Unterwerfung des Liebenden“22zählt - wie schon erwähnt - zu den Hauptthemen des Hohen Minnesangs. Die Dienstmetaphorik leitet sich ab aus der für das Mittelalter charakteristischen Lehensstruktur und weckt „Assoziationen zur Sphäre sozialen Rechts“23: der Mann als ein von der Frau Abhängiger und ein auf Lohn Hoffender. Dabei ist es seine Rolle, „[...] den Dienst an sich zu rechtfertigen, zu erhöhen, zu sublimieren, ihn darüber hinaus als Bild einer existentiellen Problematik der Gesellschaft bewußt zu machen“24.
Die umworbenen Frauen des Minnesangs werden immer mehr spiritualisiert und wirken merkwürdig „passiv-schemenhaft“25.
Die Frauengestalten des Hohen Sangs sind also eher Hypostasierungen von Wertvorstellungen und Seinsproblemen als Abbilder realer Weiblichkeit.26
Auch wenn Bein betont, die Frau werde in Walthers Minnesang mehr und mehr entworfen27, erscheint sie in diesem Lied nach der Tradition der Hohen Minne noch formelhaft, sowohl was die äußere als auch die innere Schönheit betrifft. Beide Eigenschaften gehören nach der antiken ‘kalokagathia’ zusammen.28Die Begriffetugende(2,2) undgüete(2,8) verweisen auf die innere Vollkommenheit der Frau. Sie verkörpert das wahrhaft Gute, die Idee des Guten und ist als „säkularisiertes summum bonum der menschlichen Vollendung“29Gott gleichgesetzt, und damit hypertroph. Diese inneren Werte und ihr äußeres Erscheinungsbild erzwingen den Dienst, werden also in Abhängigkeit desselben beschrieben und mit ihm in Bezug gesetzt. Deshalb reicht auch die karge descriptio mit ethisch schwerbeladenen Begriffen aus: Die Frau als das absolut Ideale fordert die absolute Abhängigkeit,daz man ir gerne dienen sol(2,4).
ich erwürbe ein lachen wol von ir,
des muoz si gestaten mir,
wie mag siz behüeten?
ich fröiwe mich nâch ir güeten.(2,5 ff.)
Wie in der ersten Strophe ist sich das Ich sicher, Gutes von der Frau erwarten zu können, denn wie kann sie es verhindern, wenn sie doch das Gute repräsentiert und als Glücksspenderin prädestiniert ist? Gleichzeitig aber steht sie als Idee mit ihrer transzendenten Dignität über dieser Vorstellung und wird dem Ich auf einer psychisch-emotionalen Ebene unerreichbar. In diesem Spannungsverhältnis von ungebrochener Freude und Leiderfahrung befindet sich das Ich. Der Aspekt des Leidsangs tritt stärker hervor, endet aber mit der Bekräftigung:ich fröiwe mich nâch ir güeten.Auf der Ebene der reinen Erkenntnis ist die Glückserfahrung möglich, sie ist reflexiv erfahrbar durch die Vergegenwärtigung dergüeteder Dame.
Die umstrittene Stelleich erwürbe ein lachen wol von irübersetzt Schweikle: ‘Ich würde gern ein Lächeln von ihr gewinnen’, geht also von einem Lachen der Dame aus, wenngleich ebenso das Lachen, die Freude des Ichs gemeint sein könnten. Er begründet im Kommentar seine Übertragung dadurch, daß in einem Lied, das durchweg traditionelle Motive reihe, das geläufige Motiv des erbetenen Zulachens eher zu erwarten sei.30Doch auf der Erkenntnisebene - und nur diese Ebene zählt - kann die Dame als Idee des Guten die Freude des Ichs nicht verhindern, das Ich selbst schließlich freut sich in (2,8) und hofft auf diese Freude in eben zitiertem Vers. Das spirituelle Glückserlebnis aus der Idee des Guten läuft völlig einseitig ab, nur um den Werbenden geht es. In diesem Kontext erscheint sein Lachen wahrscheinlicher.
Was idealiter, auf der Ebene der reinen Erkenntnis in der zweiten Strophe möglich wird, ist realiter, auf der Ebene der psychischen Erfahrung in der dritten Strophe zum Scheitern verurteilt. Diese beiden Strophen stehen sich dialektisch gegenüber. Die Dialektik ist durchaus typisch für den hohen Minnesang: „Die Minnelyrik entfaltet sich dialektisch: Ein Begriff evoziert einen Gegenbegriff, eine Situation eine Kontrasituation.“31
Als ich under wîlen zir gesitze,
sô si mich mit ir reden lât,
sô benimt si mir sô gar die witze,
daz mir der lîp alumbe gât.(3,1-4)
Wenn das Ich seiner Dame in einer konkreten Situation gegenübersitzt, verwirrt das seine Sinne und es ist des Sprechens nicht mächtig. In einem Modell, in dem ein rationaler Umgang mit dem Liebesphänomen gepflegt wird und Emotionen nur als Gegenstand der Reflexion ausgedrückt werden können, muß die ratio in der Umsetzung einer konkreteren Situation versagen: Die Frau raubt dem Ichdie witze, es kann nicht mehr wie in der ersten Strophemit sinnendenken. Der Sinnenverlust bleibt in das ideologische Gesamtkonzept eingebettet, steht er doch für die Begegnung mit einer Gottheit, personifiziert in der absolut gesetzten Dame.
Konsequenterweise muß man festhalten, daß das rationale Grundkonzept der Hohen Minne in der dritten Strophe nicht aufgegeben wird; die ideologisch-rationale Ebene kann somit nicht verlassen werden. Es ist ein intellektueller Versuch des Ichs, der, wenn es seinem Konzept treu bleiben möchte, scheitern muß. Der Ebenenwechsel wird nur scheinbar vollzogen, um den unmöglichen Ausbruch aus dem konstruierten System aufzuzeigen. Minne ist ein absoluter Wert, der emotional nicht erfüllt werden kann. Das verhindert natürlich auch die positivefröide-Wirkung der Minne auf der Ebene der psychischen Erfahrung, weil die positiven Wirkungen „[...] weitgehend nur begrifflich dargestellt [werden], da sie meist utopisch sind, nur ausgedacht werden können“32.
swenne ich iezuo wunder rede kan,
gesihet si mich einest an,
sô hân ichs vergezzen,
waz wolde ich dar gesezzen.(3,5 ff.)
Dierede/ratio verstummt vor der Frau, mit ihr ist der Diskurs nicht möglich, denn sie selbst ist ein rationales Konstrukt. Als solches wird sie auf diese Art entlarvt.
Das für die Hohe Minne typische Moment des Verstummens in Gegenwart der transzendent-verklärten Dame - bereits ein Ovidsches Element - findet sich auch bei Morungen (MF 135,19; 136,15; 141,32) und bei Reinmar (MF 153,23; 164,21).33Bein interpretiert in diese Szene, Walther spiele mit dem Typ ‘Klage’ und meine nicht mehr so ganz ernst, was er sagt. Die dritte Strophe biete ein ‘kurioses Szenarium’.34Mag sein, daß diese letzte Strophe in manchen Aufführungssituationen im Sinne vonprodesseunddelectareironisch oder komisch wirkte, doch nach Interpretation dieses Liedes am Text kann diese Sichtweise nicht bestätigt werden. Walther zeigt durch den Versuch eines Ebenenwechsels, daß diefröidenur reflexiv zu erreichen ist, die Dame wird so indirekt als selbstgeschaffenes rationales Gebilde offenbart, ohne dabei die Zirkelstruktur der Hohen Minne zu durchbrechen.
Nimmt man als Interpretationshilfe die ersten beiden Zeilen des Textes hinzu:Hêrre got, gesegene mich vor sorgen, / daz ich vil wunneclîche lebe!, auf die ja auch das Moment der Sinnenverwirrung vor einer Gottheit verweist, so kann dies diese Auffassung nur bestätigen: Im Bereich der absoluten Wertsetzung, dazu gehören die Gottes- und Minneidee, erscheint das Glück erreichbar, denn weder Gott noch Dame können als summum bonum auf der Ebene der Imagination das Glück verhindern. Walther denkt durch diese reflektierte Realitätsverdrängung, die noch dazu in gesellschaftlichem Kontext steht, über die Schablone hinaus, sind die Abweichungen von der Tradition der Hohen Minne auch nur marginal.
2.2 Zu Maniger frâget, waz ich klage (L 13,33)
Mit anderem Schwerpunkt greift das MinneliedManiger frâget, waz ich klagedie Dialektik zwischen Idealität und Realität wieder auf. Schweikle erkennt in ihm den Stil Reinmars wieder35, die traditionellen Motive seien jedoch neu kombiniert und in neuer Beleuchtung vorgetragen36. Von Kuhn wird es als „[...] ’Jugendlied’ eingeordnet wegen des ‘unspezifischen’ Inhalts und der ‘trockenen’ Deduktion“37. Damit steht Kuhn in der Tradition der älteren Forschungsmeinung nach Burdach und von Kraus.38Anders urteilt Wenske: Für ihn steht dieses Lied als ‘Schwellentext’ am Ende einer Minneliedtradition im Stile Reinmars. Obwohl dieser durchaus noch verhaftet, biete es mit seinem „’transitorischen’ Charakter“ und der „’rhetorischen Überarbeitung’ herkömmlicher Strukturen“ einen „’systemimmanenten’ Ausweg“39aus dem starren Konzept der Hohen Minne.
Wie L 115,6 ist auch dieses Lied mit seiner monologischen Struktur der Gattung Minne- oder Werbelied in Kanzonenform zuzuordnen, wie L 115,6 ist es isostrophisch gebaut, in Kanzonenform geschrieben und gehört zu den subjektiven Gattungen. Allerdings finden sich auch direkte Anreden sowohl derfrouwe minne(2,6) als auch der Dame (5,5), und so wird der Text zum direkten Werbe- oder Klagelied, das der indirekten Minneklage thematisch und modal entspricht. Es ist „[...]nurRollenspiel, nur eine formale Variante ein- und derselben lyrischen Fiktion [...]“40. „Anredelieder enthalten Bitten um Erhörung.“41
Das Lied erweist sich als Mischtyp: Minneklage, -preis und -didaxe sind auf geschickte Weise miteinander verknüpft. Ohne Zweifel ist dieser Text also im Konzept der Hohen Minne etabliert; inwiefern er als ‘Schwellentext’ gelesen werden kann, soll im folgenden am Text näher beleuchtet werden.
Maniger frâget, waz ich klage
unde giht des einen, daz es iht von herzen gê.(1,1 f.)
Das Ich beginnt seine Klage mit dem Bezug auf Publikumsmeinungen, ein Mittel zur Verlebendigung. Es eröffnet einen gesellschaftlichen Diskurs: Die Gesellschaft oder besser die „rhetorisch entwickelte ‘Gegenpartei’“42wirft ihm vor, die Klage sei nicht aufrichtig, man sei ihrer überdrüssig. Dieser ‘Vorwurf der unaufrichtigen Klage’ findet sich auch bei Reinmar (MF 165,19), der ‘Aspekt des Überdrusses der Gesellschaft’ bei ebendemselben (MF 165,12) und bei Morungen (MF 133,21).43Es sind vertraute Elemente des Sangs der Hohen Minne.
Der Zweifel von Seiten des fiktiven Publikums an der Echtheit der Minneklage bedeutet gleich zu Anfang einen Bruch mit der Fiktion44: Anscheinend kommt die Klage nicht so an, wie erwünscht, zu deutlich ist der Spielcharakter. Deswegen muß sich das Ich rechtfertigen, die Aufrichtigkeit seiner Klage bekräftigen und fiktive Zweifel abwehren.
der verliuset sîne tage,
wand im wart von rehter liebe weder wol noch wê.(1,3 f.)
Nur dierehte liebezählt und kann sowohl positive wie auch negative Emotionen hervorrufen. Diesesweder wol noch wêbezieht sich auf ein bekanntes Moment der Hohen Minne: Minne als ein ambivalentes Phänomen, in dem Freude und Leid eng miteinander verknüpft sind. Der Minnende empfindet Leid, weil die Dame unerreichbar bleibt, empfindet Freude, weil sie als Idee des wahrhaft Guten ihm ihre glückspendende Kraft auf der Ebene der reinen Erkenntnis nicht verwehren kann. Nur wer dieser Minneauffassung folgt, erfährt das vollkommene Glück:des ist sîn gelücke kranc(1,5).
swer gedæchte,
waz diu minne bræchte,
der vertrüege mînen sanc.(1,6 ff.)
Das Ich begibt sich auf die dominierende Erkenntnisebene. Wer nicht versteht, hat keine Erfahrungs- oder Erkenntnisleistung. Diese Dialektik wird gelöst, begibt man sich auf die intellektuelle Ebene:swer gedæchte . . .
Schon an anderer Stelle war von der zunehmenden Stilisierung und Ritualisierung bis zur „bloßen Schablone“45der Hohen Minne die Rede.
Die ständige Klagegebärde und masochistisch wirkende Selbstverleugnung in den Hohe-Minne-Liedern forderten jedoch auch Überdruß und Spott heraus [...].46
Gerade Reinmar war ein Meister dieser Art Lieder. Bei ihm führt die Kritik der Gesellschaft von außen ‘in die Isolation’ des Ichs.47
Auf jede Kritik ‘von außen’ folgt eine noch sublimere, ‘höfischere’ Demonstration des gerechtfertigten und als sittlich-ethisch positiv erachteten Klagens und Leidens.48
Aus dieser Zirkelstruktur gibt es keinen Ausweg mehr, das Ich scheint gezwungen, in der Metapher zu verharren. Durch ihre Aporie wäre dann die Kunst des Minnesangs ad absurdum geführt, die innere Krise des Minnesangs nicht aufzuhalten. Während Reinmar nach Wenske auf dieses Problem nur eine ‘systemimmanente Anwort’ gebe, biete Walther in L 13,33 einen ‘systemimmanenten Ausweg’ durch bewußte Anknüpfung an in diesem Text bereits herausgearbeitete Traditionen und deren rhetorische Überarbeitung.49
Anders als Reinmar flüchtet Walthers Ich nicht in die Innerlichkeit, sondern geht das Publikum in der „Flucht nach vorn“50direkt und mit deutlicher Sprache an: Ein „stark rhetorisch geprägter, ungleich direkterer Stil“51ersetzt die traditionelle „feinsinnige, anspielungsreiche, implizite Didaxe“52der Hohen Minne. Hier spricht nicht nur der Minnende, sondern auch der Minnesänger als Didaktiker auf einer „‘meta-kommunikativen’ Ebene“53, die es ihm möglich macht, über Minnesang und die Art, wie er ausgeführt wird, mit dem Publikum zu kommunizieren. Der Klagegestus der ersten Strophe wird neben der traditionellen Minneklage mit der Klage über die Minne und deren Realisierung bereichert. Deswegen auch die Kritik der älteren Forschung, der Text beschäftige sich viel mehr mitminneals mit der zu verehrenden Dame.54
Der Aufgesang der zweiten Strophe enthält zunächst allgemeine Ausführungen über dieminne.Sie steht zwischen idealem Anspruch und unangemessener Realisierung:Minne ist ein gemeinez wort / und doch ungemeine mit den werken, dêst alsô.(2,1 f.) Dieser ‘Gegensatz zwischen Wort und Tat’ ist ein bekanntes Minnesangthema (z. B. bei Hartmann MF 218,14)55und wird in Walthers späterem Werk noch deutlicher in den Vordergrund treten. Dieminnebietet die ganze Fülle der Tugend und ist als Wert mit der Kategorie derfröidefest verbunden:minne ist aller tugende ein hort, / âne minne wirdet niemer herze rechte frô(2,3 f.). Als Didaktiker legt hier das Ich definitorisch fest, wasminnesei, ohne sich auf Quellen zu berufen:dêst alsô.
Im Abgesang schlüpft das Ich in die Rolle desrehtenMinners, der dierehte liebeder ersten Strophe umsetzt.
sît ich den gelouben hân,
frouwe Minne,
fröit ouch mir die sinne!(2,5-7)
Dabei steht das Ich auf der Seite des Idealen; darauf verweist schon der Begriffgelouben, der die Hohe Minne gleich der Religion einem objektiven System zuweist. Deutlich zu erkennen sind die Wechselbeziehungen zwischen der Minne- und Marienlyrik. Ebenso kann der Kunstgriff der Personifikation bzw. der Allegorisierung des abstrakten Minnebegriffs zurfrouwe minnegesehen werden, eine Variante als deren Schöpfer Walther gilt56: In ihr wird die Idee der Frau angesprochen, die als Allmächtige, als „Sinnbild einer supra-realen Macht“57über Glück und Leid entscheidet, und damit ganz klar rationales Konstrukt ist. Andererseits kann das Ich auf diese Weise im „Fiktionsspiel“58mit der Idee des Guten in Kontakt treten, indem es sie scheinbar von der abstrakten Ebene distanziert.
Nach der für die Hohe Minne typischen Bitte um Freude (hier: um die Freude aus der sinnlichen Minne59) ist das Ich sich wieder unsicher; es steht in einem Spannungsverhältnis, da es dieminneerkennt und sich durchaus alsrehtenMinner versteht, aber trotzdem nicht froh sein kann:mich müet sol mîn trôst zergân(2,8). Stark rhetorisch geprägt und argumentativ vorgehend wird das Ich im Folgenden nach dem Grund für seine Zweifel forschen, den es in (2,2 f.) schon andeutete.
Auch die zweite Strophe zeigt wieder die von Wenske in den Vordergrund gestellte rhetorische Überarbeitung:
Wo das Ich in Reinmars Lied [MF 187,31 ff.] sich augenscheinlich schwer tut, der Gesellschaft das eigene Leiden als Positivum ‘anzudienen’ und sich selbst als Identifikationsfigur eines ‘rehten’ Minners darzubieten [...], da braucht Walthers Ich im Rahmen der skizzierten Gesamtperspektive des Liedes ‘einfach’ in die Rolle des zuvorin abstractobeschriebenen ‘rehten’ Minners zu schlüpfen, ohne langwierige, den ‘Identifikationsprozeß’ allem Anschein nach [...] behindernde Leidensbekundungen [...] nötig zu haben.60
Die dritte Strophe läßt sich mit Wenske als traditionelles Zentrum begreifen, „[...] um das herum der Sänger mit den beschriebenen Mitteln die überkommene Struktur aktualisierend funktionalisiert [...]“61. Das Ich führt seine persönlich umworbene Frau ein.
Mîn gedinge ist, der ich bin
holt mit rehten triuwen, daz si ouch mir daz selbe sî.
triuget dar an mich mîn sin,
sô ist mînem wâne leider lützel fröiden bî.
neinâ hêrre! si ist sô guot,
swenne ir güete
erkennet mîn gemüete,
daz si mir daz beste tuot.(3,1 ff.)
Traditionell ist der Aufbau der Strophe: Auf- und Abgesang stehen sich als rhetorisches Mittel der Kontrastierung dialektisch gegenüber. Im Aufgesang ist sich das Ich noch unsicher, die Gunst der Dame erlangen zu können. Typisch ist das dafür verwandte Vokabular: Das Ich hat noch Hoffnung,gedingeauf Erhörung, denn schließlich lebt es inrehter triuwezu seiner Dame. Doch die Angst bleibt, einerwân-Minne in leidvoller, vergeblicher Hoffnung ohnefröideanheimgefallen zu sein. Die Minne als nie enden wollende Hoffnung findet sich oft bei Reinmar.
Auch die revocatio in (3,5) des Abgesangs hat eine fast wörtliche Parallele bei Reinmar (MF 160,37).62Die Zweifel im Aufgesang werden verworfen: Die Dame muß mit absoluter Gewißheit ihr Bestes geben, ist sie doch das absolut Gute. Damit erinnert diese Strophe in ihrem Aufbau und Inhalt an die zweite Strophe des zuvor analysierten Gedichtes L 115,6, die ebenfalls die Mitte darstellte. Einen wichtigen Unterschied gibt es allerdings: In L 13,33 kann die Frau nur Freude spenden,swenne ir güete / erkennet mîn gemüete.Dies bedeutet eine Einschränkung, ein relativierendes Moment des Konzeptes der Hohen Minne und zeigt gleichzeitig, wie auch diese Strophe, obwohl mit der Einführung der Dame traditionelles „inneres Bezugsfeld“63des Liedes, in den argumentativen Gesamtzusammenhang eingebettet ist. Die Zeilen verweisen wiederum auf den Grund des ausbleibenden Lohnes, der nicht im Verhalten der Dame zu finden ist; sie bleibt unangetastet. „Es liegt im Erkennen oder eben Nicht-Erkennen eines aufrichtigen Dienstes, in der (Un-)fähigkeit der Dame, zwischen ‘wahren’ und ‘falschen’ Minnern zu unterscheiden.“64
Die dritte Strophe leitet mit ihrer Einschränkung direkt zur vierten über, nach Wenske mit ihrer stark kritisch-didaktischen Prägung das argumentative Zentrum des Textes.
Wiste si den willen mîn,
liebes unde guotes, des wurde ich von ir gewert.
wie möhte aber daz nû sîn,
sît man falscher minne mit sô süezen worten gert?(4,1-4)
Des Übels Wurzel liegt also im gestörten gesellschaftlichen Umfeld, der gesellschaftliche Horizont stört dierehteMinne und die Freude; der pervertierte gesellschaftliche Sittenkodex ist Störfaktor der Kommunikation zwischen Dame und Minner.65Damit hat das Ich die Erklärung für seine Leiderfahrung und den Grund für seine Klagehaltung gefunden. Im Abgesang weitet das Ich als Autorität in Sachen ‘Minne’ seine Erkenntnisleistung generalisierend auf alle Frauen aus:
daz ein wîb niht wizzen mac,
wer si meine,
disiu nôt aleine
tuot mir manigen swæren tac.(4,5 ff.)
Nur allein diesenôtist für das Leid verantwortlich. Das hat zur Folge, daß „[...] der das ganze Lied einleitende Klagegestus in bisher unbekannter Weise argumentativ dingfest gemacht wird [...]“66, indem das Ich den Grund des Klagens explizit nennt und seine Klage in Anklagen umformt; das selbstvergessene Trauern ist somit nicht mehr nötig, ein Weg aus dem „’paralytischen’ Zustand des Minnesangs“67scheint gefunden.
Die fünfte Strophe beginnt mit einer Analogie zum Sündenfall, einer Sündenfallvorstellung in säkularisierter Umformung. In ihrem Aufbau zeigt sie Parallelen zur zweiten Strophe.
Der diu wîp alrêrst betrouc,
der hât beide an mannen und an wîben missevarn.
ichn weiz waz diu liebe touc,
sît sich friunt gegen friunde niht vor falsche kan bewarn.(5,1-4)
Diese Sündenfallumformung verdeutlicht nochmals den Kontrast zwischen verbalem Bewerten und innerem Verhalten; sie zeigt eine grundsätzliche Pervertierung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Die Liebe als transzendentes Moment steht der Gesellschaft dialektisch gegenüber. Mit (5,3 f.) wird die Aussage, daß die Dame sich der echten Liebe nicht mehr sicher sein kann, weil Wort und Verhalten auseinanderfallen, auffriunt gegen friundeerweitert.
Im Abgesang wendet sich das Ich durch eine Apostrophe wieder derfrouwezu:
frouwe, daz ir sælic sît!
lânt mit hulden
mich den gruoz verschulden,
der an friundes herzen lît.(5,5 ff.)
Wieder zeigt sich die Nähe zur christlichen Terminologie: Das Ich appeliert an diesældeder Frau, die Sünde aufzuheben. Diesældeläßt das Ich hoffen, daß die Frau die Aufrichtigkeit seiner Liebe erkenne. Als Lohn, als Geste der Zuneigung erwartet es den für die Hohe Minne typischengruoz.Dieser steht für die noch vorhandene Distanz zwischen Dame und Minner. So endet dieses Minnelied nicht mit Klagen, sondern das Ich ist zuversichtlich hoffend und kann als „positive, nicht ob ihres permanenten Leidens ‘unglaubwürdige’ (‘manieristische?’) Identifikationsfigur“68dienen.
Die Idee der Hohen Minne wird in diesem Text an keiner Stelle in Frage gestellt, ebenso gibt es noch keine Kritik an der Dame als absolute Wertinstanz, jedoch wird sie im Spannungsfeld Idealität versus gesellschaftliche Realität gesehen: eine Nuance, die sich bei Walther auswächst. In L 115,6 kann ohne den Ebenenwechsel noch Freude empfunden werden, die Realität hat keinen Einfluß auf sie bzw. der Ebenenwechsel von Idealität zur Realität wird nicht ganz vollzogen. Auch das Klagen ist dann nicht nötig, wenn man die Distanz zur Dame und diese somit als rationales Konstrukt akzeptiert. In L 13,33 wird das Freudengefühl durch die gesellschaftliche Realität beeinträchtigt. Für Kritik anüberhêren frouwengibt es sowohl in L 115,6 als auch in L 13,33 keinen Platz. Doch für Walthers Minnesang gilt: „Die Frau wird in Walthers Minnesang mehr und mehr entworfen, Weiblichkeit und Frau-Sein an sich reichen nicht mehr aus, um Pol in Werbungsspiel zu sein.“69
Wie am Text belegt, geht zuletzt interpretiertes Lied durch seine stark rhetorische Prägung über Reinmar hinaus, ohne jedoch die Grundsätze der Hohen Minne aufzugeben; es bleibt der Tradition verhaftet, bietet aber mit Wenske einen ‘systemimmanenten Ausweg’.
3. Lieder Walthers derebenenoder neuen Hohen Minne: zuAller werdekeit ein füegerinne(L 46,32)
Mehr als Ausblick denn als ausführliche Interpretation soll dieser Exkurs zu Walthersebenenoder neuen Hohen Minne verstanden werden, ein Exkurs, der die Betrachtung seiner Lieder in der Tradition der Hohen Minne abschließen soll.
Walthers LiedAller werdekeit ein füegerinne[70](L 46,32) wird allgemein als Programmlied für diese Gruppe gesehen. Schon die ersten fünf Verse haben durchweg programmatischen Charakter, erst in (1,6) erscheint das Ich. Als Urheberin aller Tugend wird generalisierendfrouwe Mâzegerühmt: Sie bedeutet nach aristotelisch-stoischer Ethik die Mitte zwischen Extremen. Hier wird ihr außerdem noch sozial integrierende Wirkung zugesprochen:der darf sich iuwer niht beschamen inne / beide ze hove noch ouch an der strâze(1,4 f.).Das Ich sucht den Rat der FrauMâze, daz ir mich ebene werben lêret(1,7). Der Wunsch,ebenezu werben, ist im Hinblick auf die Liebe programmatisch, beinhaltet er doch die Liebe zwischen den Polenze nidere[71]undze hôhegleich der „Antinomie einer platonischen und sinnlichen Liebe“72.Beide Extreme schaden dem Ich (1,8) und sind mit dem Streben nachmâzeunvereinbar:unmâze enlâzet mich âne nôt!(1,11). Das Ich sieht sich nicht in der Lage, das Programm in die Realität umzusetzen, vielmehr fällt es von einem Extrem ins andere. Das Ich befindet sich in einer aporetischen Lage, weil es die Spannung zwischen programmatischer Ebene und psychischer Realität nicht auflösen kann. Damit birgt dieses Programmgedicht gleichzeitig das Infragestellen des Programms.Ebenewerben zu können, setzte die Gleichrangigkeit der Pole voraus.
Sie sind es aber keineswegs, das zeigt ein Blick auf die zweite Strophe:Nideriu minne heizet diu sô swachet, / [...] / hôhiu minne heizet diu daz machet, / daz der muot nâch werder liebe ûf swinget(2,1-5). Während die niedere Minne nicht zum Ausgleich dienen kann, istwerdekeitnur durch hohe Minne zu erreichen; das eine gibt nichts, das andere alles. Diese Asymmetrie wirkt einer Harmonisierung entgegen, Programm und Realität stehen im Mißverhältnis zueinander. Dieses Dilemma bedeutet das Dilemma derebenenMinne und führt auf der psychisch-realen Ebene zur neuen Hohen Minne, zu ihrer psychischen und moderaten Erneuerung. Die Lieder Walthers dieser Gruppe werden deswegen unter dem Begriffebeneund neue Hohen Minne geführt, weil beide Bezeichnung auf der jeweiligen Ebene richtig sind.
(2,8) bringt dieherzeliebemit ins Spiel, eine Kategorie aus den ‘Mädchenliedern’:kumet herzeliebe, sô bin ich verleitet(2,8). Doch auch sie kann die Synthese nicht bewirken, denn mit der Tugend ist bereits die Hohe Minne eng verbunden und dieherzeliebeist als absolute Emotion nicht mittelbar.
Um die Stellung derherzeliebeinnerhalb dieses neuen Konzeptes besser begreifen zu können, hilft - setzt man einen intertextuellen Bezug voraus - eine Betrachtung der dritten Strophe des LiedesEin niuwer sumer, ein niuwe zît73(L 92,9). Darin wird dieherzeliebeals Funktionselement der neuen Hohen Minne relativiert.
Der blic gefröiwet ein herze gar,
den minneclich ein wîp ansiht.
wie welt ir danne, daz der var,
dem ander lieb von in beschiht?
der ist eht manger fröiden rîch,
sô jenes fröide gar zergât.
waz ist den fröiden ouch gelîch,
dâ liebez herze in triuwe stât,
in schœne, in kiusche, in reinen siten!(3,1-9)
Das absolute Glück des Blicks als emotionales Moment aus den ‘Mädchenliedern’ gilt hier nur zum Schein; es verblaßt neben den absolut gesetzten Werten der Hohen Minne:triuwe, schœne, kiuscheundreine siten.Walther ist - wenn auch in anderem Kontext - zur Hohen Minne zurückgekehrt, der Kreis der zu interpretierenden Lieder in der Tradition der Hohen Minne schließt sich hier.
Zuletzt sei angemerkt, daß es sich bei dem LiedAller werdekeit ein füegerinneum „eines der meistinterpretierten und umstrittensten Lieder Walthers“74handelt, und damit mit Sievert an ein interpretatorisches Grundproblem die Lieder Walthers betreffend erinnert:
Walther ist bekannt und anerkannt als die herausragendste Gestalt des deutschen Minnesangs. Das ist vielleicht auch schon das einzige, das man nicht bezweifelt hat und worüber man sich völlig einig ist.75
4. Literaturverzeichnis
Quellen:
Walther von der Vogelweide. Werke. Bd. 1: Liedlyrik. Mhd./Nhd. Hg., übers. und komm. von Günther Schweikle. Stuttgart: Reclam 1998 (= Universal-Bibliothek Nr. 820).
Literatur:
Bein, Thomas: Walther von der Vogelweide. Stuttgart: Reclam 1997 (= Universal-Bibliothek Nr. 17601).
Brunner, Horst; Gerhard Hahn u. a.: Walther von der Vogelweide. Epoche - Werk - Wirkung. München: Beck 1996.
Kuhn, Hugo: Minnelieder Walthers von der Vogelweide: ein Kommentar. Hg. von Christoph Cormeau. Tübingen: Niemeyer 1982 (= Untersuchungen zur deutschen Literaturgeschichte; Bd. 33).
Schweikle, Günther: Minnesang. 2. korrigierte Aufl. Stuttgart: Metzler 1995 (= Sammlung Metzler; Bd. 244).
Sievert, Heike: Studien zur Liebeslyrik Walthers von der Vogelweide. Göppingen: Kümmerle 1990 (= Göppinger Arbeiten zur Germanistik; Nr. 509).
Wenske, Martin: „Schwellentexte“ im Minnesang Walthers von der Vogelweide. Exemplarische Interpretationen ausgewählter Lieder. Frankfurt am Main: Lang 1994 (= Europ. Hochschulschriften: Reihe 1, Deutsche Sprache und Literatur; Bd. 1477).
[...]
1Vgl. Schweikle (1995), S. 89.
2Ebd., S. 90.
3Vgl. Brunner / Hahn u. a. (1996), S. 81.
4Bein (1997), S. 113.
5Ebd., S. 104.
6Brunner / Hahn u. a. (1996), S. 81.
7Ebd., S. 82.
8Vgl. im folgenden Schweikle (1995), S. 170 ff.
9Ebd., S. 192.
10Ebd.
11Ebd., S. 188.
12Ebd., S. 171.
13Ebd., S. 124.
14Vgl. ebd., S. 196.
15Bein (1997), S. 132.
16Schweikle (1998), S. 64 f.; der Textkorpus wird zitiert nach Schweikle (1998).
17Ebd., S. 52 ff.
18Klassifikationsmöglichkeiten nach ebd. (1995), S. 118 f.
19Vgl. ebd., S. 119; S. 121 ff.
20Vgl. ebd., S. 126.
21Vgl. ebd., S. 161 f.
22Ebd., S. 197.
23Bein (1997), S. 116.
24Schweikle (1995), S. 193.
25Ebd., S. 183.
26Ebd., S. 187.
27Vgl. Bein (1997), S. 135.
28Vgl. Schweikle (1995), S. 184.
29Ebd., S. 186.
30Vgl. ebd. (1998), S. 546.
31Ebd. (1995), S. 176.
32Ebd., S. 200 f.
33Vgl. ebd., S. 200.
34Vgl. Bein (1997), S. 118.
35Vgl. Schweikle (1995), S. 90.
36Vgl. ebd. (1998), S. 539.
37Kuhn (1982), S. 5.
38Vgl. Wenske (1994), S. 19.
39Vgl. ebd., S. 38.
40Schweikle (1995), S. 124.
41Ebd.
42Wenske (1994), S. 27.
43Vgl. Schweikle (1998), S. 540.
44Vgl. ebd. (1995), S. 199.
45Ebd., S. 175.
46Ebd.
47Vgl. Wenske (1994), S. 34.
48Ebd., S. 30.
49Vgl. ebd., S. 23; S. 35 ff.
50Ebd., S. 36.
51Ebd., S. 36 f.
52Ebd., S. 37.
53Ebd., S. 24.
54Vgl. ebd., S. 19.
55Vgl. Schweikle (1998), S. 540.
56Ebd., S. 541.
57Ebd. (1995), S. 186.
58Wenske (1994), S. 40.
59Vgl. Schweikle (1995), S. 197.
60Wenske (1994), S. 40.
61Ebd., S. 41.
62Vgl. Schweikle (1998), S. 541.
63Wenske (1994), S. 41.
64Ebd., S. 43.
65Vgl. Schweikle (1998), S. 540: Das ‘Motiv der Verständigungsschwierigkeiten’ findet sich auch bei Hartmann (Klage, V.218 f.), das ‘Motiv des unaufrichtigen Werbens’ bei ebd. (Klage, V.270 ff.) und bei Reinmar (MF 166,14).
66Wenske (1994), S. 44.
67Ebd., S. 45.
68Ebd., S. 46.
69Bein (1997), S. 135.
70Schweikle (1998), S. 364 ff.
71Deutlich wird an dieser Stelle die intertextuelle Referenz zur zweiten Strophe des LiedesHerzeliebez frouwelin(L 49,25), (Schweikle (1998), S. 284 f.). Dies bekräftigt die ältere Forschungsmeinung, die ‘Mädchenlieder’ zeitlich vor den Lieder derebenenoder neuen Hohen Minne einzuordnen.
72Schweikle (1995), S. 176.
73Ebd. (1998), S. 340 ff.
74Brunner / Hahn u. a. (1996), S. 117.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Textes über Walther von der Vogelweide?
Der Text ist eine umfassende Sprachvorschau, die Titel, Inhaltsverzeichnis, Ziele und Hauptthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Er analysiert die Minnelieder Walthers von der Vogelweide und deren Einordnung in die Tradition der Hohen Minne sowie die Entwicklung zu neuen Minnekonzeptionen.
Welche Lieder von Walther von der Vogelweide werden im Text analysiert?
Der Text konzentriert sich exemplarisch auf folgende Lieder:
- Hêrre got, gesegene mich vor sorgen (L 115,6)
- Maniger frâget, waz ich klage (L 13,33)
- Aller werdekeit ein füegerinne (L 46,32)
Was sind die Hauptthemen der frühen Lieder Walthers im Kontext der Hohen Minne?
Die Hauptthemen sind die transzendente Beziehung zur Dame, die festgelegte Rollenbeziehung zwischen lyrischem Ich und umworbener Frau, das Ungleichgewicht zwischen den Parteien und der Dienst des Mannes in der Hoffnung auf Lohn. Die Lieder betonen die inneren Hemmnisse, die die Kontaktaufnahme zur Frau erschweren.
Was bedeutet die "ebene oder neue Hohe Minne" bei Walther von der Vogelweide?
Die "ebene oder neue Hohe Minne" bezieht sich auf eine neue Konzeption der Minne, die Walther entwickelt hat. Sie beinhaltet eine Liebe zwischen den Polen "ze nidere" und "ze hôhe", wobei er nach Ausgewogenheit strebt. Das Programmlied hierfür ist Aller werdekeit ein füegerinne (L 46,32).
Wie wird Walther von der Vogelweide im Kontext des Minnesangs eingeordnet?
Walther von der Vogelweide wird oft als Höhepunkt und Überwindung der Hohen Minne angesehen. Seine Werke zeigen eine Entwicklung von Minneliedern im Stil Reinmars zu Liedern, die das Minnekonzept kritisch reflektieren. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass eine lineare Entwicklung in Walthers Werk problematisch sein kann.
Welche Rolle spielt die "frouwe minne" in Walthers Liedern?
Die "frouwe minne" ist eine Personifikation oder Allegorisierung des abstrakten Minnebegriffs. Walther gilt als einer ihrer Schöpfer. In ihr wird die Idee der Frau angesprochen, die als Allmächtige über Glück und Leid entscheidet und damit ein rationales Konstrukt ist.
Welchen Einfluss hatte Reinmar von Hagenau auf Walther von der Vogelweide?
Walther von der Vogelweide wurde zunächst durch Reinmar von Hagenau beeinflusst, insbesondere in seinen frühen Liedern. Später löste er sich jedoch von dessen Stil und entwickelte eigene Minnekonzeptionen.
Was ist die Bedeutung der Strophenform in Walthers Liedern?
Walther verwendet oft die Stollen- oder Kanzonenstrophe, die romanischen Vorbildern folgt. Diese Form ist rational aufgebaut durch die zwei metrisch und musikalisch gleich gestalteten Stollen, ist aber durch den Abgesang variabel zu handhaben.
Welche Kritik an der Hohen Minne wird in Walthers Liedern deutlich?
In einigen Liedern Walthers wird die Kluft zwischen dem idealen Anspruch der Minne und ihrer realen Umsetzung kritisiert. Auch der Einfluss gesellschaftlicher Konventionen und die Schwierigkeit, aufrichtige Minne von falscher zu unterscheiden, werden thematisiert. Es erfolgt jedoch keine Kritik an der Dame selbst als absoluter Wertinstanz, sondern nur an "überhêren frouwen".
Welche Literatur wird im Text zur Analyse von Walther von der Vogelweide verwendet?
Die im Text verwendete Literatur umfasst unter anderem Werke von Günther Schweikle, Thomas Bein, Horst Brunner, Gerhard Hahn, Hugo Kuhn und Martin Wenske.
- Quote paper
- Tina Full-Euler (Author), 2000, Lieder Walthers von der Vogelweide in der Tradition der Hohen Minne, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1469214