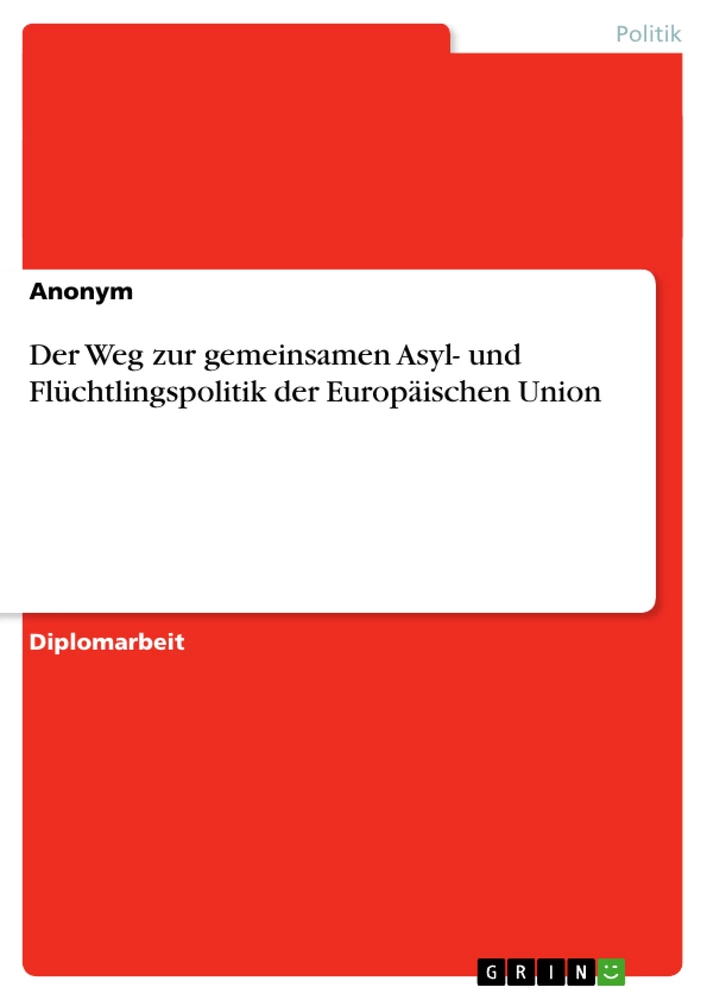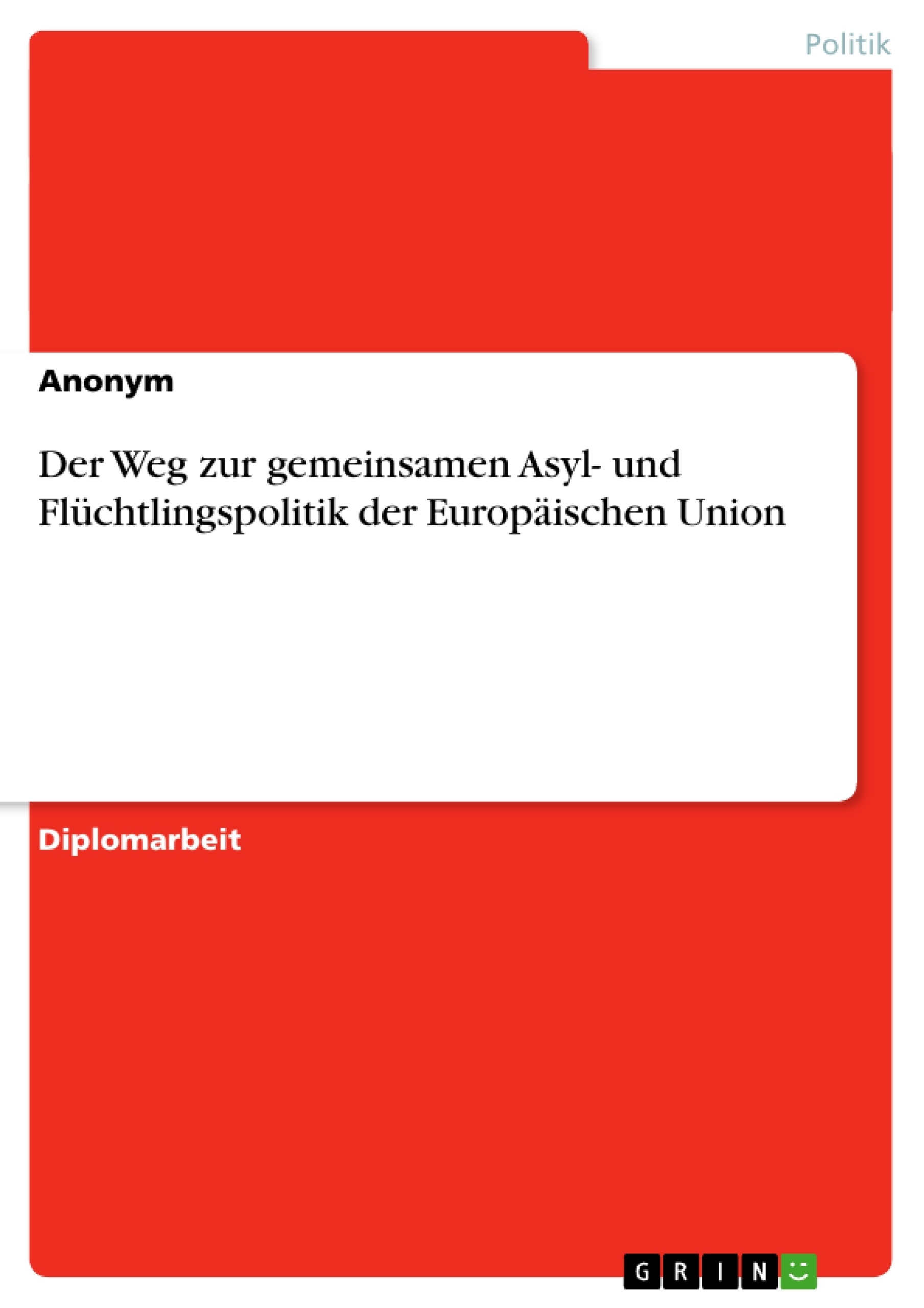„Die Europäische Union hat für ihre Bürger bereits die wichtigsten Komponenten eines gemeinsamen Raums des Wohlstands und des Friedens geschaffen [...]. Die im Vertrag von Amsterdam enthaltene Herausforderung besteht nunmehr darin sicherzustellen, daß Freiheit, die das Recht auf Freizügigkeit in der gesamten Union beinhaltet, in einem Rahmen der Sicherheit und des Rechts in Anspruch genommen werden kann, der für alle zugänglich ist. [...] Es stünde im Widerspruch zu den Traditionen Europas, wenn diese Freiheit den Menschen verweigert würde, die wegen ihrer Lebensumstände aus berechtigten Gründen in unser Gebiet einreisen wollen.“
Der politische Umgang mit Einwanderungs-, Asyl- und Flüchtlingsfragen liegt traditionell in der Kompetenz der Nationalstaaten. Unter den Mitgliedsländern der Europäischen Union haben jedoch die stufenweise Vertiefung der Integration, der Abbau der Binnengrenzen und die Entwicklung der Asylantragszahlen in den 80er und 90er Jahren des 20. Jahrhunderts zu der Einschätzung geführt, dass Flucht und Asyl gemeinsamer, EU-weiter Regelungen bedürfen. Die Verträge von Maastricht (1992) und Amsterdam (1997) tragen dieser Einschätzung Rechnung und haben eine Europäisierung der Asyl- und Flüchtlingspolitik bewirkt - mit der Folge, dass die Kompetenz hierfür heute nicht mehr nur auf der nationalstaatlichen, sondern auch auf der Gemeinschaftsebene angesiedelt ist. Besonders intensiv sind die Organe der Union und ihre Mitgliedstaaten seit 1999, dem Jahr des Inkrafttretens des Amsterdamer Vertrags, unter der Überschrift des „schrittweisen Aufbaus eines europäischen Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“ mit der Entwicklung einer gemeinsamen Asyl- und Flüchtlingspolitik befasst.
Diesen Prozess der Europäisierung beschreiben viele Autoren und Beobachter als restriktiv. Sie machen – wie in dieser Arbeit gezeigt werden wird - geltend, dass sowohl auf der Ebene der Mitgliedstaaten, als auch im EU-Rahmen, nicht an einer umfassenden Gewährleistung des Rechts auf Asyl, sondern vielmehr an Begrenzung und Abwehr der Immigration von Flüchtlingen gearbeitet werde. Die EU treibe beispielsweise die Sicherung ihrer Außengrenzen voran, versuche, die Verantwortung für den Schutz von Asylsuchenden an Drittstaaten abzuweisen, schränke soziale Leistungen an Flüchtlinge ein und intensiviere die zwangsweise Rückkehr abgelehnter Asylbewerber in ihre Herkunftsländer, so die Einschätzung der Kritiker.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Die Asyl- und Flüchtlingspolitik der Europäischen Union zwischen Menschenrechten, Souveränität und innerer Sicherheit
- Ausgangsüberlegungen zu Asyl und Migration
- Migranten, Flüchtlinge, Asylbewerber: Begriffe und globale Entwicklungen
- Menschenrechte, staatliche Souveränität und innere Sicherheit: gegensätzliche Dimensionen von Flucht und Asyl
- Asyl als Menschenrecht
- Flüchtlinge als Herausforderung für Souveränität und innere Sicherheit
- Flüchtlinge im Spannungsfeld von Menschenrechten, Souveränität und innerer Sicherheit
- Charakteristika der Asyl- und Flüchtlingspolitik in ausgewählten EU-Staaten
- Deutschland
- Frankreich
- Italien
- Schweden
- Großbritannien
- Zwischenfazit
- Der Weg zur gemeinsamen EU-Asyl- und Flüchtlingspolitik
- Vorbemerkungen zur institutionellen Entwicklung der EU-Asylpolitik
- Die Anfänge der Kooperation im Asylbereich
- Die Asylpolitik von Maastricht (1992) bis Amsterdam (1997)
- Der Vertrag von Maastricht: Die Institutionalisierung der gemeinsamen Asylpolitik
- Die Beschlüsse des Europäischen Rates von London (1992)
- Die Harmonisierung der Asylsysteme der Mitgliedstaaten: Einigungen auf dem „,kleinsten gemeinsamen Nenner“
- Die asylpolitischen Reformen im Vertrag von Amsterdam
- Nach Amsterdam: Von der „,Harmonisierung“ zur „Vergemeinschaftung“
- Das,,Wiener Strategiepapier“
- Der „,Aktionsplan zum Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“
- Die,,Leitlinien“ der deutschen Bundesregierung
- Der Sondergipfel von Tampere
- Die Umsetzung der Bestimmungen des Amsterdamer Vertrags: ausgewählte asylpolitische Maßnahmen und ihre Bedeutung
- Gemeinsame Normen für Asylverfahren
- Der Europäische Flüchtlingsfonds
- Temporary Protection – vorübergehender Schutz
- Mindestnormen für die Aufnahme von Asylsuchenden
- Das gemeinsame Vorgehen gegen „illegale Einwanderung“
- Rückkehrpolitik und Abschiebungen
- Zwischenfazit
- Menschenrechte versus innere Sicherheit: die Positionen von Rat, Parlament und Kommission
- Die Position des Rates der Europäischen Union
- Die Haltung des Europäischen Parlamentes
- Die Position der Europäischen Kommission
- Perspektiven der gemeinsamen EU-Asyl- und Flüchtlingspolitik
- Die mangelnde Ausgewogenheit zwischen der sicherheitspolitischen und der menschenrechtlichen Dimension der Asylpolitik und ihre Folgen
- Gründe für die Marginalisierung der menschenrechtlichen Dimension
- Demographische und ökonomische Überlegungen und ihre Bedeutung für die Asylpolitik
- Die EU-Asylpolitik und das Erstarken rechtsradikaler Parteien
- Die Auswirkungen der gemeinsamen Asyl- und Flüchtlingspolitik auf Nachbar- und Drittstaaten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die gemeinsame Asyl- und Flüchtlingspolitik der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten vor dem Hintergrund der verschiedenen Überlegungen, die bei der politischen Handhabung der Phänomene Flucht und Asyl in den Aufnahmeländern eine wichtige Rolle spielen.
- Das Spannungsfeld zwischen Menschenrechten, staatlicher Souveränität und innerer Sicherheit im Kontext der Asyl- und Flüchtlingspolitik
- Die Entwicklung der gemeinsamen EU-Asylpolitik von den Anfängen bis hin zur aktuellen Situation
- Die unterschiedlichen Positionen der EU-Organe (Kommission, Rat und Parlament) in Bezug auf Asyl- und Flüchtlingspolitik
- Die Ursachen für die Dominanz der sicherheitsorientierten Herangehensweise in der EU-Asylpolitik
- Die Perspektiven der gemeinsamen EU-Asylpolitik für den Flüchtlingsschutz in Europa
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet das Spannungsfeld zwischen Menschenrechten, staatlicher Souveränität und innerer Sicherheit im Kontext der Asyl- und Flüchtlingspolitik der Europäischen Union. Das Kapitel führt in die Thematik ein und erläutert die Relevanz einer gemeinsamen EU-Asylpolitik.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit den Begriffen Migranten, Flüchtlinge und Asylbewerber sowie den globalen Entwicklungen im Bereich der Migration. Zudem wird das Spannungsverhältnis zwischen Menschenrechten, Souveränität und innerer Sicherheit im Zusammenhang mit Flucht und Asyl analysiert.
Kapitel 3 bietet einen Überblick über die Asyl- und Flüchtlingspolitik in ausgewählten EU-Staaten, wie Deutschland, Frankreich, Italien, Schweden und Großbritannien. Dabei werden die Besonderheiten und Unterschiede der nationalen Asylpolitiken hervorgehoben.
Kapitel 4 zeichnet den Weg zur gemeinsamen EU-Asyl- und Flüchtlingspolitik nach, beginnend mit den Anfängen der Kooperation im Asylbereich bis hin zur Umsetzung des Amsterdamer Vertrags. Die Entwicklung der EU-Asylpolitik wird im Detail dargestellt, einschließlich der zentralen Meilensteine und politischen Prozesse.
Kapitel 5 analysiert die unterschiedlichen Positionen von Rat, Parlament und Kommission in Bezug auf die Balance zwischen Menschenrechten und innerer Sicherheit in der Asylpolitik. Darüber hinaus werden die Ursachen für die Dominanz der sicherheitsorientierten Herangehensweise untersucht und die Auswirkungen der gemeinsamen EU-Asylpolitik auf die Situation von Flüchtlingen in Europa beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Asyl- und Flüchtlingspolitik, Menschenrechte, staatliche Souveränität, innere Sicherheit, Europäische Union, Integration, Migration, Gemeinschaftspolitik, Harmonisierung, Vergemeinschaftung, Restriktivität, Sicherheit, Flüchtlingsschutz.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2002, Der Weg zur gemeinsamen Asyl- und Flüchtlingspolitik der Europäischen Union, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/14644