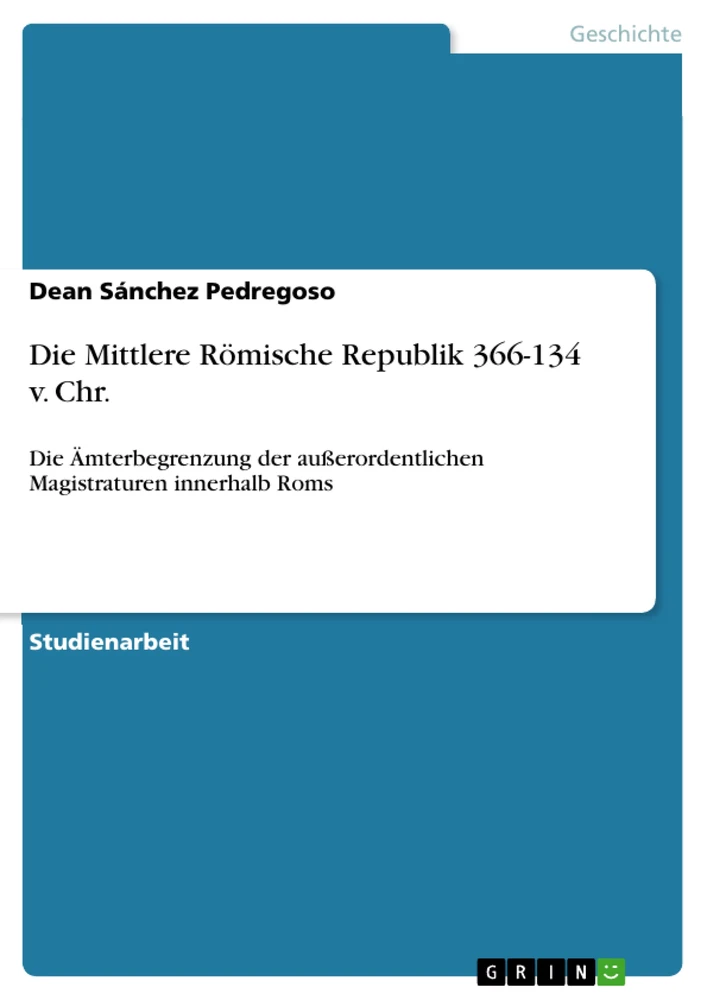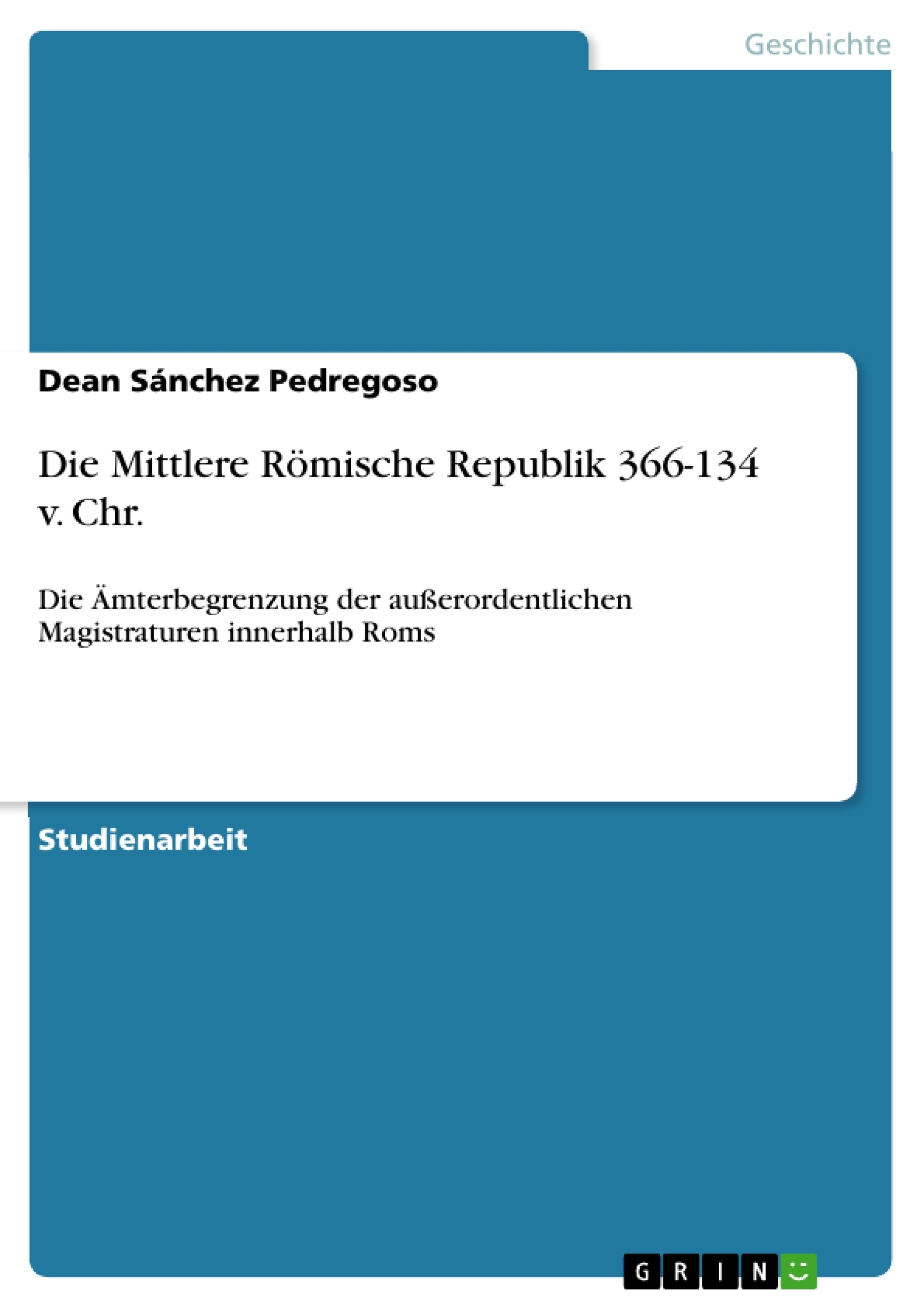Zur Zeit der Mittleren Römischen Republik wurden die Magistrate zunehmend mit Sondervollmachten ausgestattet, die ihren Machtbereich stark erweiterten. Um diesen Prozess besser zu verstehen und besser bewerten zu können, folgt zunächst eine Einordnung in den historischen Kontext.
In der Zeit des Hannibalkrieges sind die Grundprinzipien der Ämtervergabe, die für die Ausgewogenheit der Macht innerhalb der Nobilität sorgten, wie die Beschränkung der Amtsdauer durch das Annuitätsprinzip, das Prinzip der Kollegialität und die Kontinuation eines Amtes, nicht mehr befolgt worden. Dies lag daran, dass im Zuge des Krieges gewisse Sondervollmachten nötig waren, denn die militärische Notwendigkeit machte es erforderlich, dass an verschiedensten Orten innerhalb Italiens kompetente und kenntnisreiche Feldherren benötigt wurden. Ein durch das Annuitätsprinzip bedingter jährlicher Wechsel des Kommandos hätte die Effizienz der Heerführung stark beeinträchtigt, sodass der Senat z.B. das Prinzip der Annuität oder der Iteration eines Amtes außer Kraft setzte. Die vorhandene militärische Situation ermöglichte es einigen Feldherren großen Ruhm zu erreichen und den jungen „nobiles“ einen ungewöhnlich schnellen Aufstieg zu den außerordentlichen Ämtern. Hierbei veränderte sich die Stellung des aristokratischen Senats, der immer die fähigsten Heerführer mit den höchsten Kommandos versah. Zur Unzufriedenheit derjenigen, die mit keinem Kommando beauftragt wurden und keine Chance auf eine Karriere bekamen, einigte man sich darauf, die Ämter wieder einer Regulation zu unterziehen, sobald die militärische Krise vorüber sei. Doch während des Zweiten Punischen Krieges verlor der Senat die Kontrolle und konnte sich nicht mehr gegenüber den Amtsträgern behaupten. Dies hatte seine Anfänge schon zu Beginn des 3. Jahrhunderts v. Chr., indem sich ehrgeizige Konsuln der Senatsmehrheit entgegenstellten, Senatsbeschlüsse nicht mehr anerkannten und sich über sie hinwegsetzten. Somit bestand die grundsätzliche Gefahr für den Senat in den Imperiumsträgern, die sich auf einen Konsens mit der politischen Elite nicht mehr einließen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Historische Einordnung
- 1.1 Problemhorizont
- 1.2 Kompetenzbereich der Prätoren
- 1.3 Kompetenzbereich der Konsuln
- 1.4 Kompetenzbereich des Senats
- 2 Grundprinzipien und Gesetze der Ämterbegrenzung
- 2.1 Grundprinzip der Annuität und Kollegialität
- 2.2 Die Funktionen von leges
- 2.3 Das vorausgehende Amt im gradus honorum 342 v. Chr.
- 2.4 Lex Genucia 342 v. Chr.
- 2.5 Lex Valeria de provocatione 300 v. Chr.
- 2.6 Lex orchia 182 v. Chr und lex fannia 161 v. Chr.
- 2.7 Lex Cornelia Baebia de ambitu 181 v. Chr. und lex Cornelia Fulvia de ambitu 159 v. Chr.
- 2.8 Lex villa annalis 180 v. Chr.
- 2.9 Lex Papiria 179 v. Chr.
- 2.10 Lex de consulatu non iterado 151 v. Chr.
- 3 Fazit: Ist die Machtbegrenzung der außerordentlichen Ämter gelungen?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Begrenzung der Macht der Konsuln und Prätoren in der Mittleren Römischen Republik. Sie untersucht, wie der Senat versuchte, die Macht der Magistrate einzuschränken, nachdem diese im Zuge des Hannibalkrieges ihre Befugnisse überschritten hatten.
- Die Entwicklung der Magistraturen im Kontext des Hannibalkrieges
- Die Bedeutung der leges für die Begrenzung der Macht der Magistrate
- Der Kompetenzbereich der Prätoren und Konsuln
- Die Rolle des Senats bei der Machtbegrenzung der Magistrate
- Die Frage, ob die Machtbegrenzung der Magistrate erfolgreich war
Zusammenfassung der Kapitel
1 Historische Einordnung
Dieses Kapitel beleuchtet den historischen Kontext, in dem die Macht der Magistrate in der Mittleren Republik zunehmend wuchs. Es erläutert, wie die Grundprinzipien der Ämtervergabe während des Hannibalkrieges außer Kraft gesetzt wurden, um die militärische Effizienz zu gewährleisten. Die Arbeit zeigt auch die Auswirkungen des Krieges auf die Stellung des Senats und die wachsende Macht der Magistrate auf.
2 Grundprinzipien und Gesetze der Ämterbegrenzung
Dieses Kapitel untersucht die Grundprinzipien der römischen Ämtervergabe, insbesondere die Prinzipien der Annuität und Kollegialität. Es beleuchtet die Rolle von Gesetzen ("leges") bei der Regulierung der Magistraturen. Der Fokus liegt auf den wichtigsten Gesetzen, die zur Begrenzung der Macht der Magistrate erlassen wurden, darunter die Lex Genucia, die Lex Valeria de provocatione, die Lex orchia und die Lex fannia.
3 Fazit: Ist die Machtbegrenzung der außerordentlichen Ämter gelungen?
Dieses Kapitel bietet eine zusammenfassende Analyse der im Text behandelten Themen. Es bewertet die Wirksamkeit der Maßnahmen, die zur Begrenzung der Macht der Magistrate ergriffen wurden, und analysiert, ob diese erfolgreich waren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Ämterbegrenzung, Magistraturen, Konsuln, Prätoren, Senat, leges, römisches Recht, Mittlere Römische Republik, Hannibalkrieg, mos maiorum, Annuitätsprinzip, Kollegialitätsprinzip, cursus honorum, Imperium, Res Publica, Ambitus.
- Quote paper
- Dean Sánchez Pedregoso (Author), 2016, Die Mittlere Römische Republik 366-134 v. Chr., Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1463529