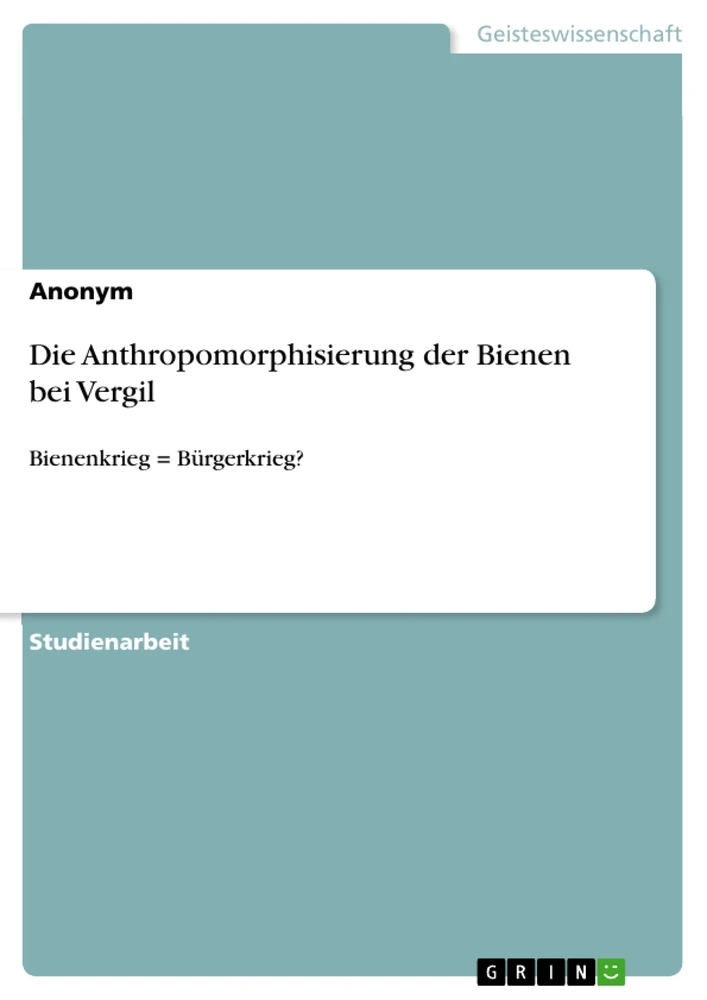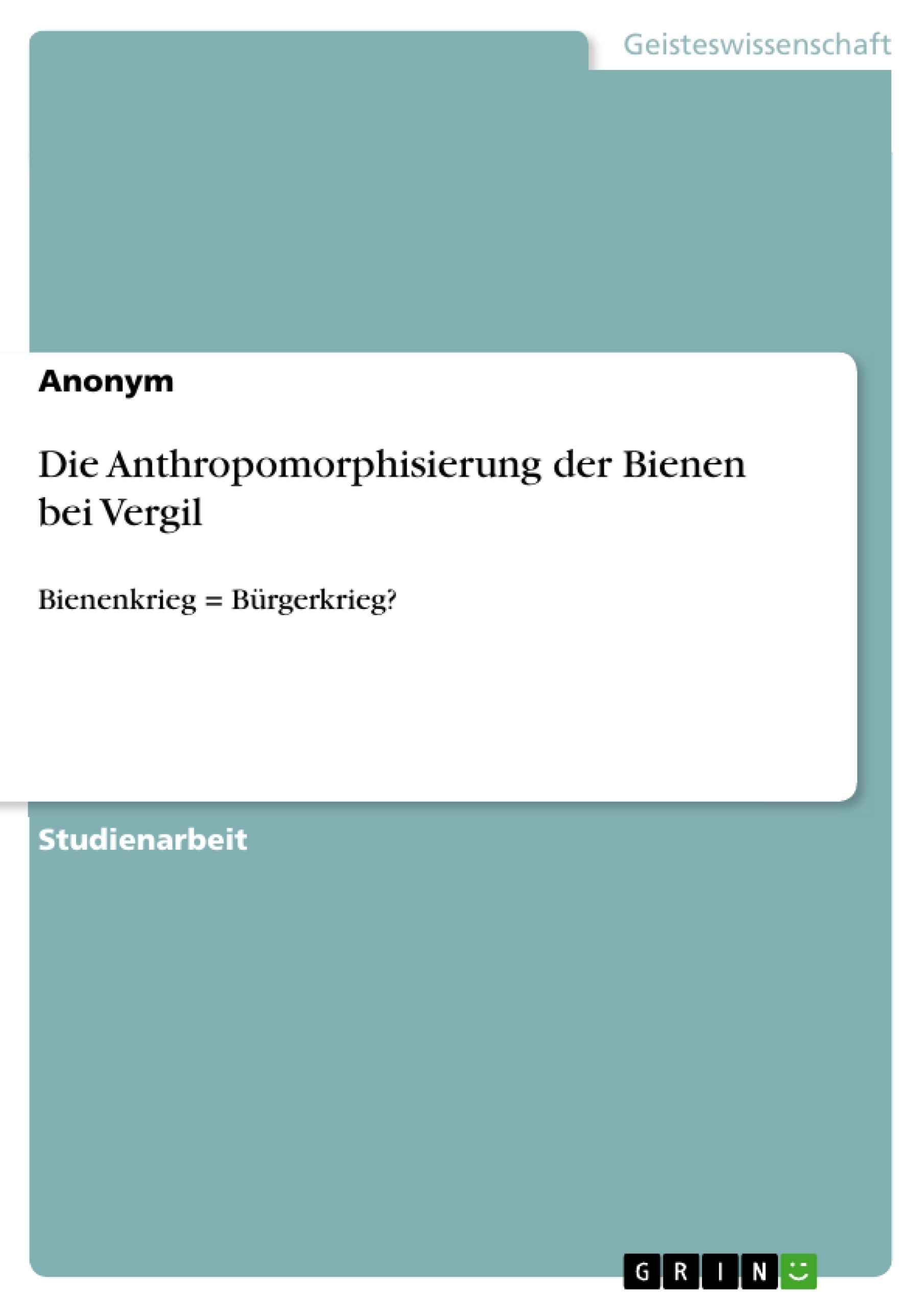In seinem Lehrgedicht Georgica schreibt Vergil über Landwirtschaft und geht dabei auf die Bereiche Acker- und Weinbau und Vieh- und Bienenzucht ein. Schwerpunkt der folgenden Betrachtungen wird das vierte Buch über die Imkerei sein. Vor Vergil beschäftigten sich bereits andere antike Autoren wie Aristoteles in seinen historia animalium und Varro in seinen res rusticae mit Bienen. Vergils Schilderung der Imkerei, die Ausführungen über den Wohnungsbau, Zuchtwahl, Wesen und Bugonie beinhaltet, ähnelt in vielen Bereichen den biologischen Darstellungen der Varros und Aristoteles´. Bei den Werken der eben genannten Autoren sind in vielen Punkten Parallelen zwischen Bienen und Menschen feststellen, bei Vergil hingegen scheinen die beiden Welten miteinander zu verschmelzen.
Daher vertritt die überwiegende Mehrheit der scientific community die Meinung, dass Vergil sich nicht nur auf Bienen bezieht, sondern dass der Text auch eine politische Ebene beinhaltet und Bienen anthropomorphisiert werden. Besonders bei der Beschreibung des Bienenkriegs (V. 67–87) wurde von einer politischen Analogie und einer Anthropomorphisierung gesprochen. Um zu zeigen, in welchem Maße diese Überlegungen im Text grundgelegt sind, wird in der vorliegenden Arbeit aufgezeigt, an welchen Stellen Vergil Vokabular benutzt, das bisher nur im menschlichen oder tierischen Kontext verwendet wurde. Sollten viele Wörter allein dem menschlichen und nicht dem tierischen Kontext entstammen, so kann am Text belegt werden, ob Vergil die Intention eine Analogie zwischen Bienen- und Bürgerkrieg herzustellen und dadurch Bezug auf die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Antonius und Octavian zu nehmen wollte.
Vergil verweist an anderer Stelle, dass es möglich ist kleine Geschöpfe wie Bienen mit so etwas Gewaltigem wie dem römischen Bürgerkrieg zu vergleichen.
Nach der Verortung der Wörter wird aufgezeigt, an welchen Stellen die Analogie nicht funktioniert. Die Arbeit wird durch Überlegungen abgeschlossen, warum Vergil die Analogie so gestaltete, dass sie sich nicht vollständig in die Realität übertragen lässt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Text Georg. 4, 67–87
- Übersetzung Georg. 4, 67–87
- Kontextualisierung
- Makrokontextualisierung
- Mikrokontextualisierung
- Anthropomorphisierung der Bienen?
- An welchen Stellen und warum funktioniert die Allegorie nicht?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Vergils Darstellung des Bienenkrieges in den Georgica (V. 67–87) und untersucht die Hypothese einer politischen Analogie und Anthropomorphisierung der Bienen. Durch die Analyse des verwendeten Vokabulars wird beleuchtet, inwieweit Vergil eine Verbindung zwischen Bienen- und Bürgerkrieg herstellt und damit Bezug auf die Auseinandersetzung zwischen Antonius und Octavian nimmt.
- Analyse des Vokabulars im Bienenkriegs-Fragment
- Untersuchung der politischen Ebene in Vergils Darstellung
- Bewertung der Anthropomorphisierung der Bienen
- Erörterung der Funktionsweise und der Grenzen der Allegorie
- Interpretation der stilistischen Besonderheiten des Textes
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert die Bedeutung von Vergils Georgica für die antike Literatur sowie den Kontext der damaligen politischen Verhältnisse.
- Kapitel 2 präsentiert den Text des Bienenkrieges (Georg. 4, 67–87) im Original.
- Kapitel 3 bietet eine Übersetzung des Bienenkrieges-Textes ins Deutsche.
- Kapitel 4.1 behandelt die Makrokontextualisierung des vierten Buches der Georgica und betrachtet die Entwicklung der Selbstbestimmung der beschriebenen Lebewesen.
- Kapitel 4.2 befasst sich mit der Mikrokontextualisierung des Bienenkrieges und analysiert die stilistischen Besonderheiten des Textes.
Schlüsselwörter
Vergil, Georgica, Bienenkrieg, Anthropomorphisierung, politische Allegorie, Vokabularanalyse, Vergleich, Bürgerkrieg, Antonius, Octavian, Stilistik.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Die Anthropomorphisierung der Bienen bei Vergil, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1462195