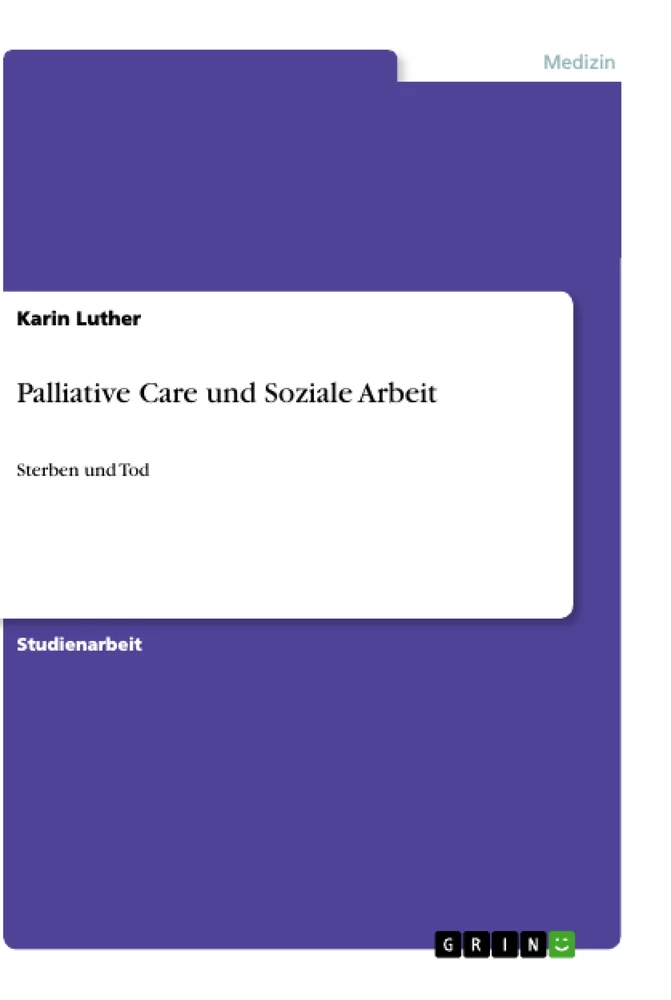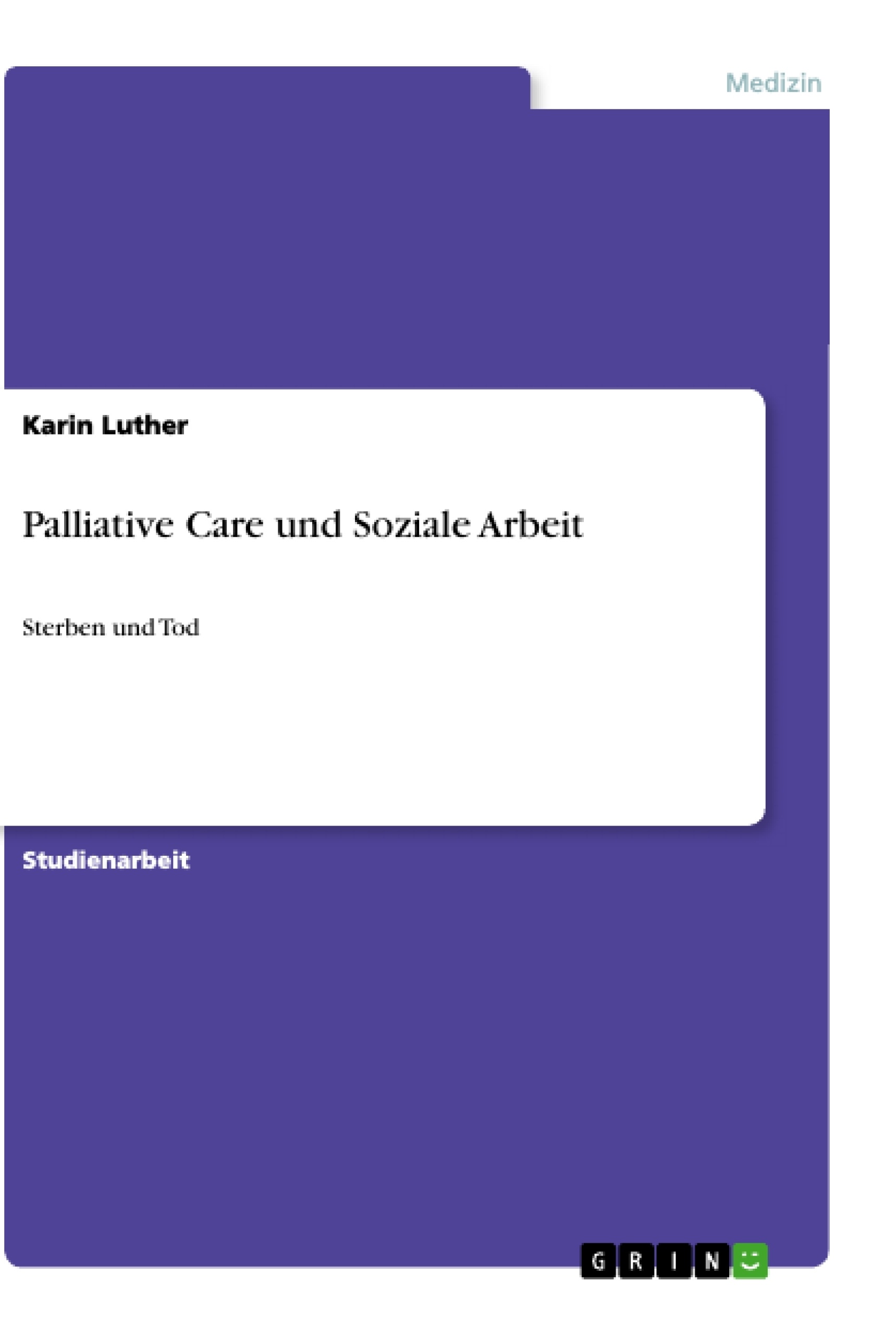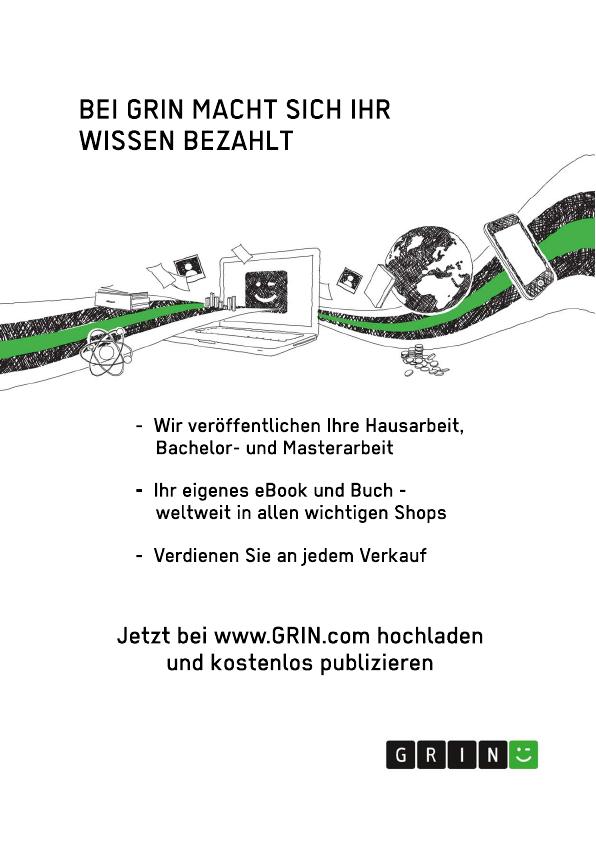In den folgenden Punkten wird von daher besonders auf den Umgang mit den Patienten und seinen Angehörigen eingegangen. Weiterhin wird auf die Situation des/ der SozialarbeiterIn im Kontext dieses Arbeitsfeldes Bezug genommen und mögliche psychische Belastungen bis hin zum Burnout-Syndrom beleuchtet.
Zum Schluss der Arbeit werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie der/die SozialarbeiterIn befriedigend und kompetent mit Hilfe von Entlastungsstrategien seiner Arbeit in diesem anspruchsvollen aber auch erschöpfenden Bereich nachgehen kann.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Was bedeutet Sterben und was bedeutet Tod
2. Geschichte
3. Begriffserklärung Hospizarbeit
4. Die Klienten der Palliativstationen und Hospize in Deutschland
5. Probleme
6. Theoretische Ansätze
7. Kompetenzen und Methoden des Sozialarbeiters
8. Das Phasenmodell nach Kübler-Ross
8.1. Beispiel Herr „Mux“
9. Ängste der Angehörigen
10. Aufgabenfelder der Sozialen Arbeit
11. Hilfeleitfaden für die Betroffenen und ihre Angehörigen
12. Beispiele für gesetzlich geregelte Hilfsangebote
13. Burnout
14. Emotionale Belastungen für die SozialarbeiterIn
15. Mögliche Anzeichen für das Burn-Out-Syndrom
16. Der Umgang mit den Belastungsfaktoren
17. Selbsthilfekontakte für Betroffene und Angehörigen
Quellenverzeichnis
Internetquellen
Literatur
Einleitung
Wir haben uns für das Referatsthema „Sterben und Tod“ entschieden, da wir bereits Erfahrungen im Umgang mit schwer kranken Menschen in unserem Leben gemacht haben und uns im Rahmen dieses Vortrags näher mit dieser Thematik beschäftigen wollten. Während unserer Ausarbeitung haben wir versucht der Thematik einen Rahmen zu geben, welcher aus unserer Sicht dem Seminarthema „Arbeit mit Angehörigen“ gerecht wird. Von daher haben wir uns entschieden zunächst den geschichtlichen Hintergrund zu beleuchten, zu erläutern was Hospizarbeit beinhaltet und welche Voraussetzungen ein/e SozialarbeiterIn mitbringen sollte und welche Belastungen in der Arbeit mit schwer Kranken auf ihn/ sie einströmen (könnten).
In den folgenden Punkten wird von daher besonders auf den Umgang mit den Patienten und seinen Angehörigen eingegangen. Weiterhin wird auf die Situation des/ der SozialarbeiterIn im Kontext dieses Arbeitsfeldes Bezug genommen und mögliche psychische Belastungen bis hin zum Burnout-Syndrom beleuchtet.
Zum Schluss der Arbeit werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie der/die SozialarbeiterIn befriedigend und kompetent mit Hilfe von Entlastungsstrategien seiner Arbeit in diesem anspruchsvollen aber auch erschöpfenden Bereich nachgehen kann.
1. Was bedeutet Sterben und was bedeutet Tod
Das Sterben gehört zum Leben dazu und ist unvermeidlich. Doch woran erkennt man, dass ein Mensch sich im Sterben befindet beziehungsweise was unterscheidet den Begriff des Sterbens den Begriff des Todes? Nach dem traditionellen Standpunkt umfasst das Sterben „eine kurze Zeitspanne unmittelbar vor dem Todeseintritt“ (Erben (2001), S. 34). Wittkowski bemängelt, dass diese Definition die intrapsychischen Vorgänge außer Acht lässt, sowie das Kommunikationsgeschehen des unheilbar Kranken mit den Personen aus seinem sozialen Umfeld. Ein Mensch ist nach Wittkowski dann ein sterbender, wenn drei Faktoren zusammen treffen: wenn dem Sterbenden aufgrund seines körperlichen Zustandes anzusehen ist, dass er in nächster Zeit sterben wird, wenn die Menschen in seiner Umgebung dies wissen und wenn der Betroffene selbst diese Tatsache weiß und sie sein Erleben und seine Verhaltensweisen bestimmt (Erben (2001), S. 34). Die Kritik die an dieser Hypothese geübt wird bezieht sich auf die beiden letzten Punkte, so kann es sein, dass ein Sterbender bereits den Tod ahnt, die Ärzte aber noch um das (Über-) Leben des Kranken bemüht sind oder aber dass der Arzt die Diagnose bereits weiß, dem Patienten diese aber noch vorenthalten wird. Es kann also gesagt werden, dass sich keine eindeutige Definition ausmachen lässt, wohl auch aus dem Grund, dass das Sterben so individuell und einzigartig wie das Leben selbst ist und dies nicht aus dem Blickwinkel geraten sollte (Erben (2001), S. 35).
Nun stellt sich die Frage, wo die Grenze zum Begriff des Todes gezogen werden kann. Auch hier gibt es verschiedene Auffassungen, da die Feststellung des Todes jedoch Aufgabe der Ärzte ist, werden vorwiegend medizinische Begriffe verwand um den Tod zu umschreiben. So gibt es einmal den klinischen Tod, der durch Herz-Kreislaufstillstand, Atemstillstand, weite Pupillen u.a. feststellbar ist. Der klinische Tod ist durch Reanimation (Wiederbelebung) in einigen Fällen auch reversibel, also rückgängig zu machen, ist dies nicht der Fall, wird vom totalen Tod oder Individualtod gesprochen, womit der irreversible Tod gemeint ist. Dieser geht mit dem Ausfall aller Lebensfunktionen einher. Eine weitere Ursache für den Tod eines Menschen kann der Hirntod sein, hiermit ist der isolierte Organtod des menschlichen Gehirns gemeint, er ist auch als Partialtod bekannt. Der Hirntod geht mit dem Ausfall aller Aktivitäten des Zentralnervensystems und Atemausfall einher (Erben (2001), S. 36).
Im Hinblick auf die sozialarbeiterischen Handlungsmöglichkeiten soll jedoch noch auf den sozialen Tod des Patienten eingegangen werden. Damit ist die soziale Situation des Patienten gemeint, dass er von seinem sozialen Umfeld zunehmend isoliert wird und seine soziale Rolle innerhalb der Familie oder des Arbeitslebens zu verlieren droht. Am deutlichsten erkennt man dies daran, dass die Aufgaben, die der Patient vor seiner Krankheit innehatte, bereits zwangsweise umverteilt wurden (Erben (2001), S. 37).
2. Geschichte
„Die Palliative Care hat ihren Ursprung in Kanada und ist in den Ansätzen der Hospizbewegung und Palliativmedizin verwurzelt“ (Erben (2001), S. 134). Das Besondere an dieser medizinischen Einrichtung ist, dass sie anders als die Medizin allgemein nicht kurativ also nicht heilend tätig wird, sondern zum Ziel hat die krankheitsbedingten Beschwerden der Patienten zu lindern und damit eine subjektiv erlebte Lebensqualität anzustreben. Abgeleitet wird „ Palliative Care “ von dem lateinischen Wort „pallium“, was „Mantel“ bedeutet und dem Wort „palliare“, was „bedecken“ oder „umhüllen“ bedeutet. Dies ist durchaus symbolisch zu sehen, es geht darum, den Menschen ein eigenbestimmtes Leben bis zum Schluss zu ermöglichen, da zu sein, auszuhalten, eben „umhüllen“ und „bedecken“. Daran reiht sich das englische Wort „care“, was mit „Fürsorglichkeit“ übersetzt wird und womit weit mehr als die medizinische Versorgung gemeint ist (Erben (2001), S. 138).
Weiterhin ist in diesem Ansatz wichtig, die Angehörigen des Sterbenden in ihrer Trauer zu begleiten und keinesfalls alleine zu lassen. Die Palliative Care sieht den Menschen als biopsychosoziale Einheit und ist darum bemüht, den sterbenden Menschen individuell zu betreuen. So sind „Bedürfnisse, Wünsche sowie Autonomie der Sterbenden (…) Ansatzpunkte für jegliches Handeln“ (Erben (2001), S. 135). Alle beteiligten Personen und Organisationen sollten das Ziel verfolgen, dem Sterbenden eine subjektiv optimale Lebensqualität zu ermöglichen. Dabei darf die Einzigartigkeit eines jeden Sterbenden nicht aus dem Blickfeld geraten, denn erst mit dem Fokus auf das Erleben des Sterbenden kann eine ganzheitliche Begleitung im Sterben gelingen (Erben (2001), S. 135). Ein weiteres Merkmal der Palliative Care ist das multiprofessionelle Team, welches aus Professionellen (Ärzten, Pflegekräften, Sozialarbeitern) zum einen besteht und aus Laien (also Ehrenamtlichen) zum anderen. Dieses Team arbeitet miteinander, was funktionierende Kommunikations-strukturen und gute Teamarbeit voraussetzt (Erben (2001), S. 136). Nach der Weltgesundheitsorganisation WHO bedeutet Palliative Care: „Palliativmedizin ist ein Ansatz zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und ihren Familien, die mit den Problemen konfrontiert sind, die mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung einhergehen, und zwar durch Vorbeugen und Lindern von Leiden, durch frühzeitiges Erkennen, gewissenhafter Einschätzung und Behandlung von Schmerzen sowie anderen belastenden Beschwerden körperlicher, psychosozialer und spiritueller Art“ (palliativecare.bbraun.de)
Die Hospizarbeit entstand nach der Idee, (sterbenden) Menschen bis zum Lebensende ein Leben in Geborgenheit zu ermöglichen. Die beiden Gründerinnen Elisabeth Kübler-Ross und Cicley Saundes haben diese Idee entwickelt, aus dem Umstand heraus, dass C. Saundes ihren schwer kranken Mann pflegte, sich mit den herrschenden Umständen konfrontiert sah und diese ändern wollte. Die Entwicklung der Hospize (in den 80er Jahren) war in den Anfängen eher eine subversive Bewegung. Das heißt, die Kranken wurden nicht individuell betreut sondern eher „gesammelt“ und von der Öffentlichkeit fern gehalten. Die ersten Hospize verstanden sich also als stationäre Einrichtungen, der Gedanke, die Hospizidee als Konzept zu betrachten, nicht als Institution, setzte sich erst in den 90er Jahren durch. Damit wurde auch deutlich, dass die Hospizarbeit also den Wünschen der Sterbenden gerecht werden soll und damit vor allem ein Sterben zu Hause ermöglichen muss, mit entsprechender Unterstützung der Angehörigen. In den Anfängen arbeiteten vor allem Ehrenamtliche Gruppen in den Hospizen, diese waren an Kirchengemeinden gebunden (Student u.a. (2004), S. 145). Auch heute spielen die Ehrenamtlichen Mitarbeiter eine besondere Rolle in der Arbeit mit den Sterbenden. Der Gedanke, die Hospizidee als Konzept zu sehen was sich deutlich gegen die Institutionalisierung der Sterbenden ausspricht, kam bis heute in der Politik noch nicht an, so werden die stationären Einrichtungen finanziell mehr gefördert als die ambulanten – ganz gegen den Grundsatz: „ambulant vor stationär“ (Student u.a. (2004), S. 145).
Das Wort „Hospiz“ ist vom lateinischen „hospitum“ abgeleitet, was „Herberge“ bedeutet, das Hospiz ist also als (letzte) Herberge der Sterbenden zu sehen. So werden die Kranken dort auch nicht als „Patienten“ bezeichnet, sondern als „Gast“ oder „Besucher“. Hospize haben folgenden Ansatz: „Hospize bejahen das Leben. Hospize machen es sich zur Aufgabe, Menschen in der letzten Phase einer unheilbaren Krankheit zu unterstützen und zu pflegen, damit sie in dieser Zeit so bewusst und zufrieden wie möglich leben können (Student u.a. (2004), S. 139).
3. Begriffserklärung Hospizarbeit
Wie im letzten Abschnitt schon erläutert, geht es in der Hospizarbeit darum, Sterben als einen Teil des Lebens zu betrachten, trotz der ängstlichen Gefühle, die damit einhergehen. Die Angst vor dem Tod begleitet den Menschen seit jeher, mit ihr geht das Bemühen einher, diese Angst zu bewältigen. Eine immer wiederkehrende Bewältigungsstrategie ist der Gedanke an das Fortbestehen der irdischen Existenz im Jenseits (Student u.a. (2004), S. 133). Auch Derjenige, der den Tod aufgrund seines Glaubens als „Tor zum wahren Leben“ begreift, fürchtet sich vor dem Sterben als schmerzhaften Prozess. In jedem Fall ist das Sterben „ein sozialer Prozess, der Raum, Zeit und sensible Begegnung braucht“ (Student u.a. (2004), S. 14).
Aus dieser Einstellung heraus ist die Hospizarbeit entstanden, deren Kerngedanke ist, dass das Sterben vor allen Dingen ein Teil des Lebens ist und aus diesem Grund in den Alltag und somit in den Gesellschaftlichen Blickwinkel zurückzuführen ist. Ziel ist es, wie bereits erwähnt, unheilbar kranke und sterbende Menschen darin zu unterstützen, die verbleibende Lebenszeit so beschwerdearm und inhaltsvoll wie möglich zu gestalten. Dies sollte, wenn irgendwie möglich, im häuslichen Umfeld geschehen, dass heißt „eigentliche“ Hospizarbeit ist die ambulante Lebenshilfe in der Phase des Sterbens und die Unterstützung der Angehörigen, so dass diese sich in der Lage fühlen, den Kranken zu Hause (mit) zu betreuen. Nur im Fall, dass die Angehörigen sich gar nicht in der Lage sehen, den Kranken zu Hause aufzunehmen, ist eine stationäre Unterbringung des Sterbenden vorgesehen. Dies wäre dann in einem stationären Hospiz möglich. Trotzdem sollte nochmals betont werden, dass die „eigentliche“ Hospizidee keineswegs an eine Institution gebunden ist. Im Gegenteil, die Hospizbewegung will eine Institutionalisierung vermeiden, sie greift als Konzept. Im Respekt und der Achtung der Würde des Menschen bis zuletzt drückt sich die hospizliche Grundhaltung aus, sie nimmt seine Anliegen ernst, lässt den Sterbenden nicht allein, unterstützt und stärkt die Angehörigen und versucht durch Nähe „nicht Hilfe zum Sterben, sondern Hilfe zum Leben während des Sterbens“ (Student u.a. (2004), S. 16) zu geben (Student u.a. (2004),
Diese Grundhaltung wird heute in drei verschiedenen Formen der Hospizarbeit angeboten und umgesetzt: einmal in Form der ambulanten Hilfe, also stark bezogen auf die „eigentliche“ Idee, die Form der teilstationären Einrichtungen und die stationären Einrichtungen.
Der Schwerpunkt der Hospizarbeit sollte im ambulanten Bereich liegen, ist doch nur dort die eigentliche Hospizidee umgesetzt, nämlich im häuslichen Umfeld eine Situation zu schaffen, in der es möglich ist, dem Sterbenden einen Abschied vom Leben in Geborgenheit zu bieten. Unter einem ambulanten Hospiz ist also eine Organisationsform zu verstehen, die ein komplettes Betreuungsangebot zu Hause ermöglicht und folgende Anforderungen erfüllt:
- 24 Stunden Bereitschaft
- das Team muss über Kenntnisse, Erfahrungen und Möglichkeiten der Symptomkontrolle (Schmerztherapie) verfügen
- für die Familie müssen ausreichend Entlastungsangebote bereitstehen (Student u.a. (2004), S. 87)
Zum Konzept gehört auch, dass sie nur für Menschen gedacht sind, die sich in den allerletzten Lebenswochen befinden. Es soll die Unterstützungsaufgabe der Sterbenden und der Angehörigen federführend übernehmen, das heißt, es soll die ganzheitliche Betreuung koordinieren und mit anderen Einrichtungen und Hilfsangeboten kooperieren. Auch wenn die Wünsche Sterbender so individuell und verschieden sind, wie es der Mensch selbst auch ist, gibt es einen Wunsch der immer wieder auftaucht: Der Wunsch zu Hause zu sterben. Dies zu ermöglichen sollte Aufgabe der ambulanten Hospize sein.
Um dem Wunsch nach würdevollem Sterben auch unter dem Umstand dass die Angehörigen den Sterbenden nicht zu Hause betreuen können, weitestgehend nachzukommen, gibt es stationäre Hospize. Dies sind kleine Einheiten mit um die zwölf Betten. Die Atmosphäre soll familiär sein und eher an eine Wohngemeinschaft, denn an ein Krankenhaus erinnern. Die Patienten finden dort Aufnahme, wenn sie an einer tödlichen Erkrankung leiden, die unaufhaltsam ist und in absehbarer Zeit zum Tode führt. Es gibt aber auch Patienten die nur für einen „Zwischenaufenthalt“ im Hospiz sind, zum Beispiel bis die Beschwerden soweit reduziert sind, bis die Patienten wieder nach Hause können. Stationäre Hospize können also Endstationen sein, müssen sie aber nicht zwangsläufig (Student u.a. (2004), S. 87).
Eine weitere Form der Hospizarbeit, die in Deutschland noch in den Anfängen steckt, ist die teilstationäre Hospizarbeit oder die Tageshospize. Ihre Aufgabe liegt darin, „die palliativmedizinische Versorgung bis weit in das Vorfeld der Endphase einer tödlichen Erkrankung zu verlagern“ (Student u.a. (2004), S. 91) und hat zum Ziel, dem schwer kranken Menschen Gelegenheit zu geben, noch vorhandene Fähigkeiten zu aktivieren oder neue zu entwickeln. Die Tageshospize bieten den Kranken also einen Tagestreff, was besonders für die Erkrankten wichtig ist, die durch ihre Krankheit bereits aus allen sozialen Bezügen gerissen worden. Auch für Fragen der Kranken und ihrer Angehörigen sind die Tageshospize da, ebenso für fachkundige Beratung und konkrete Hilfen. Weitere Punkte, die die Wichtigkeit dieser teilstationären Angebote verdeutlichen sollen, werden im Folgenden auszugsweise aufgelistet:
- die Tageshospize dienen der Reintegration der Schwerkranken in Gesellschaftliche Bezüge
- sie ermöglichen neue Beziehungen und damit das Erleben, nicht allein zu sein
- sie stärken das Selbstwertgefühl der Kranken (Student u.a. (2004), S. 93)
Vor allem aber tragen Tageshospize zu einem ganz entscheidenden Punkt bei: dass die Patienten so lange wie möglich zu Hause bleiben können und sie somit dem Wunsch, zu Hause sterben zu können, besonders nahe kommen.
4. Die Klienten der Palliativstationen und Hospize in Deutschland
Im Blickpunkt der Palliative Care stehen Menschen, welche an einer unheilbaren Erkrankung im fortgeschrittenen Stadium leiden.
Hierzu gehören in erster Linie Menschen mit einer fortgeschrittenen Krebserkrankung, welche nicht mehr in der Lage sind, selbstständig für sich zu sorgen. Oftmals kommt zu dieser Einschränkung der Verlust der Eigenmacht über Körper und häufig auch Geist sowie eine hohe schmerzbedingte Belastung mit hinzu.
Häufigste Krebserkrankungen sind:
- Hirntumore
- Brustkrebs
- Kehlkopfkrebs
- Lungenkrebs
- Darmkrebs
- Prostatakrebs
- Gebärmutterhalskrebs
- Hautkrebs
Weiterhin gehören Menschen mit fortgeschrittener Aidserkrankung zu den am häufigsten Betroffenen, welche auf Palliative Fürsorge angewiesen sind. Auch hier gilt es die PatientInnen im Endstadium der Erkrankung psychisch und körperlich optimal zu betreuen. An Aids erkrankte Menschen leiden im Endstadium der Erkrankung häufig an opportunistische Infektionen (Infektionen welche durch Pilze, Viren, Parasiten und/oder Bakterien verursacht werden), welche die Entstehung von Krebs, die Degeneration des Zentralen Nervensystems und Entzündungen zur Folge haben können und tödlich verlaufen, da das Immunsystem über keinerlei Abwehrfunktionen mehr verfügt.
Als dritte Gruppe sind Patienten zu nennen, welche an der Amyotrophischen Lateralsklerose, dem so genannten Nervenschwund leiden. Auch hier liegt eine Degeneration des Zentralen Nervensystems vor, welche zur vollständigen Lähmung führt. Wie bereits bei den beiden vorangegangenen Erkrankungen gilt es auch hier, die körperliche und psychische Betreuung im Endstadium zu gewährleisten (wikipedia.org).
Natürlich sind diese drei Erkrankungsarten lediglich die am häufigsten vertretenen. Jedem Menschen, der in die Lage gerät, unheilbar krank zu sein ist möglich, für sich und seine Angehörigen Hilfe und Unterstützung sowohl in der ambulanten, als auch stationären Palliative Care zu suchen.
5. Probleme
Spricht man über die Themen Sterben, Trauer und Tod, so fällt auf, dass es drei Kategorien gibt, die mit den Problemen des Sterbens konfrontiert werden oder von denen die Probleme ausgehen. Um welche Probleme es sich bei jeder Gruppe genau handelt, darum soll es in diesem Abschnitt gehen.
Der Patient befindet sich in einer paradoxen Situation: er kommt krankheitsbedingt in eine öffentliche Institution, wird also von einem Privatmenschen zu einer öffentlichen Person, wird aber aufgrund seiner Situation (dass er Sterbender ist) gleichzeitig von der Öffentlichkeit gemieden.
Des Weiteren hat er mit den psychosozialen Aspekten des Sterbens zu kämpfen. Damit ist gemeint, dass jede Krankenhaus- oder Hospiz-einweisung auch mit Ängsten und Unsicherheiten verbunden ist. Die Patienten sehen sich zum Beispiel bewusst oder unbewusst mit der Frage konfrontiert, ob sie noch einmal nach Hause entlassen werden können oder nicht. Sie müssen sich dem Stationsalltag anpassen und sich auf alles Neue einstellen. Am Wesentlichsten für die Situation sterbender Menschen im Krankenhaus oder Hospiz sind folgende drei Verlustmerkmale verantwortlich (Erben (2001), S. 66):
Zum einen ist das der Verlust der Persönlichkeit, dies bedeutet, dass der Erkrankte nun nicht mehr Landschaftsarchitekt oder Bürokaufmann ist, sondern „nur“ noch ein sterbender Patient. Der Kranke fühlt sich auf seinen körperlichen Zustand reduziert und nicht mehr als mehrdimensionaler Mensch, mit all seinen Empfindungen wahrgenommen. Zum anderen gehört der Verlust des sozialen Umfeldes dazu, das heißt in erster Linie die Abwesenheit der Angehörigen und die damit verbundene Sorge um sie. Oftmals versuchen die Angehörigen den Kranken zu schonen und berichten ihm deswegen nicht was es zu Hause Neues gibt, weil dies alles so unbedeutend scheint im Vergleich zu dem was der Erkrankte durchmacht. Jedoch sind genau die kleinen Dinge, die dem Patienten fehlen und helfen würden, am Alltag dennoch teil zu haben. Leider ist dies nicht oft der Fall. Zumeist haben sich die Menschen in seiner Umgebung bereits zurückgezogen, womit auch vom „sozialen Tod“ gesprochen werden kann.
Des Weiteren ist der Verlust der Geborgenheit und Vertrautheit ein wichtiger Punkt, wobei damit als erstes die vertraute Umgebung des Kranken gemeint ist, aber auch der Alltagsrhythmus, die Lieblingsdecke, das Haustier und andere dem Patienten lieb gewordene Dinge. Woraus die eben genannten Verluste resultieren ist in einem Punkt zusammengefasst: Der Verlust der körperlichen Unversehrtheit und Kontrolle. Denn der Sterbeprozess geht mit zunehmend körperlichen Einschränkungen einher, die von den Sterbenden bewusst erlebt werden (z.B. Inkontinenz) (Erben (2001), S. 66). Aufgrund dessen kann der Kranke seine Bedürfnisse immer weniger selber befriedigen, sondern ist auf die Hilfe fremder Menschen angewiesen. So benötigt er Hilfe beim An- und Auskleiden oder bei der Körperpflege (Erben (2001), S. 92). „Ein sterbender Patient ist also vermehrt den Verhaltensweisen, der Willkür, dem Wollen oder Nicht-Wollen, dem Können oder Nicht-Können anderer Menschen ausgeliefert“ (Erben (2001), S. 92).
[...]
- Quote paper
- Karin Luther (Author), 2009, Palliative Care und Soziale Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/146013