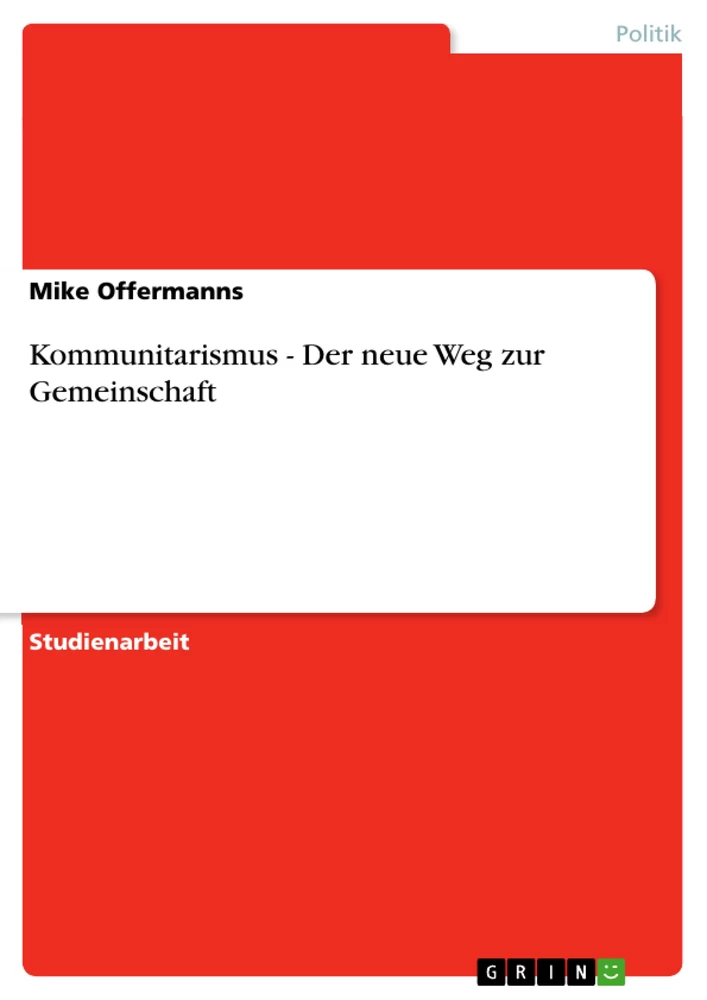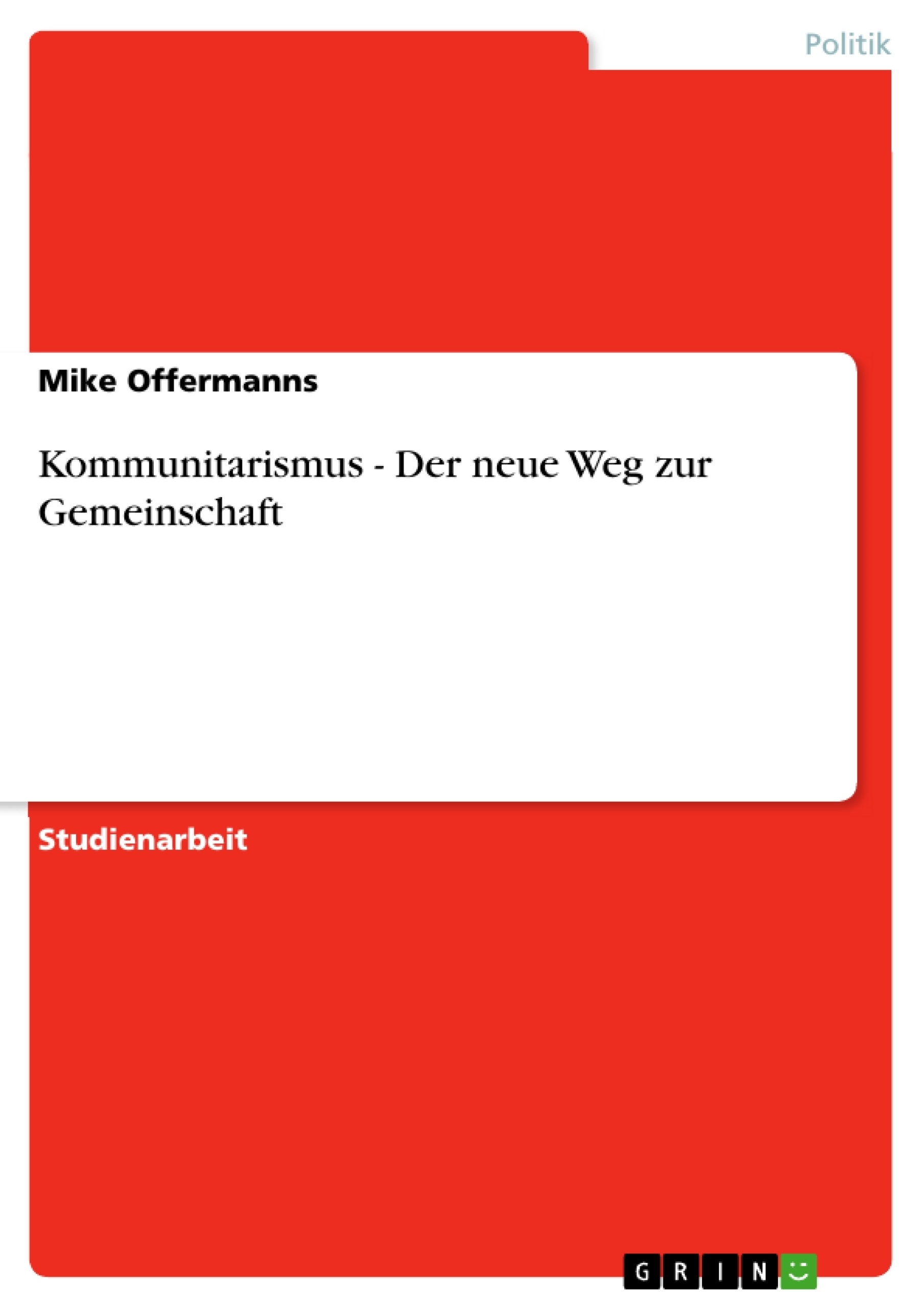Das kommunitaristische Denken
Seit Anfang der 80er Jahre wird die politische Debatte durch eine
neue, aus den Vereinigten Staaten von Amerika kommende Bewegung
angeheizt. Unter dem Begriff des „Kommunitarismus“ wird zu mehr
Solidarität und zu mehr Gemeinschaft aufgerufen. Der Begriff leitet
sich aus dem amerikanischen Begriff der „community“ ab und
bedeutet so viel wie Gemeinsinn oder Gemeinwesen. Eine
Verbindung zum Kommunismus gibt es aber nicht.
Gründer dieser Bewegung sind Soziologen, Politologen und
Philosophen, die für eine Reformierung der Gesellschaft und für eine
„Politisierung der Bürgerschaft“(1) plädieren. Der neue Weg zur
Gemeinschaft geht von der Notwendigkeit aus, das Gemeinwohl
wieder zu entdecken und den Gemeinsinn zu fördern. Die
zunehmende Individualisierung ist eine Gefahr für die bestehende
Gesellschaftsstruktur. „Uneingeschränkte, individuelle
Freiheitsentfaltung [...] untergräbt auf die Dauer die Fundamente der
Demokratie.“(2) Die Gemeinschaft muß wieder gestärkt werden, damit
der Mensch sich als gesellschaftliches Wesen wieder innerhalb einer
Gemeinschaft frei entfalten kann. Hat sich die Auflösung der
Gemeinschaft einmal vollzogen, dann stehen nach Toqueville „die
Menschen nebeneinander, ohne daß ein gemeinsames Band sie
zusammenhält.“(3)
[...]
_____
1 Otto Kallscheuer: Gemeinsinn und Demokratie, in: Christel Zahlmann (Hrsg.): Kommunitarismus in der Diskussion – Eine streitbare Einführung, Hamburg 1994, S. 115
2 Irene Albers: Kunst der Freiheit – Kommunitaristische Anleihen bei Toqueville in: Christel Zahlmann, a.a.O.
3 Alexis de Toqueville: Über die Demokratie in Amerika, Zürich 1987, S. 432
Inhaltsverzeichnis
- Das kommunitaristische Denken
- John Rawls Theorie der Gerechtigkeit
- Voraussetzungen für eine Gerechtigkeitskonzeption
- Das ungebundene Selbst
- Strategien zur Erstellung einer Gerechtigkeitskonzeption
- Die zwei Prinzipien der Gerechtigkeitskonzeption
- Folgerungen aus den Prinzipien
- Anforderungen an den Staat
- Die Handhabung des Differenzprinzips in der Wirtschaft
- Voraussetzungen für eine Gerechtigkeitskonzeption
- Die anthropologische Liberalismus-Kritik
- Kritik des ungebundenen Selbst
- Kritik an der liberalen Demokratievorstellung
- Der schrankenlose Pluralismus
- Kommunitäre politische Theorie
- Aristoteles und Rousseau
- Michael Walzers Prinzip der komplexen Gleichheit
- Charles Taylor und der liberale Republikanismus
- Amitai Etzioni und der Pluralismus in der Einheit
- Der substantialistische Kommunitarismus
- Benjamin Barbers und die starke Demokratie
- Partizipatorisch-republikanischer Kommunitarismus
- Die Grundkonzeption der starken Demokratie
- Kritik an Barbers Grundkonzeption
- Kommunitarismus in der Kritik
- Die Einschränkung der Rechte des Individuums
- Der Begriff der Volksgemeinschaft
- Nationale Identität im Zeitalter der Globalisierung
- Die fehlenden Voraussetzungen zur Partizipation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Werk befasst sich mit dem Kommunitarismus, einer politischen Denkrichtung, die seit den 1980er Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Es analysiert die Kernaussagen des Kommunitarismus und setzt sie in Relation zu den liberalen Denktraditionen, insbesondere der Gerechtigkeitstheorie von John Rawls. Die Arbeit untersucht die Kritik des Kommunitarismus am Liberalismus und beleuchtet die wichtigsten Strömungen des kommunitaristischen Denkens.
- Kritik am Liberalismus und der Idee des ungebundenen Selbst
- Die Bedeutung der Gemeinschaft und des Gemeinwohls für ein gerechtes Zusammenleben
- Die Rolle von Tradition, Tugend und politischer Partizipation in einer kommunitaristischen Gesellschaft
- Die verschiedenen Strömungen des Kommunitarismus: von Aristoteles und Rousseau bis hin zu Michael Walzer, Charles Taylor und Benjamin Barber
- Die Herausforderungen und Kritikpunkte, die sich im Zusammenhang mit dem Kommunitarismus stellen
Zusammenfassung der Kapitel
- Das kommunitaristische Denken: Dieses Kapitel führt in die Grundprinzipien des Kommunitarismus ein und stellt die zentralen Argumente der Bewegung vor. Es beleuchtet die Kritik am Liberalismus und die Bedeutung des Gemeinwohls und der Gemeinschaft für das menschliche Zusammenleben.
- John Rawls Theorie der Gerechtigkeit: Dieses Kapitel analysiert die Gerechtigkeitstheorie von John Rawls, die einen wichtigen Bezugspunkt für die kommunitaristische Kritik darstellt. Es behandelt die Voraussetzungen für eine Gerechtigkeitskonzeption, die zwei Prinzipien der Gerechtigkeitstheorie und ihre Folgen für die Gesellschaft.
- Die anthropologische Liberalismus-Kritik: Dieses Kapitel präsentiert die Kritik des Kommunitarismus am liberalen Menschenbild und der Vorstellung eines ungebundenen Selbst. Es beleuchtet die Kritik an der liberalen Demokratievorstellung und die Problematik des schrankenlosen Pluralismus.
- Kommunitäre politische Theorie: Dieses Kapitel skizziert die wichtigsten Strömungen des kommunitaristischen Denkens. Es geht auf die politischen Theorien von Aristoteles und Rousseau ein, beleuchtet den liberalen Republikanismus von Charles Taylor und die Theorie der starken Demokratie von Benjamin Barber.
- Kommunitarismus in der Kritik: Dieses Kapitel setzt sich mit den Kritikpunkten auseinander, die am Kommunitarismus geäußert werden. Es beleuchtet die Kritik an der Einschränkung individueller Rechte, den Begriff der Volksgemeinschaft und die Herausforderungen in Bezug auf nationale Identität und Partizipation in der globalisierten Welt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Konzepte, die in diesem Werk behandelt werden, sind: Kommunitarismus, Liberalismus, Gerechtigkeit, Gemeinwohl, Gemeinschaft, Tradition, Tugend, Partizipation, Pluralismus, Demokratie, nationale Identität, Globalisierung, Volksgemeinschaft.
- Quote paper
- Mike Offermanns (Author), 1999, Kommunitarismus - Der neue Weg zur Gemeinschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1455