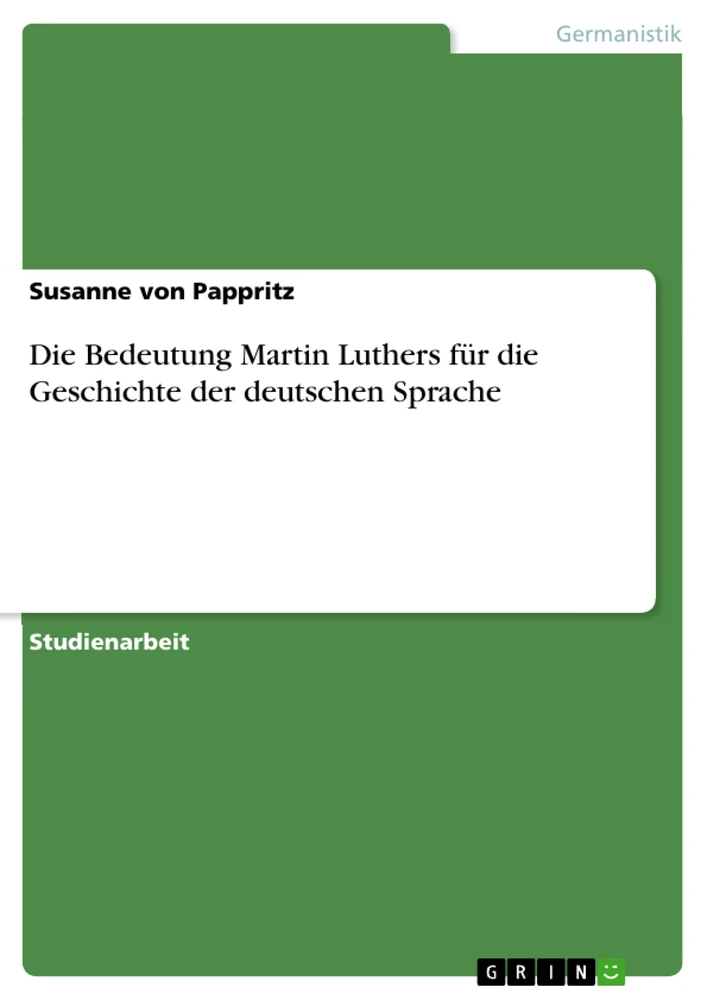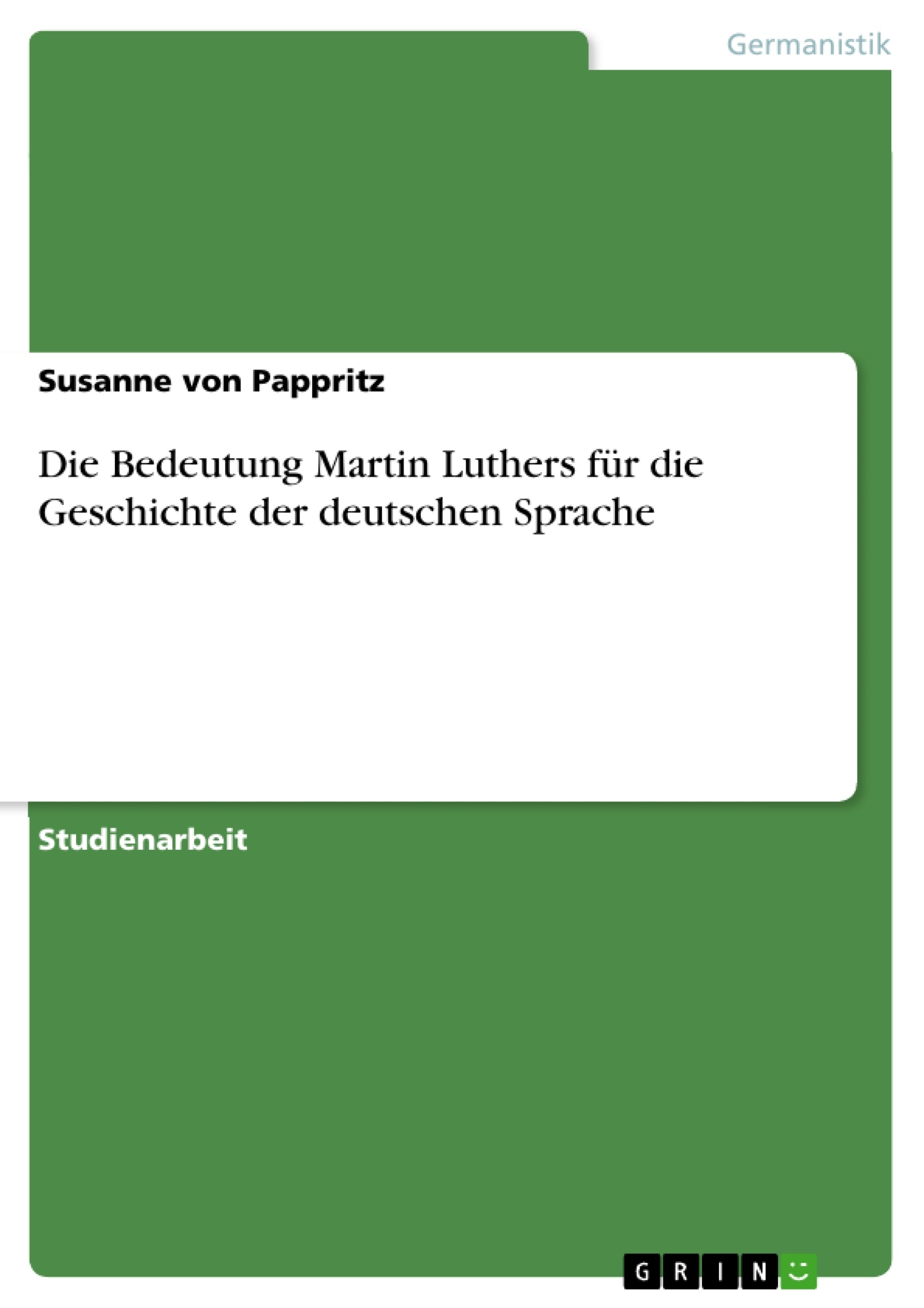Ziel dieser Arbeit soll es sein, eine relativierende und möglichst objektive Betrachtung des lutherischen Sprachphänomens anzustreben, ohne die sprachgeschichtliche Leistung Luthers zu schmälern. Denn ohne Zweifel haben Luthers Schriften und Bibelübersetzungen wesentlich zur Verbreitung und Durchsetzung einer allgemeinen deutschen Hochsprache beigetragen. Wie Luther besonders durch seine Bibelübersetzung als entscheidende und größte Sprachleistung die Standardisierung der deutschen Sprache vorangetrieben hat, soll im Folgenden näher erläutert werden. Eine wichtige Rolle werden dabei Voraussetzungen spielen, ohne die Luthers Schriften nicht gleichermaßen hätten wirken können. Es sollen sowohl äußere Voraussetzungen wie beispielsweise der Buchdruck angesprochen werden; aber auch die inneren Voraussetzungen, diejenigen, die Luther selbst mit sich brachte. Um die Besonderheiten der Sprache Luthers aufzuzeigen, die in den folgenden Ausführungen als Sprachvorgaben bezeichnet werden, soll anschließend auf bestimmte Sprachaspekte – die für Luther charakteristisch sind – der Lexik und Orthographie eingegangen werden.
„Er war ein trefflicher, gewaltiger Redener. Item ein überaus gewaltiger Dolmetzscher der gantzen Bibel. Es haben auch die Cantzleien zum teil von im gelernet recht deudsch schreiben und reden, denn er hat die Deudsche sprach wider recht herfür gebracht, das man nu wider kann recht deudsch reden und schreiben und wie das viel hoher leut mussen zeugen und bekennen.“ Justus Jonas charakterisierte mit diesen wenigen Zeilen Luthers Bedeutung und sprachgeschichtliche Errungenschaften aufs Trefflichste. Der enge Freund Martin Luthers sprach anlässlich der Beisetzung des Reformators im Jahre 1546 aus, was später Gegenstand zahlreicher Disputationen wird: Luthers Rolle in der deutschen Sprachgeschichte. Dabei lassen sich in der Forschungsliteratur zwei grundlegende Theorien verfolgen: Luther als Schöpfer der neuhochdeutschen Schriftsprache und Luther, der den Pöbel-Jargon heraufbeschwor, so dass eine hohe Sprachkultur nicht verwirklicht werden konnte.
Inhaltsverzeichnis
- Zur Begründung der Thematik
- Sprachgeschichtliche Vorbetrachtungen zum 16. Jahrhundert
- Luther und die Entstehung des Neuhochdeutschen
- Voraussetzungen
- Die Lutherbibel als Durchbruch regionaler Sprachschranken
- Sprachvorgaben Luthers
- Lexik
- Orthographie
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht Luthers Beitrag zur Entwicklung des Neuhochdeutschen. Sie strebt eine objektive Betrachtung an, die sowohl Luthers sprachliche Leistungen anerkennt als auch die komplexen sprachgeschichtlichen Umstände berücksichtigt. Die Arbeit vermeidet eine einseitige Zuschreibung von Luthers Rolle als alleinigen Schöpfer oder Zerstörer einer hohen Sprachkultur.
- Luthers Einfluss auf die Standardisierung der deutschen Sprache
- Die sprachliche Situation im 16. Jahrhundert und die Rolle der Dialekte
- Luthers Bibelübersetzung als Katalysator für sprachliche Einheitlichkeit
- Luthers spezifische Sprachvorgaben in Lexik und Orthographie
- Die Voraussetzungen für Luthers sprachlichen Einfluss (z.B. Buchdruck)
Zusammenfassung der Kapitel
Zur Begründung der Thematik: Der einleitende Abschnitt thematisiert die gegensätzlichen Auffassungen über Luthers sprachlichen Einfluss: als Schöpfer des Neuhochdeutschen oder als Verursacher eines "Pöbel-Jargons". Die Arbeit legt eine objektive und relativierende Betrachtung Luthers sprachlicher Leistung dar, die die Bedeutung seiner Schriften und Bibelübersetzungen für die Verbreitung einer einheitlichen deutschen Hochsprache hervorhebt. Die Arbeit kündigt die Untersuchung der Voraussetzungen für Luthers Erfolg und die Analyse seiner spezifischen Sprachvorgaben an.
Sprachgeschichtliche Vorbetrachtungen zum 16. Jahrhundert: Dieses Kapitel beschreibt das sprachliche Umfeld des 16. Jahrhunderts in Deutschland. Die starke regionale Zersplitterung der deutschen Sprache mit einer Vielzahl von Dialekten wird hervorgehoben, im Kontrast zur einheitlichen Verwendung des Lateinischen in Kirche, Wissenschaft und Bildung. Das Fehlen eines zentralen, sprachlich einheitsstiftenden Zentrums wird als ein wichtiger Faktor für die sprachliche Vielfalt genannt. Die Reformation Luthers wird als ein entscheidendes Ereignis dargestellt, das die deutsche Sprache und Literatur mit neuen Ansprüchen erfüllte und einen Prozess der Standardisierung einleitete, der sich über mehrere Jahrhunderte erstreckte.
Luther und die Entstehung des Neuhochdeutschen: Dieses Kapitel argumentiert für die Sichtweise, dass Luther einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung des Neuhochdeutschen leistete. Die Bibelübersetzung wird als ein bedeutender Faktor für den Wandel vom Frühneuhochdeutschen zum Neuhochdeutschen angesehen. Die Arbeit betont die Komplexität des Prozesses und räumt ein, dass Luthers Rolle nicht als alleiniger Schöpfer gesehen werden kann. Der Fokus liegt auf Luthers Anteil an der zunehmenden Normierung der Sprachverhältnisse und der Bereicherung der Sprache durch seine Wortschöpfungskraft. Die Uneinigkeit in der Forschung über den genauen Beginn der Entstehung des Neuhochdeutschen wird ebenfalls erwähnt.
Schlüsselwörter
Martin Luther, Neuhochdeutsch, Bibelübersetzung, Sprachstandardisierung, Dialekte, Sprachgeschichte, Frühneuhochdeutsch, Lexik, Orthographie, Reformation.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu: Luthers Beitrag zur Entwicklung des Neuhochdeutschen
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den Beitrag Martin Luthers zur Entwicklung des Neuhochdeutschen. Sie analysiert seinen Einfluss auf die Sprachstandardisierung, berücksichtigt die sprachgeschichtlichen Umstände des 16. Jahrhunderts und vermeidet eine einseitige Darstellung seiner Rolle.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit strebt eine objektive Betrachtung Luthers sprachlicher Leistungen an. Sie würdigt seine Beiträge zur Sprachentwicklung, berücksichtigt aber auch die Komplexität des Prozesses und vermeidet eine Überbewertung seiner Rolle als alleiniger Schöpfer des Neuhochdeutschen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Luthers Einfluss auf die Standardisierung der deutschen Sprache, die sprachliche Situation im 16. Jahrhundert (inklusive der Rolle der Dialekte), seine Bibelübersetzung als Katalysator für sprachliche Einheitlichkeit, seine spezifischen Sprachvorgaben in Lexik und Orthographie und die Voraussetzungen für seinen sprachlichen Einfluss (z.B. den Buchdruck).
Wie wird die Rolle Luthers in der Sprachentwicklung dargestellt?
Die Arbeit argumentiert, dass Luther einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung des Neuhochdeutschen leistete, insbesondere durch seine Bibelübersetzung. Sie betont jedoch die Komplexität des Prozesses und räumt ein, dass seine Rolle nicht als die eines alleinigen Schöpfers gesehen werden kann. Sein Einfluss auf die zunehmende Normierung der Sprachverhältnisse und die Bereicherung der Sprache durch seine Wortschöpfungskraft stehen im Vordergrund.
Welche sprachliche Situation herrschte im 16. Jahrhundert in Deutschland?
Das 16. Jahrhundert in Deutschland war durch eine starke regionale Zersplitterung der deutschen Sprache mit einer Vielzahl von Dialekten gekennzeichnet. Im Gegensatz dazu stand die einheitliche Verwendung des Lateinischen in Kirche, Wissenschaft und Bildung. Das Fehlen eines zentralen, sprachlich einheitsstiftenden Zentrums wird als ein wichtiger Faktor für die sprachliche Vielfalt genannt.
Wie wird die Bedeutung der Lutherbibel dargestellt?
Die Lutherbibel wird als bedeutender Faktor für den Wandel vom Frühneuhochdeutschen zum Neuhochdeutschen angesehen. Sie trug maßgeblich zur Verbreitung einer einheitlichen deutschen Hochsprache bei und beeinflusste die Entwicklung von Lexik und Orthographie.
Welche Aspekte von Luthers Sprachgebrauch werden untersucht?
Die Arbeit untersucht Luthers spezifische Sprachvorgaben in Lexik (Wortwahl) und Orthographie (Schreibweise). Sie analysiert, wie diese Vorgaben zur Standardisierung der deutschen Sprache beitrugen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die Schlüsselwörter sind: Martin Luther, Neuhochdeutsch, Bibelübersetzung, Sprachstandardisierung, Dialekte, Sprachgeschichte, Frühneuhochdeutsch, Lexik, Orthographie, Reformation.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zur Begründung der Thematik, sprachgeschichtlichen Vorbetrachtungen zum 16. Jahrhundert, Luther und die Entstehung des Neuhochdeutschen (mit Unterkapiteln zu Voraussetzungen, der Lutherbibel und Luthers Sprachvorgaben in Lexik und Orthographie) und eine Schlussbetrachtung.
Wie wird die Kontroverse um Luthers sprachlichen Einfluss dargestellt?
Die Arbeit thematisiert die gegensätzlichen Auffassungen über Luthers sprachlichen Einfluss – als Schöpfer des Neuhochdeutschen oder als Verursacher eines "Pöbel-Jargons". Sie plädiert für eine objektive und relativierende Betrachtung, die sowohl seine Leistungen anerkennt als auch die komplexen sprachgeschichtlichen Zusammenhänge berücksichtigt.
- Quote paper
- Susanne von Pappritz (Author), 2006, Die Bedeutung Martin Luthers für die Geschichte der deutschen Sprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1453589