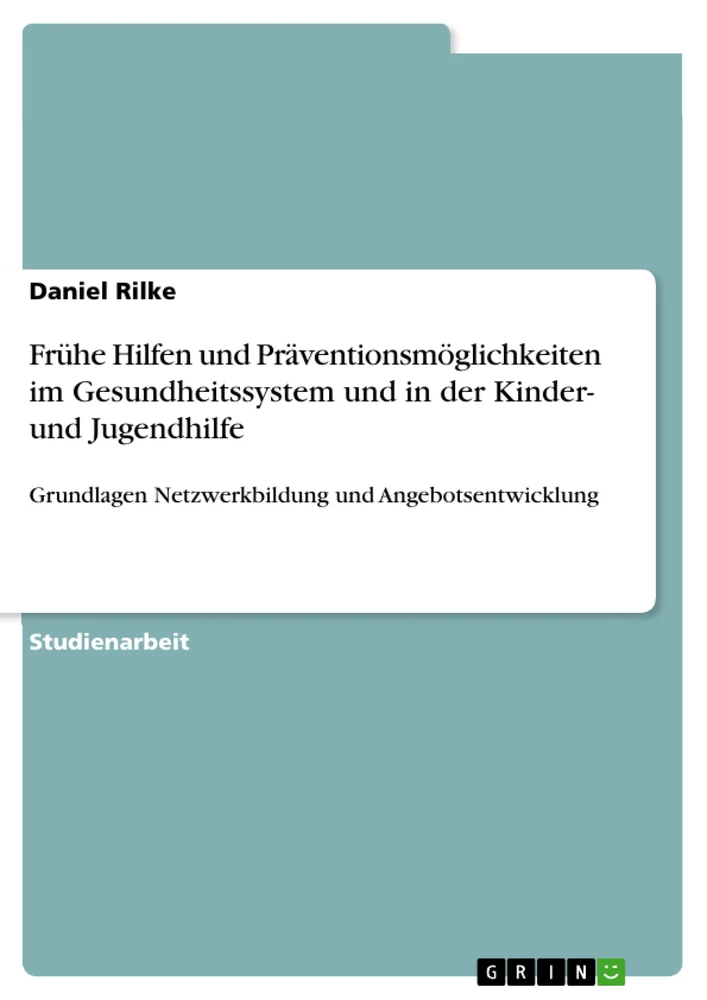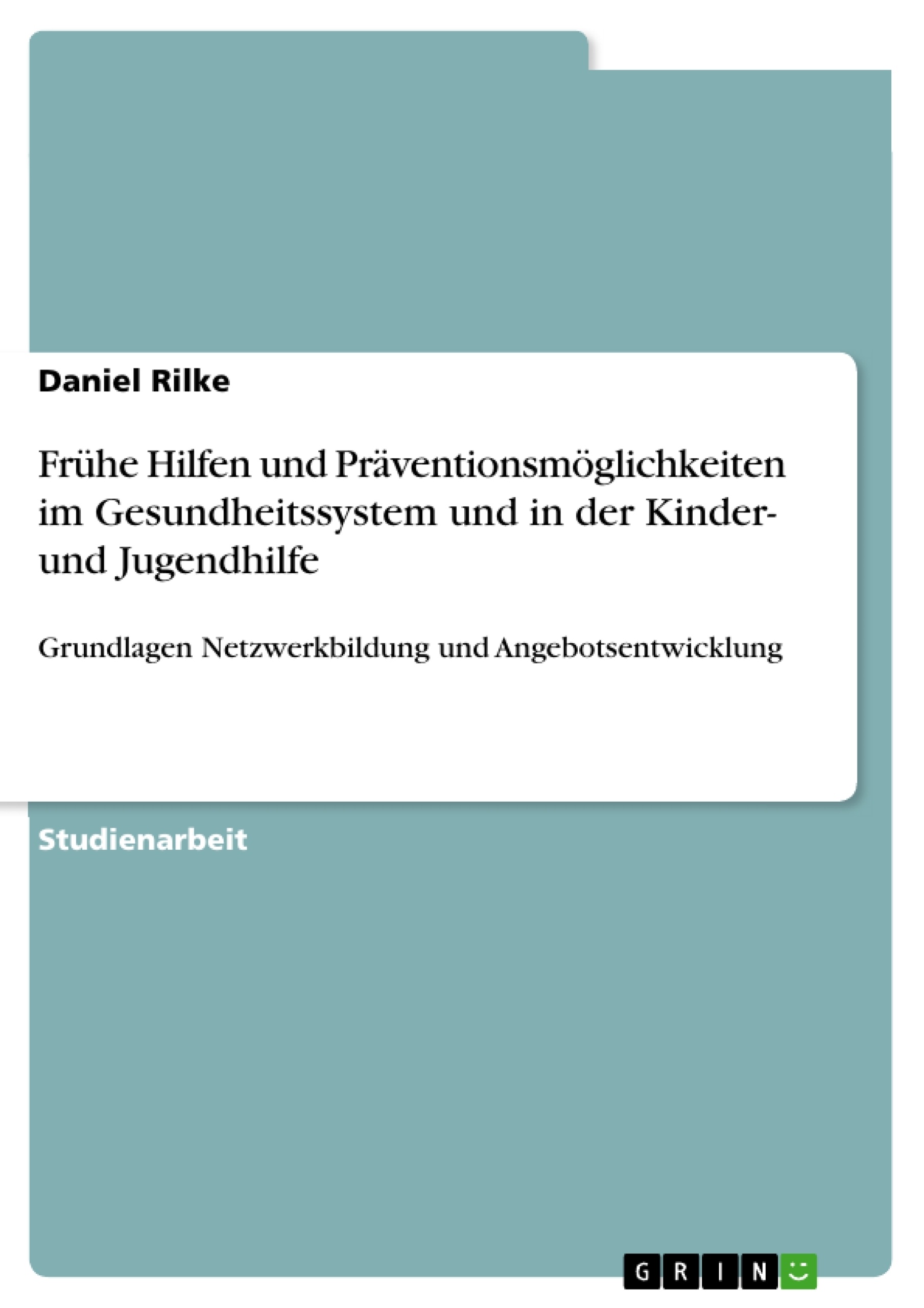In der vorliegenden Studienarbeit soll es einerseits um die Entwicklung der Frühen Hilfen gehen und andererseits auch um Präventionsmöglichkeiten. Geradezu sind die Frühen Hilfen für Kinder unter drei Jahren entwickelt worden, um Familien eine Unterstützung zu bieten, damit sie eine gute Möglichkeit haben, ein gutes familiäres Leben mit dem Kind zu erfahren und auch bei Überforderungen Auswege und Hilfsangebote zu erhalten. Als weiteren wichtigen Aspekt wird auch in dieser Studienarbeit das Thema dialogische und partizipatorische Haltung näher beleuchtet. Dies soll verdeutlichen, dass gerade in den Frühen Hilfen solche Haltungen von großen Interesse im Gesundheitssystem und der Kinder- und Jugendhilfe darstellen.
Auch sollen die gesetzlichen Grundlagen für die Arbeit in den Frühen Hilfen eingebracht werden, um zu sehen, wie sehr das Gesundheitssystem und die Jugendhilfe miteinander verbunden sein sollte. Im Grunde genommen müssen beide Systeme dennoch separat voneinander betrachtet werden, aber dennoch auch als Gesamtheit mit in die Frühen Hilfen einbezogen werden. Exemplarisch werden in dieser Studienarbeit Hilfen der Kinder- und Jugendhilfe zur Verdeutlichung herangezogen. Dies soll auch nochmals klarmachen, dass Frühe Hilfen immer an den wichtigsten Punkten der Lebensphasen der Familien anknüpfen und ein dennoch geschlossen offenes System verkörpern.
Des Weiteren sollen die sozialen Frühwarnsysteme in der Kinder- und Jugendhilfe etwas näher beleuchtet werden, um sich dem Thema Präventionsarbeit annähern zu können, aber dennoch ist klar auf der Hand, dass es immer wieder Situationen gibt, in denen es „eng“ werden kann. Somit soll herausgestellt werden, welchen Herausforderungen sich die Soziale Arbeit im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere in Bezug der Familienarbeit stellen muss.
Im weiteren Verlauf wird die dialogische und partizipatorische Haltung in Bezug auf die Frühen Hilfen und der damit verbundenen Eltern- und Familienarbeit aufgegriffen werden. Es soll ein Zusammenspiel zwischen Eltern und Jugendhilfe deutlich gemacht werden. Wichtig ist, dass zu beachten ist, dass alle Angebote der Frühen Hilfen immer als freiwilliges Angebot aus dem SBG VIII anzusehen sind.
Die Studienarbeit soll schlussendlich durch eine eigene Stellungnahme zu dem Thema und dem Seminar abgerundet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Entstehung von Frühen Hilfen und deren Akteure
- 2. Leistungserbringer aus dem Gesundheitssystem und der Kinder- und Jugendhilfe
- 3. Frühwarnsysteme
- 4. Dialogische und partizipatorische Haltung
- 5. Praxisworkshop - Erkenntnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit befasst sich mit der Entwicklung und den Präventionsmöglichkeiten von Frühen Hilfen. Der Fokus liegt dabei auf Familien mit Kindern unter drei Jahren, die Unterstützung bei der Gestaltung eines guten familiären Lebens benötigen. Zudem wird die dialogische und partizipatorische Haltung im Kontext der Frühen Hilfen und deren Bedeutung für das Gesundheits- und das Jugendhilfesystem untersucht. Die Arbeit soll verdeutlichen, wie beide Systeme miteinander verbunden sein sollten, dabei aber auch als separate Einheiten betrachtet werden müssen.
- Entstehung von Frühen Hilfen und deren Akteure
- Bedeutung von dialogischer und partizipatorischer Haltung in der Familienarbeit
- Frühwarnsysteme und ihre Rolle in der Präventionsarbeit
- Die Vernetzung von Leistungserbringern aus dem Gesundheits- und dem Jugendhilfesystem
- Gesetzliche Grundlagen für die Arbeit in den Frühen Hilfen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Diese Einleitung stellt die Thematik der Studienarbeit vor und erläutert die Zielsetzung, die sich auf die Entwicklung der Frühen Hilfen und die damit verbundenen Präventionsmöglichkeiten konzentriert. Dabei wird die Bedeutung von dialogischer und partizipatorischer Haltung hervorgehoben und die gesetzliche Grundlage für die Arbeit in den Frühen Hilfen skizziert.
1. Entstehung von Frühen Hilfen und deren Akteure
Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Frühen Hilfen, die ihren Ursprung in der Frühförderung der 1970er Jahre haben. Es wird die Definition von Frühen Hilfen durch das Nationale Zentrum Früher Hilfen (NZFH) vorgestellt und die unterschiedlichen Angebote der Frühen Hilfen, wie Beratung, ergänzende Maßnahmen und Unterstützung bei individuellen Problemlagen der Familien, erläutert. Die Wichtigkeit der Vernetzung mit verschiedenen Akteuren und die Freiwilligkeit der Angebote werden hervorgehoben.
2. Leistungserbringer aus dem Gesundheitssystem und der Kinder- und Jugendhilfe
Dieses Kapitel befasst sich mit den unterschiedlichen Leistungserbringern im Bereich der Frühen Hilfen. Es wird die Zusammenarbeit von Akteuren aus dem Gesundheits- und dem Jugendhilfesystem beleuchtet und die Notwendigkeit einer gemeinsamen Arbeit verdeutlicht, um eine umfassende Unterstützung von Familien zu gewährleisten.
3. Frühwarnsysteme
Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle von Frühwarnsystemen in der Präventionsarbeit. Es wird die Bedeutung von frühzeitiger Erkennung von Risiken für Kinder und Familien sowie die Notwendigkeit einer systematischen Arbeit hervorgehoben. Zudem wird die Herausforderung beschrieben, die Familien mit hohen Belastungen und geringen Ressourcen für die Präventionsarbeit darstellen.
4. Dialogische und partizipatorische Haltung
Dieses Kapitel widmet sich der dialogischen und partizipatorischen Haltung im Kontext der Frühen Hilfen. Es wird die Notwendigkeit eines Zusammenspiels zwischen Eltern und Jugendhilfe betont und die Wichtigkeit, alle Angebote als freiwillige Unterstützung im Sinne des SGB VIII zu betrachten.
Schlüsselwörter
Frühe Hilfen, Prävention, Familienförderung, dialogische und partizipatorische Haltung, Frühwarnsysteme, Vernetzung, Kinder- und Jugendhilfe, Gesundheitssystem, SGB VIII, Netzwerkbildung, Angebotentwicklung.
- Quote paper
- Daniel Rilke (Author), 2017, Frühe Hilfen und Präventionsmöglichkeiten im Gesundheitssystem und in der Kinder- und Jugendhilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1452624