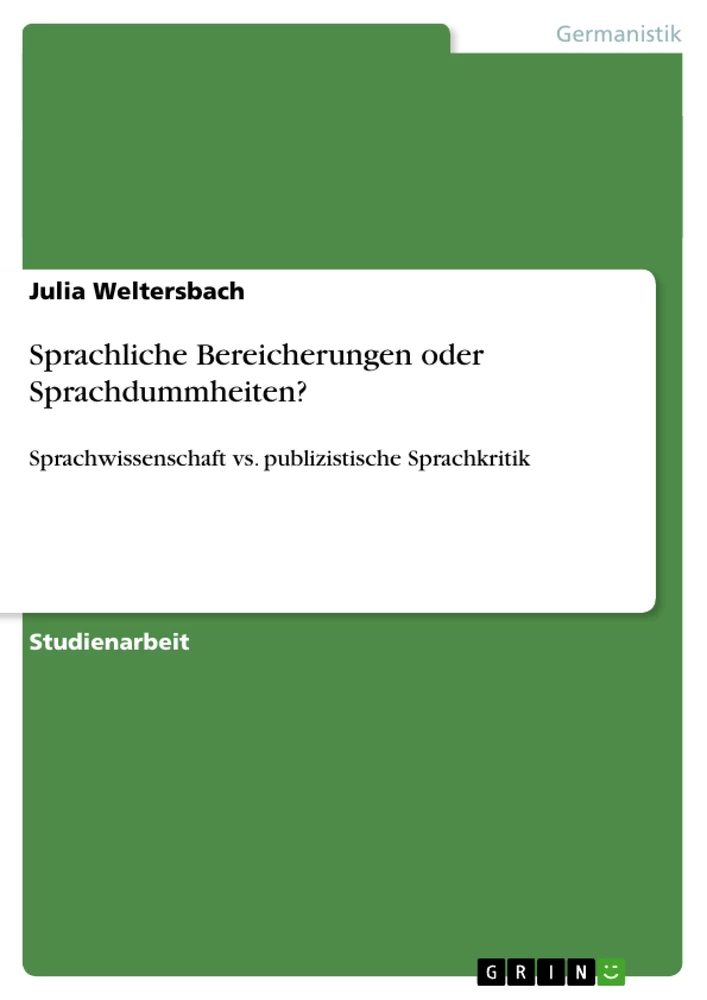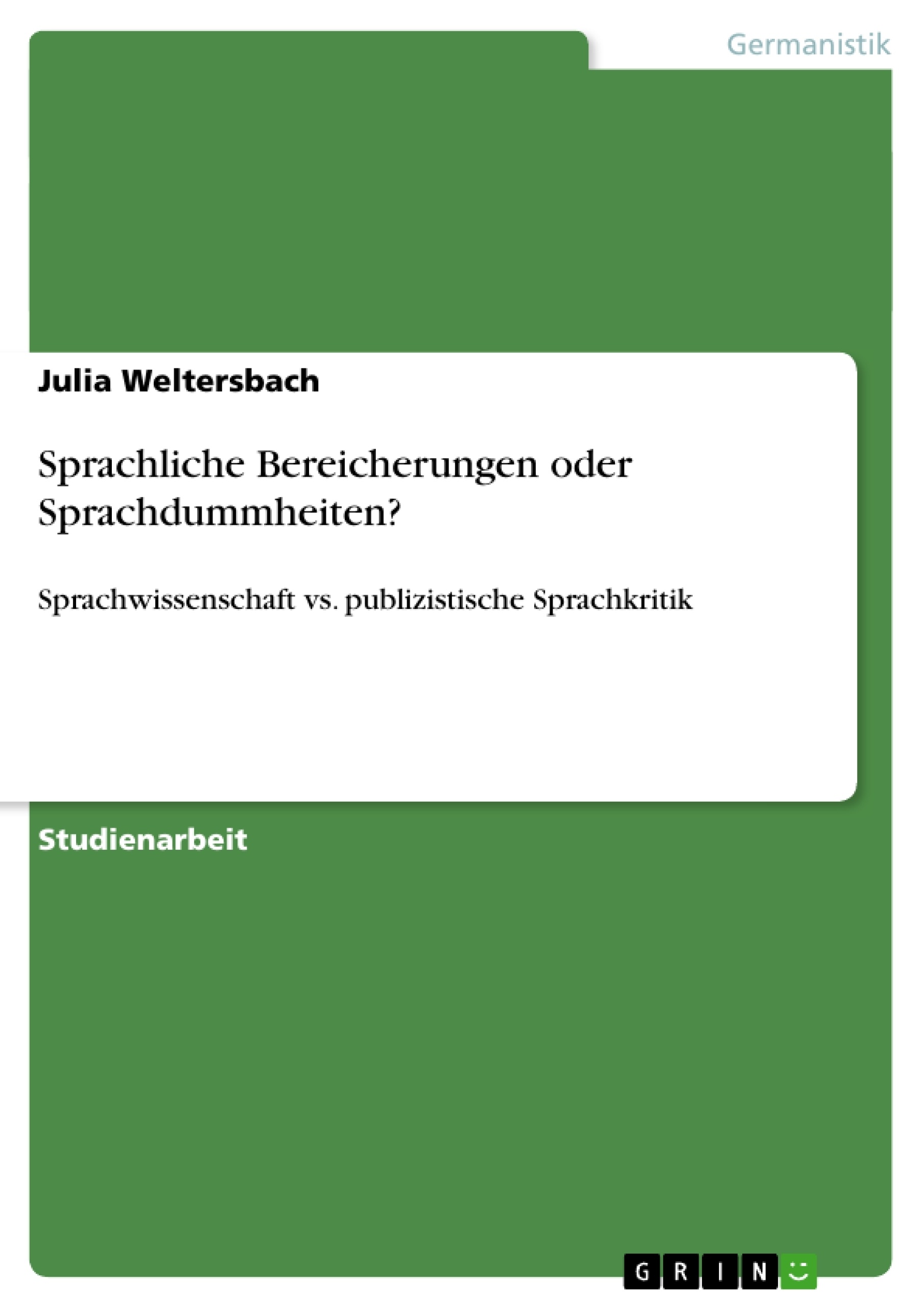In zahlreichen Internet-Foren wird über die grammatische oder semantische Richtigkeit von Formulierungen diskutiert und „sprachpflegerische“ Bücher wie „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“ von Bastian Sick erscheinen auf Bestsellerlisten. Der Titel aus dem Jahr 2004 war so erfolgreich, dass 2006 schon die 3. Folge des „Wegweisers durch den Irrgarten der deutschen Sprache“ erschien. Nicht nur Bastian Sick feiert mit seiner publizistischen Sprachkritik große Erfolge, auch andere Autoren, wie z.B. Eike Christian Hirsch, liefern ihren Lesern Antworten auf die Frage, was „gutes“ Deutsch ist oder welche Ausdrücke man lieber vermeiden sollte.
Doch was ist ein sprachlicher Fehler? Und welche Kriterien liegen einer solchen „Sprachpflege“ zugrunde? Die vorliegende Arbeit soll Antworten auf diese Fragen finden und sich kritisch mit der publizistischen Sprachkritik auseinandersetzen. Dabei soll zuerst auf die lange Geschichte der publizistischen Sprachkritik eingegangen und die verschiedenen Autoren vorgestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Der Streit um die Deutsche Sprache
- 1.2 Geschichte der publizistischen Sprachkritik
- 2. Hauptteil
- 2.1 Vom Zauber der „Sprachretter“ – Bastian Sick und Co
- 2.2 „Unwörter“ und „Denglisch“ – Öffentlich-kollektive Sprachkritik
- 2.3 Sprachwissenschaftliche Antworten
- 3. Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich kritisch mit der publizistischen Sprachkritik und analysiert die Auseinandersetzung zwischen Sprachwissenschaft und der öffentlichen Kritik an der deutschen Sprache. Sie untersucht die Ursachen für die Popularität von „Sprachratgebern“ und hinterfragt die Kriterien, die einer solchen „Sprachpflege“ zugrunde liegen.
- Die Geschichte der publizistischen Sprachkritik und ihre verschiedenen Strömungen
- Die Rolle von „Sprachrettern“ wie Bastian Sick und die Kritik an „Sprachdummheiten“
- Die öffentlich-kollektive Sprachkritik und ihre Ziele
- Die sprachwissenschaftlichen Antworten auf die publizistische Sprachkritik
- Die Frage nach dem Begriff des „sprachlichen Fehlers“ und die Definition von sprachlichen Normen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den Streit um die deutsche Sprache und die Entstehung der publizistischen Sprachkritik. Sie stellt die verschiedenen Akteure und ihre Argumente vor. Der Hauptteil analysiert die verschiedenen Formen der publizistischen Sprachkritik, insbesondere die Werke von Bastian Sick und die öffentlich-kollektive Sprachkritik. Er beleuchtet auch die wissenschaftlichen Antworten auf die publizistische Kritik. Die Schlussbemerkungen fassen die Ergebnisse der Arbeit zusammen und geben einen Ausblick auf die Zukunft der Sprachkritik.
Schlüsselwörter
Publizistische Sprachkritik, Sprachpflege, Sprachdummheiten, Sprachwandel, „Sprachretter“, Bastian Sick, Denglisch, Unwörter, Sprachwissenschaft, linguistische Sichtweise, Sprachnorm, Sprachfehler.
- Quote paper
- Julia Weltersbach (Author), 2009, Sprachliche Bereicherungen oder Sprachdummheiten?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/144946