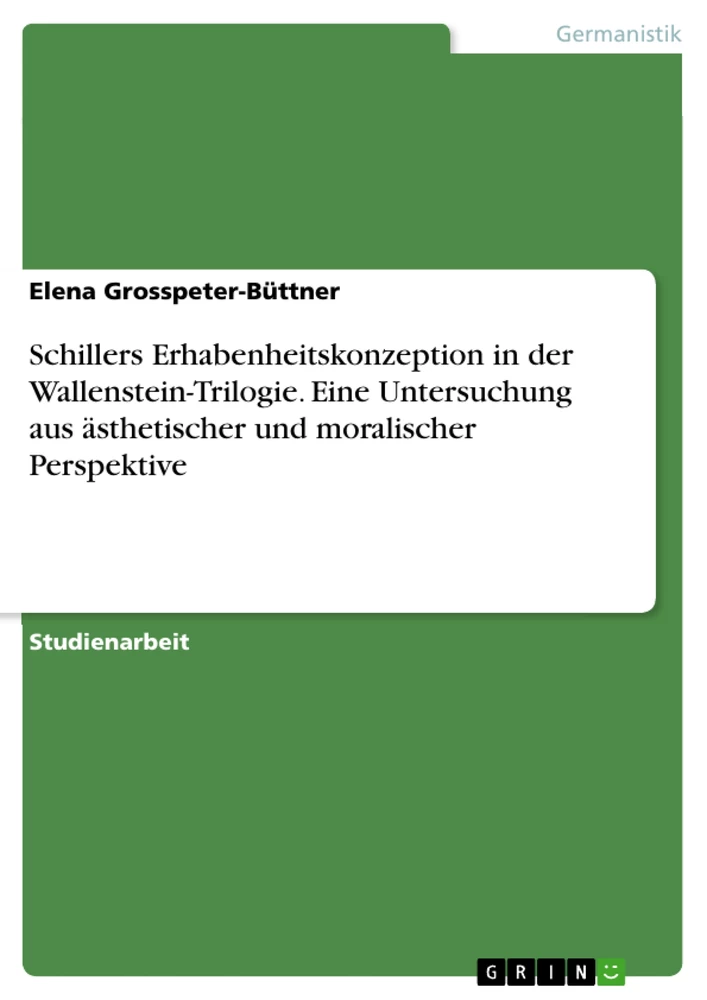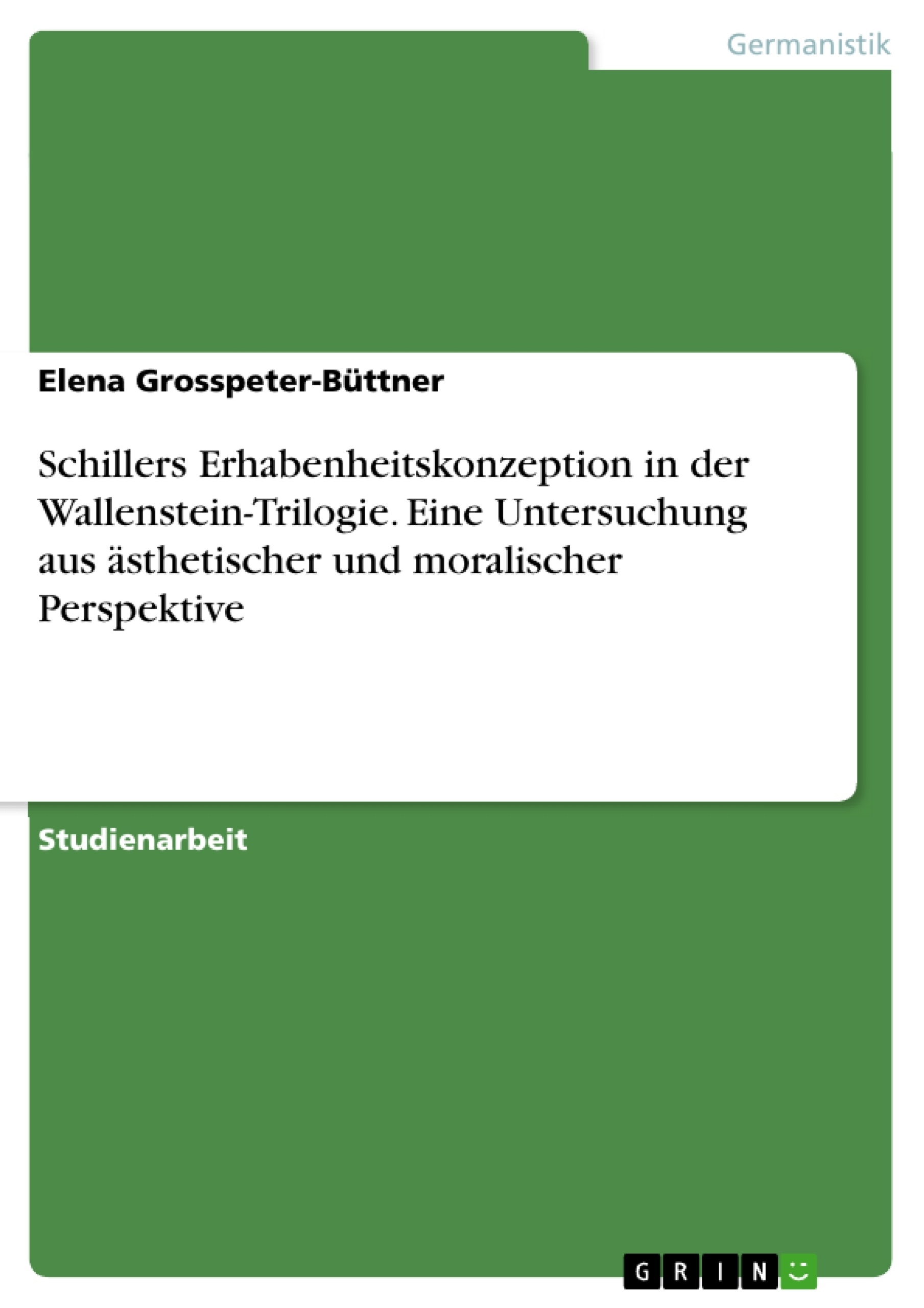Diese Arbeit untersucht die Reflexionen Friedrich Schillers über das Konzept der Erhabenheit in seiner Wallenstein-Trilogie. Dabei wird die komplexe Beziehung zwischen ästhetischer Distanz und moralischer Selbsterweiterung beleuchtet, die Schiller aus Kants philosophischen Ansätzen ableitet. Besonderes Augenmerk liegt auf der Unterscheidung von Beobachter- und Teilnehmerperspektive sowie deren Zusammenhang mit ästhetischer und moralischer Erhabenheit. Durch die Analyse ausgewählter Textstellen wird die Vielschichtigkeit der Wallenstein-Figur im Drama herausgearbeitet und die Vermittlung zwischen ästhetischer Selbstentfaltung und moralischer Selbstbestimmung aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Deutungsansätze des Erhabenheits-Begriffs aus Beobachter- und Teilnehmerperspektive
- 2. Reflexionen des Erhabenheits-Begriffs in Wallensteins Tod
- 3. Schillers Realismus: Moralische Erhabenheit als verfehltes Ideal
- 4. Die Spannung zwischen moralischer und ästhetischer Erhabenheit bei Schiller
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Reflexionen der Erhabenheits-Konzeption in Schillers Dramen-Trilogie „Wallenstein“. Die Untersuchung konzentriert sich auf die spezifische Darstellung des Erhabenheitsbegriffs im Kontext der Figur Wallenstein, die sowohl als ästhetisches Objekt als auch als moralisches Subjekt betrachtet wird.
- Die Verbindung zwischen Schillers Dramenkonzeption und Kants Philosophie
- Die verschiedenen Aspekte der Erhabenheit: ästhetisch, moralisch, politisch
- Die Ambivalenz der Figur Wallenstein und die Frage nach seiner Erhabenheit
- Die Beziehung zwischen Kunst und Wirklichkeit in Schillers Werk
- Die Rolle der Erhabenheit im Prozess der ästhetischen Erziehung des Menschen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beleuchtet die Bedeutung der Erhabenheits-Konzeption für Schillers Werk im Kontext seiner Auseinandersetzung mit Kants Philosophie. Das erste Kapitel beleuchtet unterschiedliche Deutungsansätze des Erhabenheits-Begriffs, indem es zwischen Beobachter- und Teilnehmerperspektive unterscheidet. Das zweite Kapitel analysiert die Reflexionen des Erhabenheits-Begriffs in „Wallensteins Tod“ und untersucht die Beziehung zwischen ästhetischer und moralischer Erhabenheit in der Figur Wallenstein. Das dritte Kapitel untersucht Schillers Realismus und analysiert die moralische Erhabenheit als ein verfehltes Ideal. Das vierte Kapitel analysiert die Spannung zwischen moralischer und ästhetischer Erhabenheit bei Schiller.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Erhabenheit, Schiller, Wallenstein, Dramen-Trilogie, Kant, ästhetische Erziehung, moralisches Subjekt, ästhetisches Objekt, Beobachterperspektive, Teilnehmerperspektive, Realismus, Dramenkonzeption.
- Quote paper
- Elena Grosspeter-Büttner (Author), 2015, Schillers Erhabenheitskonzeption in der Wallenstein-Trilogie. Eine Untersuchung aus ästhetischer und moralischer Perspektive, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1448911