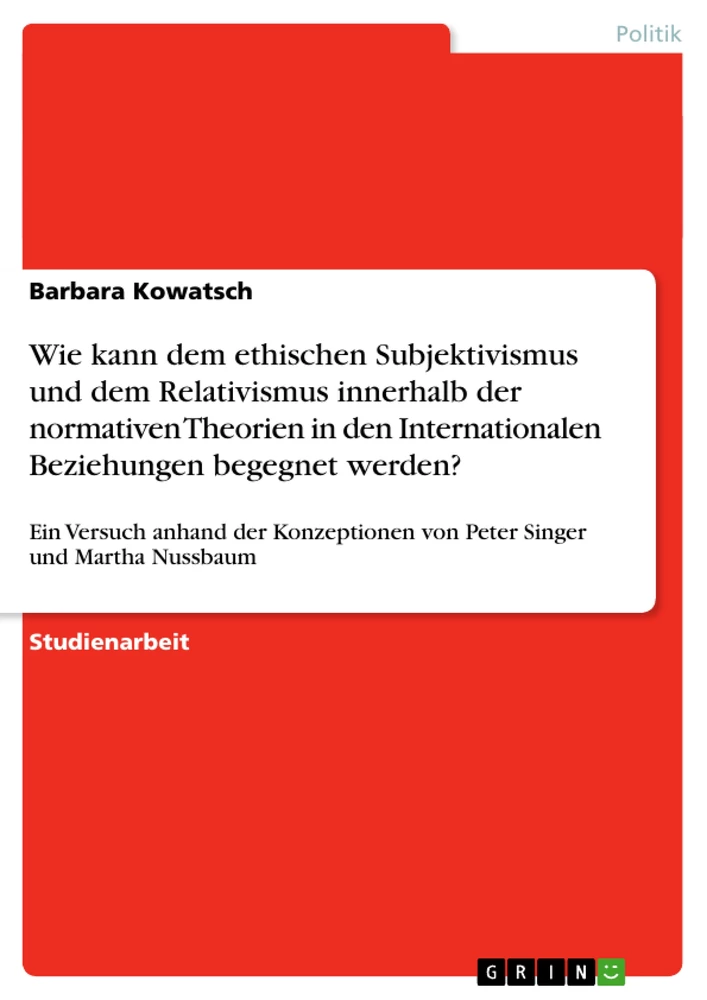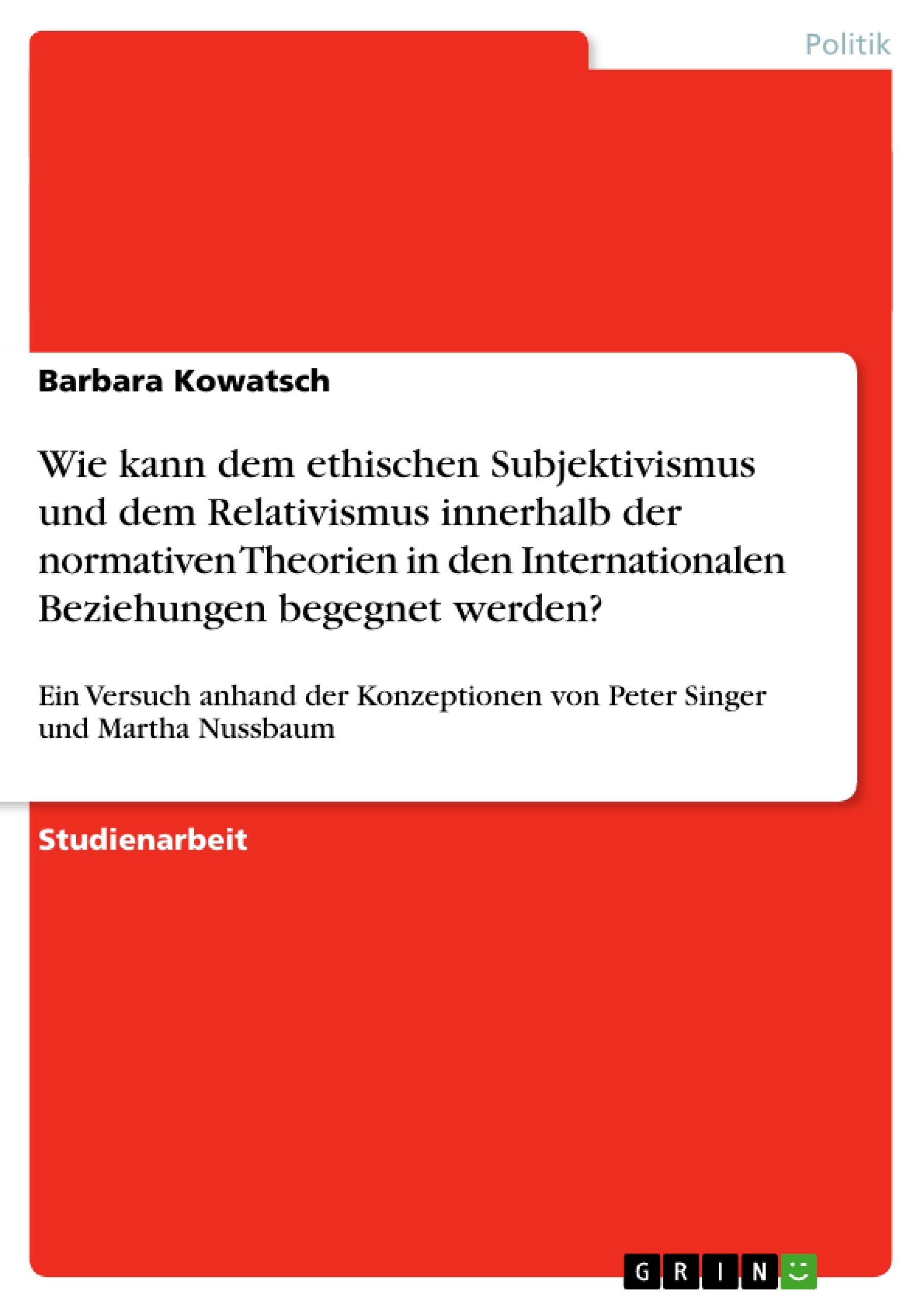Normen bilden die Leitideen für die Rechtsprechung und die Struktur des politischen Zusammenlebens. Die Legitimität und der Geltungsanspruch dieser Pfeiler der politischen Gemeinschaft ist Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit. Die Schwierigkeit einer angemessenen Rechtfertigung von handlungsanleitenden verallgemeinerten Werturteilen ist bedingt durch die Tatsache, dass es in der Welt eine Fülle von divergierenden Beurteilungsmaßstäben für moralische Handlungen gibt. Der Pluralität und Diversität von Normen in den Gemeinschaften der Welt muss Tribut gezollt werden. Es ist ein philosophischer Gemeinplatz, dass es keine absoluten Normen geben kann. Der Rekurs auf objektiv gute und richtige Normen ist bei der Formulierung einer Theorie nicht zulässig. Diese Position bezeichne ich als ethischen Relativismus. Hinzu kommt die Standardauffassung in der Philosophie, dass es keine objektive Verwendung von moralischen Werturteilen gibt, die präskriptiv sind. Der ontologische Status der Wörter „gut“ und „schlecht“ ist fraglich. Um nicht eine de gustibus non est disputandum Mentalität in der Ethik einreißen zu lassen muss man Alternativlösungen zur Begründung normativer Werturteile heranziehen. Zwei Theoriekonzeptionen, die den Anspruch auf universale Normen erheben ohne jedoch fundamentale Annahmen zu machen, sind Gegenstand dieser Arbeit. Deren Legitimierungsversuche werden auf ihre argumentative Koheränz und Relevanz hin untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ethischer Relativismus und ethischer Subjektivismus
- Die Singer'sche Konzeption
- Singers Utilitaristische Argumentation
- Inhaltliche Diskussion der Singer'schen Spendenpflicht
- Martha Nussbaums Essentialistische Konzeption
- Die Neoaristotelische Methode des Essentialismus
- Inhaltliche Diskussion der Theorie:
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herausforderung, die der ethische Subjektivismus und der ethische Relativismus für normative Theorien in den Internationalen Beziehungen darstellen. Sie analysiert, wie die Konzeptionen von Peter Singer und Martha Nussbaum mit diesen Problemen umgehen und ob sie eine Alternative zu einem rein relativistischen Verständnis von Moral bieten können.
- Die Problematik des ethischen Relativismus und Subjektivismus in der internationalen Politik
- Die utilitaristische Argumentation von Peter Singer und ihre Relevanz für normative Theorien
- Die essentialistische Konzeption von Martha Nussbaum und ihre neoaristotelische Methode
- Die Fähigkeit beider Theorien, universelle Normen zu begründen, ohne dabei auf objektive Werte zurückzugreifen
- Die Anwendung der Theorien auf konkrete politische Belange
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die Grundfrage nach der Legitimität und Geltung von Normen im Kontext der internationalen Beziehungen. Dabei werden die zentralen Begriffe des ethischen Relativismus und Subjektivismus eingeführt und ihre Bedeutung für die Rechtfertigung von Werturteilen erläutert.
Kapitel 2 beleuchtet die verschiedenen Positionen des ethischen Relativismus und Subjektivismus und zeigt auf, warum diese Theorien für die internationale Politik relevant sind. Dabei wird die Bedeutung der individuellen Konkretisierung von Moral und ihre Verwurzelung in der jeweiligen Lebenswelt betont.
Kapitel 3 analysiert die Theorie von Peter Singer, die sich auf eine utilitaristische Argumentation stützt und die Verpflichtung am Individuum anlegt. Es werden Singers zentrale Argumente dargestellt und die Implikationen seiner Theorie für die Frage der Spendenpflicht diskutiert.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit der essentialistischen Konzeption von Martha Nussbaum. Die neoaristotelische Methode des Essentialismus wird erläutert und die Theorie auf ihre Relevanz für die politische Planung und die Festlegung von grundlegenden Menschenrechten untersucht.
Schlüsselwörter
Ethischer Relativismus, Ethischer Subjektivismus, Internationale Beziehungen, Normative Theorien, Peter Singer, Martha Nussbaum, Utilitarismus, Essentialismus, Neoaristotelische Methode, Spendenpflicht, Menschenrechte, Politische Planung.
- Quote paper
- Barbara Kowatsch (Author), 2006, Wie kann dem ethischen Subjektivismus und dem Relativismus innerhalb der normativen Theorien in den Internationalen Beziehungen begegnet werden? , Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/143872