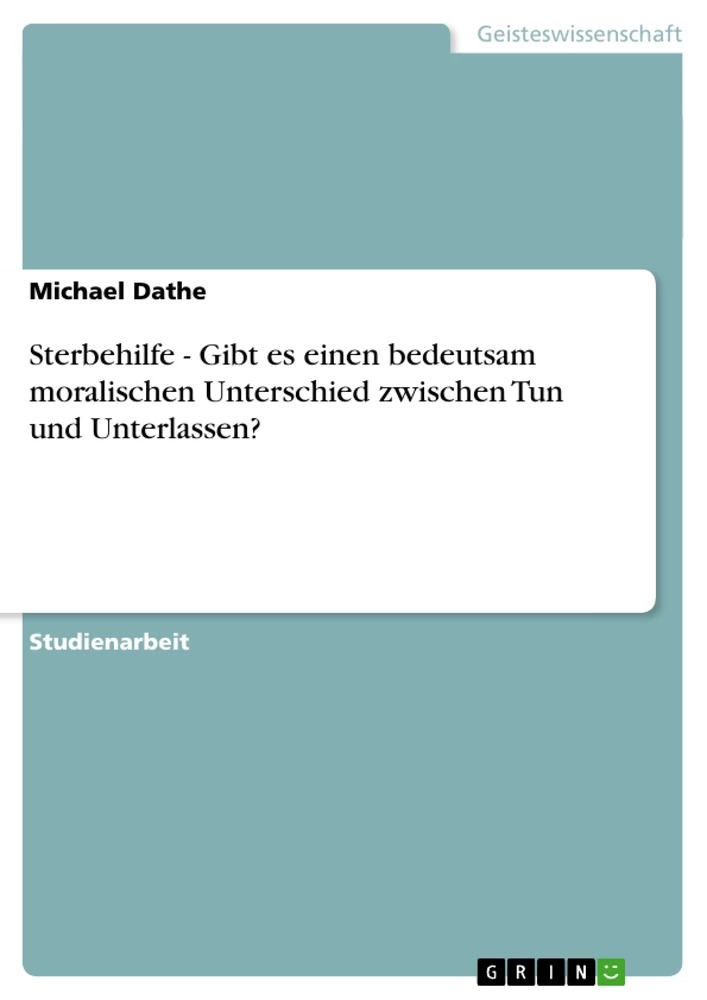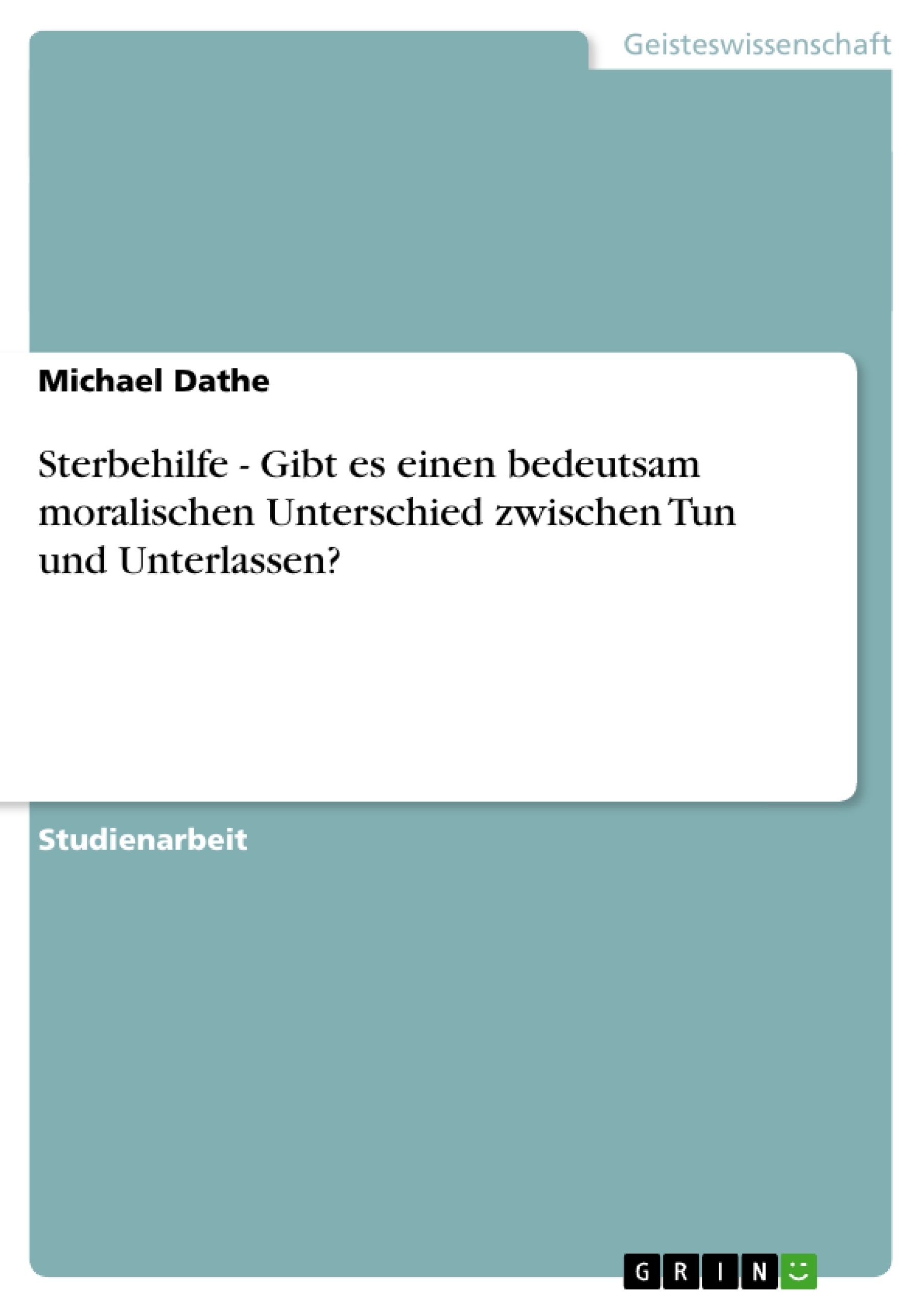Die Sterbehilfe-Diskussion hat in den letzten Jahren in Deutschland zugenommen. Hierfür gibt es verschieden Gründe. Zum einen hat die Intensivmedizin sich technisch immer weiter verbessert, so dass es heutzutage vermehrt möglich ist, einen Menschen am Leben zu halten, und zum anderen entwickelt sich in Deutschland eine überalternde Bevölkerung. „Die Zahl alter und chronisch kranker Menschen hat zugenommen.“ Diese Entwicklungen sind mitverantwortlich für eine entstandene Wertepluralität innerhalb der Bevölkerung. Es stellt sich die Frage, ob für bestimmte Patienten, die am Leben gehalten werden, die Situation überhaupt noch ein lebenswertes Leben darstellt. Das, was von einem als Wohl empfunden wird, kann von einem Anderen als Schaden gesehen werden und der Auftrag des Arztes, dass Wohl von Patienten zu fördern, ist interpretationsbedürftig geworden. Die Verfechter der Sterbehilfe sind der Meinung, dass es am sinnvollsten erscheint, so weit wie möglich die Entscheidungsgewalt des Patientenwohls dem Patienten selbst zu überlassen. Hat dieser den Wunsch, sein Leben besonders in auswegslosen Situationen zu beenden, sind dem behandelnden Arzt für eine aktive Beendigung des Lebens gesetzlich die Hände gebunden. In einigen Fällen scheint es aber für alle Beteiligten die beste Alternative zu sein. Gegen diese Gedanken stellt sich besonders die Kirche, die von der Heiligkeit des menschlichen Lebens spricht und eine Tötung massiv ablehnt. Es ist zwar gesetzlich möglich, eine passive Beendigung des Lebens anzustreben, doch kann dieser Sterbensprozess für den Patienten mit einer unnötigen Qual verbunden sein. Verfechter der aktiven Sterbehilfe versuchen die Sinnlosigkeit dieser zu erläutern und sind der Meinung, dass es keinen moralischen Unterschied zwischen Tun und Unterlassen gibt.
Inhaltsverzeichnis
- Gibt es einen bedeutsam moralischen Unterschied zwischen Tun und Unterlassen?
- Begriffsbestimmungen
- Die Rechtslage in Deutschland
- Die niederländische Praxis
- Tun und Unterlassen
- Fazit
- Literaturangabe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die moralische Differenz zwischen aktivem Handeln und Unterlassen im Kontext der Sterbehilfe. Sie beleuchtet die unterschiedlichen rechtlichen und ethischen Positionen zu diesem Thema und analysiert verschiedene Fallbeispiele. Die Arbeit zielt darauf ab, die Komplexität der Debatte aufzuzeigen und die Frage nach einem bedeutsamen moralischen Unterschied zu diskutieren.
- Der moralische Unterschied zwischen Tun und Unterlassen
- Aktive, passive und indirekte Sterbehilfe
- Rechtliche Aspekte der Sterbehilfe in Deutschland und den Niederlanden
- Ethische Dilemmata im Umgang mit Sterbehilfe
- Fallbeispiele und deren ethische Bewertung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Gibt es einen bedeutsam moralischen Unterschied zwischen Tun und Unterlassen?: Die Einleitung beleuchtet die zunehmende Sterbehilfe-Debatte in Deutschland, verursacht durch Fortschritte in der Intensivmedizin und den demografischen Wandel. Sie stellt die gegensätzlichen Positionen der Verfechter der Sterbehilfe, die die Selbstbestimmung des Patienten betonen, und der Kirche, die die Heiligkeit des Lebens hervorhebt, gegenüber. Der „Johns-Hopkins-Fall“ wird als Beispiel für die moralische Grauzone zwischen Tun und Unterlassen eingeführt, wobei die Frage nach der ethischen Vertretbarkeit der Nichtbehandlung eines neugeborenen Kindes im Vordergrund steht. Die Einleitung führt somit das zentrale Problem der Arbeit ein: die moralische Bewertung von Handlung und Unterlassung im Kontext von Lebensverlängerung und Sterben.
2. Begriffsbestimmung: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Sterbehilfe (Euthanasie) und unterscheidet zwischen aktiver, passiver und indirekter Sterbehilfe sowie freiwilliger, nicht-freiwilliger und unfreiwilliger Sterbehilfe. Es werden die Kriterien für Euthanasie definiert und die jeweiligen Unterschiede zwischen assistiertem Suizid und aktiver Sterbehilfe erläutert. Das Kapitel diskutiert die rechtlichen Implikationen der verschiedenen Formen der Sterbehilfe und hinterfragt die Praktikabilität und moralische Relevanz dieser Begrifflichkeiten im medizinischen Alltag.
Schlüsselwörter
Sterbehilfe, Euthanasie, Tun und Unterlassen, aktive Sterbehilfe, passive Sterbehilfe, assistierter Suizid, moralische Bewertung, Rechtslage Deutschland, Selbstbestimmung, Patientenverfügung, ethische Dilemmata.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Moralische Differenz zwischen Tun und Unterlassen in der Sterbehilfe
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die moralische Differenz zwischen aktivem Handeln (Tun) und Unterlassen in Bezug auf Sterbehilfe. Sie analysiert die rechtlichen und ethischen Positionen zu diesem Thema und beleuchtet die Komplexität der Debatte anhand verschiedener Fallbeispiele, insbesondere die Frage nach einem bedeutsamen moralischen Unterschied zwischen Tun und Unterlassen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition von Sterbehilfe (inkl. aktiver, passiver und indirekter Sterbehilfe), die rechtlichen Aspekte in Deutschland und den Niederlanden, ethische Dilemmata, Fallbeispiele und deren ethische Bewertung, sowie den moralischen Unterschied zwischen Tun und Unterlassen. Der „Johns-Hopkins-Fall“ dient als ein einführendes Beispiel für die moralische Grauzone.
Welche Begrifflichkeiten werden definiert?
Das Dokument definiert den Begriff der Sterbehilfe (Euthanasie) und differenziert zwischen aktiver, passiver und indirekter Sterbehilfe sowie freiwilliger, nicht-freiwilliger und unfreiwilliger Sterbehilfe. Assistierter Suizid wird von aktiver Sterbehilfe abgegrenzt. Die rechtlichen Implikationen der verschiedenen Formen werden ebenfalls diskutiert.
Wie wird die Rechtslage behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Rechtslage in Deutschland und vergleicht sie mit der niederländischen Praxis. Sie betrachtet die rechtlichen Implikationen der verschiedenen Formen der Sterbehilfe.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter umfassen Sterbehilfe, Euthanasie, Tun und Unterlassen, aktive Sterbehilfe, passive Sterbehilfe, assistierter Suizid, moralische Bewertung, Rechtslage Deutschland, Selbstbestimmung, Patientenverfügung und ethische Dilemmata.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es darin?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, die sich mit der zentralen Frage nach dem moralischen Unterschied zwischen Tun und Unterlassen auseinandersetzen, Begrifflichkeiten definieren, die Rechtslage in Deutschland und den Niederlanden beleuchten und ein Fazit ziehen. Die Kapitelzusammenfassungen geben detailliertere Einblicke in die einzelnen Themen.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Komplexität der Debatte um Sterbehilfe aufzuzeigen und die Frage nach einem bedeutsamen moralischen Unterschied zwischen Tun und Unterlassen zu diskutieren. Sie untersucht die unterschiedlichen rechtlichen und ethischen Positionen und analysiert verschiedene Fallbeispiele.
- Quote paper
- Michael Dathe (Author), 2010, Sterbehilfe - Gibt es einen bedeutsam moralischen Unterschied zwischen Tun und Unterlassen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/143480