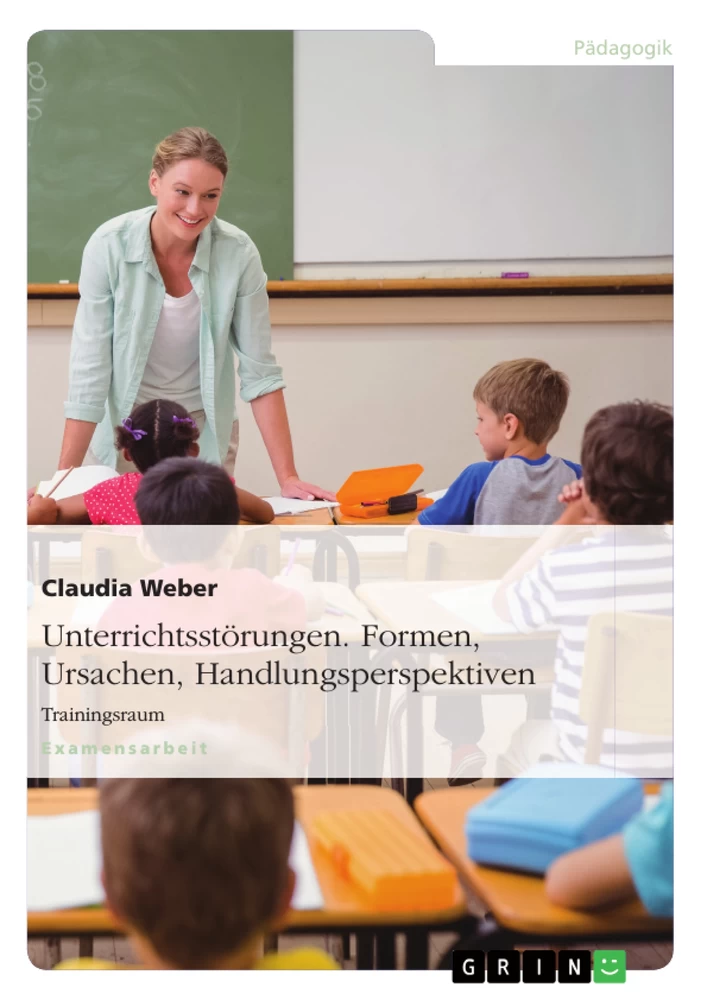Viele Referendare und Referendarinnen beginnen ihren Beruf voller Enthusiasmus. Sie freuen sich mit Kindern arbeiten zu dürfen und ihnen Wissen vermitteln zu können, doch häufig werden sie auf den Boden der Realität zurückgeholt. Die meisten hoffen ein freundschaftliches Verhältnis mit der Klasse aufbauen können und möchten die Schüler
und Schülerinnen vom Unterrichtsstoff begeistern. Wie man aber von vielen Erzählungen und Berichten hört, gelingt dies in den seltensten Fällen nur mit Liebe, Verständnis und Freiheit. Die Kinder brauchen Regeln und Vorbilder, an denen sie sich orientieren. Viele Referendare und Referendarinnen, wie auch Lehrer und Lehrerinnen haben Bedenken, dass
sie bei ihrer Klasse nicht gut ankommen, wenn sie streng sind. Natürlich ist eine autoritäre
Erziehung keine Lösung, da die Schüler und Schülerinnen sich nur anständig benehmen,
weil sie Angst vor Konsequenzen haben aber nicht weil sie einsichtig sind. Die Klasse braucht jedoch eine Lehrkraft die sich durchsetzen kann und konsequent ist und konsequent eine Beeinträchtigung des Unterrichts nicht toleriert. Häufig stecken Lehrkräfte viel Arbeits- und Kraftaufwand in die Vorbereitung der Unterrichtsstunden hinein und
trotz dieser Mühen sind die Resultate meist enttäuschend und demotivierend. Es gibt einige
Handlungen, die den Unterricht unterbrechen können, wie Unkonzentriertheit, Ungenauigkeit, Faulheit, motorische Unruhe, mangelndes Interesse, verbale und physische Aggressionen, mangelndes Selbstvertrauen, Ungehorsamkeit, Kontaktprobleme, unterrichtsfremde Tätigkeiten, Überempfindlichkeit, Clownerien, Wutanfälle, übertriebener Ehrgeiz, Schulangst, psychosomatische Störungen, Beschädigung von
Eigentum anderer Personen oder Gegenständen, starke Abhängigkeit, Depressivität, Druck auf Mitschüler und Mitschülerinnen, unregelmäßiger Schulbesuch, Provokation des Lehrers bzw. der Lehrerin, Stehlen, Alkoholmissbrauch, sexuelle Auffälligkeiten,
Drohungen mit Selbstmord, Drogenmissbrauch, Selbstmordversuche. (vgl. Bach 2002, S.58) Unzufriedenheit, Enttäuschung, Frust und Resignation bei Lehrern und Lehrerinnen können die Folge sein.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Thematische Relevanz und Zielsetzungen
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2 Theoretischer Teil
- 2.1 Theoretische Fundierung von Unterrichtsstörungen
- 2.1.1 Unterschiedliches Verständnis von Unterrichtsstörungen
- 2.1.2 Der Begriff „Unterrichtsstörung“
- 2.1.3 Die Schulgeschichte und der heutige Diskussionsstand
- 2.2 Formen von Unterrichtsstörungen
- 2.2.1 Durch Schüler verursachte Arten
- 2.2.1.1 Aktive Unterrichtsstörungen
- 2.2.1.2 Passive Unterrichtsstörungen
- 2.2.1.3 Interaktionen zwischen Schülern
- 2.2.2 Durch Lehrer verursachte Arten
- 2.2.2.1 Persönlichkeit
- 2.2.2.2 Unterrichtsgestaltung
- 2.2.3 Durch das Umfeld verursachte Arten
- 2.2.3.1 Schulart
- 2.2.3.2 Gemeindegröße der Schulorte und Wohngebiete der Schüler
- 2.2.3.3 Schulische Bedingungen
- 2.3 Gründe von Unterrichtsstörungen
- 2.3.1 Schülerbezogene Ursachen
- 2.3.1.1 Der einzelne Schüler
- 2.3.1.2 Die Zusammensetzung der Klasse
- 2.3.1.3 Ermittlung von Ursachen durch Lehrer- und Schülerbefragungen
- 2.3.2 Lehrerbezogene Ursachen
- 2.3.2.1 Persönlichkeit
- 2.3.2.2 Unterrichtsgestaltung
- 2.3.2.3 Ermittlung von Ursachen durch Lehrer- und Schülerbefragungen
- 2.3.3 Äußere Bedingungen
- 2.3.3.1 Familie
- 2.3.3.2 Schule
- 2.3.3.3 Sozioökonomische Verhältnisse
- 2.3.3.4 Gesellschaftsstruktur
- 2.3.3.5 Lehrervariablen
- 2.4 Handlungsspektrum
- 2.4.1 Eine Umfrage unter Lehrkräften
- 2.4.2 Prävention bei Konflikten
- 2.4.2.1 Jacob Kounins Befunde
- 2.4.2.2 Regeln und Organisation
- 2.4.2.3 Breite Aktivierung
- 2.4.2.4 Unterrichtsfluss
- 2.4.2.5 Präsenz- und Stoppsignale
- 2.4.3 Intervention bei Konflikten
- 2.4.3.1 Lehrerzentrierte Strategien
- 2.4.3.2 Kooperative Strategien
- 2.5 Eigenes Verständnis zu Unterrichtsstörungen
- 3 Praktischer Teil
- 3.1 Trainingsraummethode
- 3.1.1 Ursprung
- 3.1.2 Ziel
- 3.1.3 Einführung
- 3.1.4 Verwirklichung des Programms
- 3.1.5 Umsetzung im Trainingsraum
- 3.2 Evaluationsergebnisse
- 3.2.1 Wirksamkeit in der Praxis
- 3.2.2 Befunde von Umfragen
- 3.3 Umsetzung in der Schule
- 3.3.1 Ziele der Dr.Albert-Liebmann-Schule und der Tagesstätte
- 3.3.2 Methoden der Bekämpfung von Unterrichtsstörungen
- 3.3.3 Die Realisierung des Trainingsraumprogramms
- 3.4 Fazit
- 3.4.1 Kritische Aspekte
- 3.4.2 Positive Effekte
- 3.5 Reflexion der Trainingsraummethode
- 4 Ausblick
- 4.1 Verbesserung des Lehramtstudiums
- 4.2 Weiterentwicklung von Schulen
- Definition und Kategorisierung von Unterrichtsstörungen
- Ursachen von Unterrichtsstörungen (Schüler, Lehrer, Umfeld)
- Präventive und interventive Strategien im Umgang mit Unterrichtsstörungen
- Evaluation von Interventionsmaßnahmen
- Verbesserungsmöglichkeiten im Schulalltag und im Lehramtsstudium
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Unterrichtsstörungen an Hauptschulen. Ziel ist es, verschiedene Formen, Ursachen und Handlungsperspektiven zu beleuchten und ein umfassendes Verständnis für dieses Phänomen zu entwickeln. Die Arbeit verbindet theoretische Grundlagen mit praktischen Erfahrungen.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema Unterrichtsstörungen ein und erläutert die Relevanz der Thematik. Es werden die Ziele der Arbeit definiert und der Aufbau der Hausarbeit skizziert. Die Einleitung stellt den Kontext dar und benennt die Forschungsfrage, die im Verlauf der Arbeit beantwortet werden soll. Die thematische Relevanz wird durch die Herausforderungen im Schulalltag begründet, die durch Unterrichtsstörungen entstehen.
2 Theoretischer Teil: Dieser umfangreiche Teil befasst sich mit der theoretischen Fundierung des Themas. Zunächst werden unterschiedliche Verständnisse von Unterrichtsstörungen diskutiert und der Begriff selbst definiert. Die historische Entwicklung und der aktuelle Diskussionsstand werden beleuchtet. Anschließend werden verschiedene Formen von Unterrichtsstörungen nach den verursachenden Faktoren (Schüler, Lehrer, Umfeld) kategorisiert und detailliert beschrieben. Im weiteren Verlauf werden schülerbezogene, lehrerbezogene und äußere Ursachen von Unterrichtsstörungen analysiert. Schließlich wird ein breites Handlungsspektrum, bestehend aus präventiven und interventiven Strategien, vorgestellt und diskutiert. Der Abschnitt schließt mit einer Darstellung des eigenen Verständnisses der Autorin zu Unterrichtsstörungen.
3 Praktischer Teil: Der praktische Teil der Arbeit beschreibt die Anwendung der Trainingsraummethode zur Bewältigung von Unterrichtsstörungen. Es werden der Ursprung, die Ziele und die Einführung dieser Methode erläutert, sowie ihre Umsetzung im Trainingsraum detailliert dargestellt. Die Evaluationsergebnisse der Methode, inklusive der Wirksamkeit in der Praxis und Befunde von Umfragen, werden vorgestellt und analysiert. Abschließend wird die Umsetzung des Programms an der Dr. Albert-Liebmann-Schule und der Tagesstätte beschrieben und ein Fazit gezogen, welches kritische Aspekte und positive Effekte der Trainingsraummethode gegenüberstellt.
Schlüsselwörter
Unterrichtsstörungen, Hauptschule, Prävention, Intervention, Trainingsraummethode, Schülerverhalten, Lehrerverhalten, Schulische Bedingungen, Konfliktmanagement, Unterrichtsgestaltung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Unterrichtsstörungen an Hauptschulen
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit befasst sich umfassend mit dem Thema Unterrichtsstörungen an Hauptschulen. Sie untersucht verschiedene Formen, Ursachen und Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit diesen Störungen.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Kategorisierung von Unterrichtsstörungen, die Ursachen (schülerbezogen, lehrerbezogen und umweltbezogen), präventive und interventive Strategien, die Evaluation von Interventionsmaßnahmen und Verbesserungsmöglichkeiten im Schulalltag und Lehramtsstudium. Ein besonderer Fokus liegt auf der Trainingsraummethode.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen theoretischen Teil, einen praktischen Teil und einen Ausblick. Der theoretische Teil beleuchtet die theoretischen Grundlagen von Unterrichtsstörungen, verschiedene Formen und Ursachen. Der praktische Teil beschreibt die Anwendung der Trainingsraummethode, ihre Evaluation und Umsetzung an einer Schule. Die Einleitung definiert die Zielsetzung und den Aufbau, während der Ausblick Verbesserungsvorschläge für das Lehramtsstudium und Schulen formuliert.
Welche Methoden werden im praktischen Teil vorgestellt?
Der praktische Teil konzentriert sich auf die Trainingsraummethode. Es werden der Ursprung, die Ziele, die Einführung, die Umsetzung im Trainingsraum und die Evaluation dieser Methode detailliert beschrieben. Die Ergebnisse von Umfragen zur Wirksamkeit werden ebenfalls präsentiert.
Welche Ursachen für Unterrichtsstörungen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht schülerbezogene Ursachen (individueller Schüler, Klassenzusammensetzung), lehrerbezogene Ursachen (Persönlichkeit, Unterrichtsgestaltung) und äußere Bedingungen (Familie, Schule, sozioökonomische Verhältnisse, Gesellschaftsstruktur, Lehrervariablen).
Welche Strategien zur Bewältigung von Unterrichtsstörungen werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert sowohl präventive Strategien (z.B. nach Jacob Kounin: Regeln, Organisation, breite Aktivierung, Unterrichtsfluss, Signale) als auch interventive Strategien (lehrerzentrierte und kooperative Strategien).
Wo wurde die Trainingsraummethode angewendet?
Die Trainingsraummethode wurde an der Dr. Albert-Liebmann-Schule und der Tagesstätte umgesetzt und evaluiert.
Welche Ergebnisse liefert die Evaluation der Trainingsraummethode?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der Evaluation der Trainingsraummethode, einschließlich ihrer Wirksamkeit in der Praxis und der Befunde aus Umfragen. Sowohl kritische Aspekte als auch positive Effekte werden im Fazit gegenüberstellt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Unterrichtsstörungen, Hauptschule, Prävention, Intervention, Trainingsraummethode, Schülerverhalten, Lehrerverhalten, Schulische Bedingungen, Konfliktmanagement, Unterrichtsgestaltung.
Welche Verbesserungsvorschläge werden im Ausblick gegeben?
Der Ausblick gibt Verbesserungsvorschläge für das Lehramtsstudium und die Weiterentwicklung von Schulen im Umgang mit Unterrichtsstörungen.
- Quote paper
- Claudia Weber (Author), 2009, Unterrichtsstörungen. Formen, Ursachen, Handlungsperspektiven, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/142800