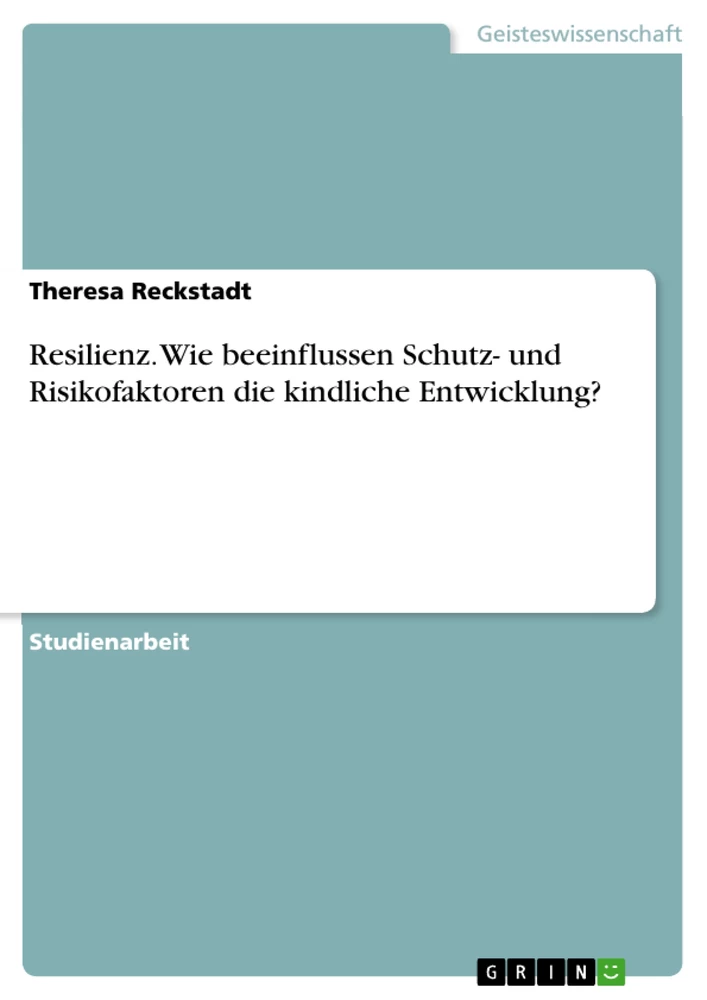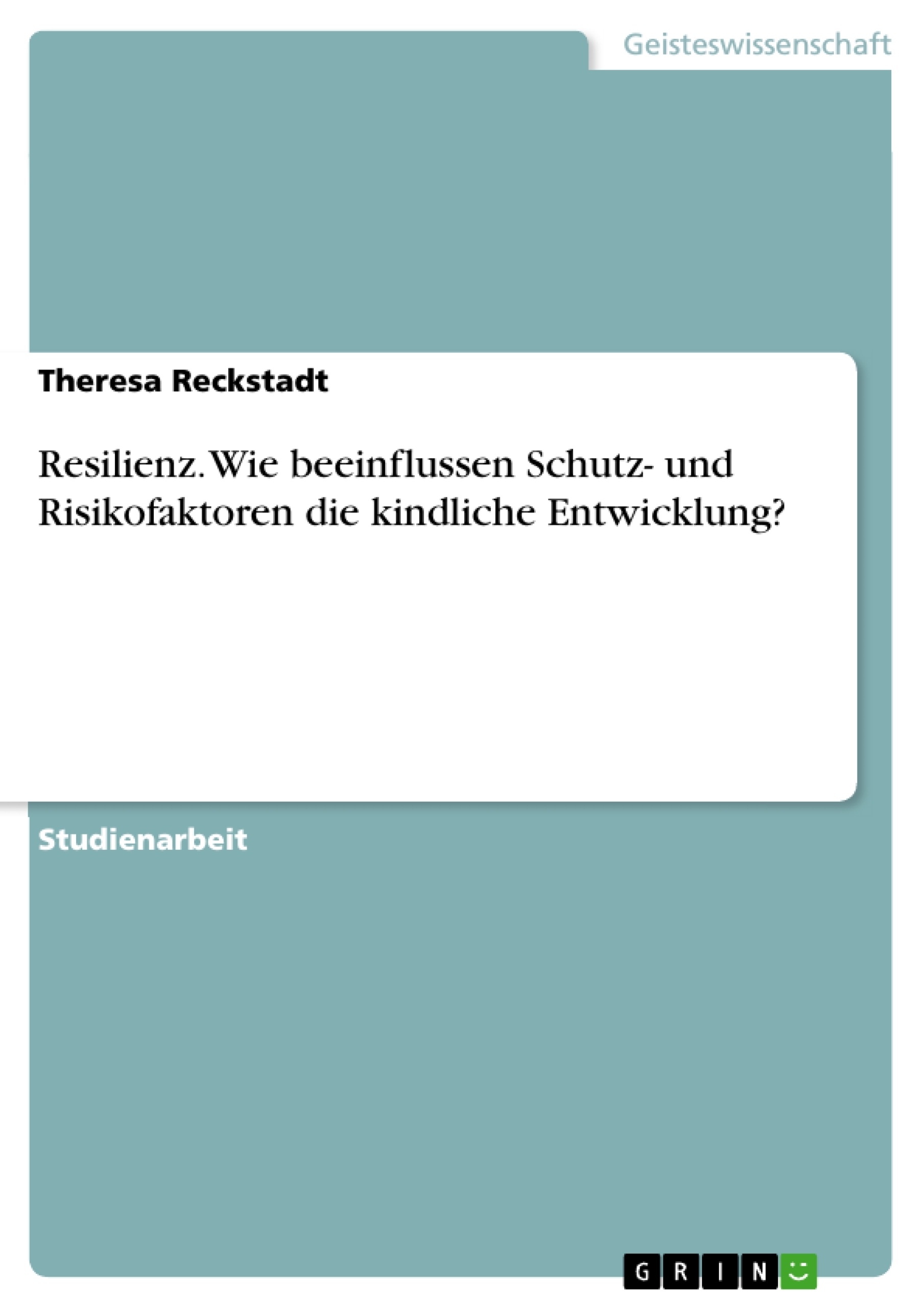Noch immer wird häufig davon ausgegangen, dass negative äußerliche Einflüsse zwangsläufig negative Entwicklungsfolgen bei betroffenen Kindern verursachen, besonders wenn diesem Prozess nicht gezielt durch professionelle Hilfe entgegengewirkt wird. Die sehr aktuelle Theorie der Resilienz, welche zunehmend Beachtung findet, widerspricht diesem Denkansatz.
Die Resilienzforschung belegt, dass widrige Lebensumstände nicht automatisch die kindliche Entwicklung beeinträchtigen, stattdessen lassen diese bei einigen Kindern erstaunliche Fähigkeiten zum Vorschein kommen oder gar entstehen, um solche negativen Einflüsse „abzuwehren“ (Wustmann, 2004: 18). Demnach gibt es zwar Risikofaktoren, welche Entwicklungsstörungen begünstigen; auf der anderen Seite bewahren so genannte Schutzfaktoren viele Kinder vor einer gravierenden Beeinträchtigung bzw. befähigen sie, trotz einer durch Risikofaktoren bedingten Benachteiligung ein erfolgreiches, ausgeglichenes Leben zu führen. Resilienz kann als Produkt dieser schützenden Einflüsse betrachtet werden. Es kommt vom Englischen „resilience“ und bezieht sich auf die psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken. So wird erklärt, weshalb verhältnismäßig viele Kinder trotz eines erhöhten Entwicklungsrisikos zu leistungsstarken und stabilen Persönlichkeiten heranwachsen. Doch ob ein Kind resilient ist oder nicht kann man nur dann eindeutig feststellen, wenn es erfolgreich besondere Schwierigkeiten be-wältigt hat und sich im Vergleich zu Kindern welche ähnliche Risikobelastungen erlitten ha-ben, positiv entwickelt (Wustmann, 2004: 18).
Resilienz bezieht sich nicht nur auf die reine Abwesenheit einer psychischen Beeinträchtigung sondern auch auf den Erwerb bzw. den Erhalt altersangemessener Fähigkeiten und Kompetenzen der normalen kindlichen Entwicklung. Damit ist auch die Bewältigung von altersspezifischen Entwicklungsaufgaben gemeint, in der frühen Kindheit beispielsweise ge-hören dazu die Entwicklung von Sprache und Autonomie. Von der Bewältigung einer solchen Entwicklungsaufgabe hängen die Fähigkeit zur Erfüllung der darauf folgenden Aufgabe sowie das Selbstbewusstsein und die Stabilität der Persönlichkeit ab (Wustmann, 2004: 20).
Den tatsächlichen Auswirkungen dieser gefährdenden und schützenden Umstände möchte ich in dieser Hausarbeit mit Hilfe der Frage „Wie beeinflussen Schutz- und Risikofaktoren die kindliche Entwicklung?“ nachgehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Studien zu Resilienz
- 2.1. Die „Kauai-Längsschnittstudie“ von Emmy Werner und Ruth Smith
- 2.2. Die „Bielefelder Invulnerabilitätsstudie“ von Dr. Friedrich Lösel und Doris Bender
- 3. Risikofaktoren
- 3.1 Biologische Risikofaktoren
- 3.2 Familiäre und Soziale Risikofaktoren
- 4. Schutzfaktoren
- 4.1 Schutzfaktoren des Individuums
- 4.2 Schutzfaktoren der Familie
- 4.3 Schutzfaktoren des Umfeldes
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Einfluss von Schutz- und Risikofaktoren auf die kindliche Entwicklung. Die zentrale Frage lautet: Wie beeinflussen Schutz- und Risikofaktoren die kindliche Entwicklung? Die Arbeit beleuchtet dazu zwei bedeutende Studien der Resilienzforschung und beschreibt anschließend Risikofaktoren und Schutzfaktoren im Detail.
- Einfluss von Risikofaktoren auf die kindliche Entwicklung
- Bedeutung von Schutzfaktoren für die positive Entwicklung trotz Risikofaktoren
- Die Rolle von Resilienz in der Bewältigung von Entwicklungsherausforderungen
- Analyse der Kauai-Längsschnittstudie und der Bielefelder Invulnerabilitätsstudie
- Kategorisierung und Beschreibung verschiedener Risikofaktoren (biologisch, familiär, sozial)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die These in Frage, dass negative äußere Einflüsse zwangsläufig negative Entwicklungsfolgen bei Kindern verursachen. Sie führt das Konzept der Resilienz ein und beschreibt, wie Schutzfaktoren Kindern helfen, trotz Risikofaktoren ein erfolgreiches Leben zu führen. Resilienz wird als die psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Risiken definiert. Die Arbeit kündigt die Untersuchung des Einflusses von Schutz- und Risikofaktoren auf die kindliche Entwicklung an, indem sie zwei wichtige Studien der Resilienzforschung erläutert und anschließend die einzelnen Schutz- und Risikofaktoren darstellt.
2. Studien zu Resilienz: Dieses Kapitel präsentiert zwei bedeutende Langzeitstudien zur Resilienz: die „Kauai-Längsschnittstudie“ und die „Bielefelder Invulnerabilitätsstudie“. Beide Studien untersuchen Faktoren, die die psychische Stabilität und Gesundheit von Kindern trotz besonderer Entwicklungsrisiken erhalten und fördern. Der Fokus liegt auf der positiven Entwicklung trotz hoher Risikobelastung, der Bewältigung von Stresssituationen und der Erholung von traumatischen Ereignissen. Das Kapitel verdeutlicht die interdisziplinäre Natur der Resilienzforschung und betont die Bedeutung von Langzeitstudien für das Verständnis des Phänomens.
3. Risikofaktoren: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Umstände und Faktoren, die eine psychische Beeinträchtigung und Entwicklungsstörungen bei Kindern begünstigen. Es unterscheidet zwischen biologischen, familiären und sozialen Risikofaktoren. Der Fokus liegt auf dem oft gemeinsamen Auftreten mehrerer Risikofaktoren und deren gegenseitigen Verstärkung. Beispielsweise wird der Zusammenhang zwischen Armut und weiteren Risikofaktoren wie Arbeitslosigkeit, psychischen Erkrankungen oder Alkoholabhängigkeit bei Eltern hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Resilienz, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, kindliche Entwicklung, Kauai-Längsschnittstudie, Bielefelder Invulnerabilitätsstudie, psychische Widerstandsfähigkeit, Entwicklungspsychologie, biologische Risikofaktoren, familiäre Risikofaktoren, soziale Risikofaktoren.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Einfluss von Schutz- und Risikofaktoren auf die kindliche Entwicklung
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Einfluss von Schutz- und Risikofaktoren auf die kindliche Entwicklung. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie beeinflussen Schutz- und Risikofaktoren die kindliche Entwicklung?
Welche Studien werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit analysiert zwei bedeutende Langzeitstudien: die „Kauai-Längsschnittstudie“ von Emmy Werner und Ruth Smith und die „Bielefelder Invulnerabilitätsstudie“ von Dr. Friedrich Lösel und Doris Bender. Beide Studien befassen sich mit Resilienz und der positiven Entwicklung von Kindern trotz hoher Risikobelastung.
Was versteht die Arbeit unter Resilienz?
Resilienz wird in der Arbeit als die psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Risiken definiert. Es beschreibt die Fähigkeit von Kindern, trotz negativer Einflüsse ein erfolgreiches Leben zu führen.
Welche Arten von Risikofaktoren werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen biologischen, familiären und sozialen Risikofaktoren. Es wird betont, dass diese Faktoren oft gemeinsam auftreten und sich gegenseitig verstärken können. Beispiele für den Zusammenhang zwischen Armut und weiteren Risikofaktoren wie Arbeitslosigkeit oder psychischen Erkrankungen der Eltern werden genannt.
Welche Schutzfaktoren werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet Schutzfaktoren auf individueller, familiärer und umfeldbezogener Ebene. Diese Faktoren helfen Kindern, trotz vorhandener Risikofaktoren eine positive Entwicklung zu durchlaufen.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zu den Studien zur Resilienz (Kauai- und Bielefelder Studie), ein Kapitel zu Risikofaktoren, ein Kapitel zu Schutzfaktoren und ein Fazit. Jedes Kapitel wird in der Arbeit zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Thematik der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Resilienz, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, kindliche Entwicklung, Kauai-Längsschnittstudie, Bielefelder Invulnerabilitätsstudie, psychische Widerstandsfähigkeit, Entwicklungspsychologie, biologische Risikofaktoren, familiäre Risikofaktoren, soziale Risikofaktoren.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Einfluss von Schutz- und Risikofaktoren auf die kindliche Entwicklung zu untersuchen und die Bedeutung von Resilienz für die Bewältigung von Entwicklungsherausforderungen aufzuzeigen.
- Quote paper
- Theresa Reckstadt (Author), 2008, Resilienz. Wie beeinflussen Schutz- und Risikofaktoren die kindliche Entwicklung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/142637