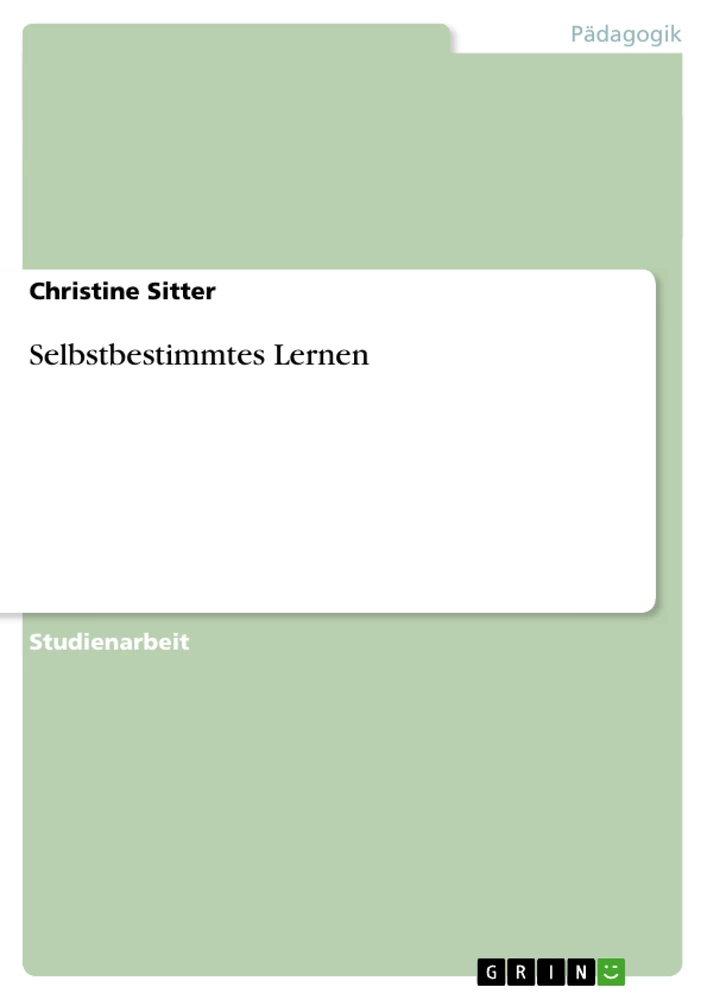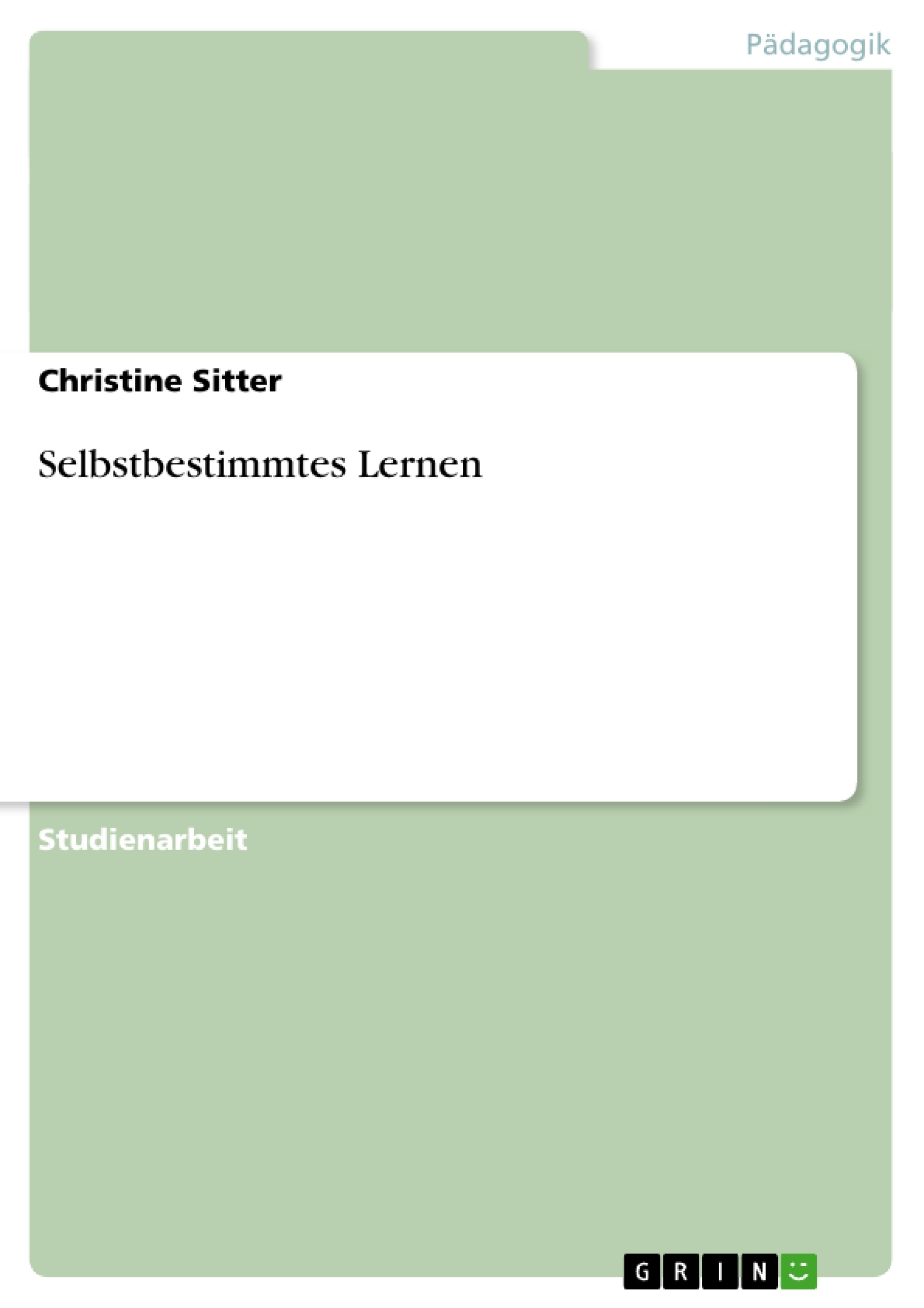In der letzten Zeit wird die Kritik an den Schulen immer lauter. Die Menschen beschweren sich darüber, dass an den Schulen zu wenig gelernt wird. Weiterhin würden sich die Schüler und Schülerinnen nicht bzw. kaum für den vermittelten Stoff interessieren, ihre Aufgaben nur oberflächlich bearbeiten, sehr viel schummeln, um gute Noten zu bekommen und schließlich das meiste gleich wieder vergessen. Diese Kritik wurde vor allem durch die PISA-Ergebnisse bestätigt, weshalb seit dieser Studie das selbstbestimmte Lernen immer wieder stärker betont wird. Durch die Interpretation der Ergebnisse dieser PISA-Studie wurde deutlich gemacht, dass das Ausmaß selbstbestimmten Lernens relevant für den Lernerfolg ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition
- 3. Geschichte
- 4. Heutiger Stand
- 5. Teilkomponenten, die das selbstbestimmte Lernen beeinflussen
- 6. Selbstbestimmtes Lernen in der Schule
- 6.1 Selbstbestimmtes Lernen vs. Fremdbestimmung in der Schule
- 6.2 Methoden in der Schule
- 7. Selbstbestimmtes Lernen jenseits der Institutionen
- 8. Schluss
- 9. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text untersucht das Konzept des selbstbestimmten Lernens, beleuchtet dessen historische Entwicklung und den aktuellen Stand in deutschen Schulen. Ziel ist es, die wesentlichen Komponenten selbstbestimmten Lernens zu identifizieren und dessen Umsetzung im schulischen Kontext zu analysieren.
- Definition und Abgrenzung selbstbestimmten Lernens
- Historische Entwicklung des Konzepts
- Einflussfaktoren auf selbstbestimmtes Lernen
- Selbstbestimmtes Lernen in der Schule im Vergleich zur Fremdbestimmung
- Methoden des selbstbestimmten Lernens in der Schule
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des selbstbestimmten Lernens ein und begründet die Relevanz des Themas vor dem Hintergrund zunehmender Kritik an der deutschen Schule und den Ergebnissen von PISA-Studien. Die Kritik an mangelndem Lernerfolg und oberflächlicher Wissensverarbeitung wird als Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit dem selbstbestimmten Lernen genannt.
2. Definition: Dieses Kapitel definiert selbstbestimmtes Lernen prägnant als die Entscheidungsfreiheit des Lernenden über Ziele, Inhalte, Methoden, Ergebnisse und Zeitpunkte des Lernprozesses. Es betont die Autonomie des Lernenden in Bezug auf alle Aspekte des Lernens.
3. Geschichte: Die Geschichte des selbstbestimmten Lernens wird skizziert, beginnend mit frühen Ansätzen im 19. Jahrhundert bei Diesterweg und der Betonung der Selbsttätigkeit. Der Text verweist auf die Reformpädagogik und Persönlichkeiten wie Maria Montessori und Gaudig, die die Bedeutung der Freiarbeit und selbstgesteuerten Lernprozesse hervorhoben. Die endgültige Etablierung des Begriffs „selbstbestimmtes Lernen“ wird mit dem amerikanischen „self-directed learning“ und Knowles in Verbindung gebracht.
4. Heutiger Stand: Dieses Kapitel beschreibt den aktuellen Stand des selbstbestimmten Lernens in deutschen Schulen als unzureichend. Die Leistungsbewertung und vorgegebene Lernziele werden als Faktoren genannt, die dem selbstbestimmten Lernen entgegenwirken. Ein großer Nachholbedarf wird festgestellt.
5. Teilkomponenten, die das selbstbestimmte Lernen beeinflussen: Der Fokus liegt auf den individuellen Voraussetzungen für erfolgreiches selbstbestimmtes Lernen. Der Text identifiziert Motivation, ein Bedürfnis nach Wissensaneignung, Selbstkontrolle, Volition (Willensstärke zur Überwindung von Motivationstiefs), Neugier und geeignete Lernstrategien (kognitive und metakognitive Strategien) als entscheidende Faktoren. Die metakognitiven Strategien werden als interne Erfolgskontrolle und Übernahme lehrertypischer Aufgaben durch den Lernenden beschrieben.
6. Selbstbestimmtes Lernen in der Schule: Dieses Kapitel untersucht die Anwendung des Konzepts im schulischen Kontext. Es wird betont, dass selbstbestimmtes Lernen nur dann gegeben ist, wenn Schüler bei relevanten Entscheidungen mitwirken dürfen. Die Mitbestimmung bei Themenwahl und -bewertung wird als essentiell hervorgehoben.
6.1 Selbstbestimmtes Lernen versus Fremdbestimmung in der Schule: Der Abschnitt vergleicht selbstbestimmtes und fremdbestimmtes Lernen im schulischen Kontext. Während Schüler oft Autonomie in Bezug auf Zeit, Ort und manchmal Thema haben, bestimmt der Lehrer Konzeption und Bewertung. Autonome Lernprozesse weisen den höchsten Grad an Selbstbestimmung auf, während lehrerzentrierter Unterricht den geringsten aufweist.
6.2 Methoden in der Schule: Hier werden Annäherungen an selbstbestimmtes Lernen in der Schule wie Stationenlernen und Wochenplanarbeit diskutiert, die jedoch als nicht vollständig selbstbestimmt eingestuft werden, da Aufgaben und Methoden vom Lehrer vorgegeben sind. Die Schüler können lediglich die Reihenfolge der Aufgaben selbst bestimmen.
Schlüsselwörter
Selbstbestimmtes Lernen, Fremdbestimmung, Lernmotivation, Lernstrategien, kognitive Strategien, metakognitive Strategien, Schulunterricht, PISA-Studie, Reformpädagogik, Autonomie.
Häufig gestellte Fragen zum Text über Selbstbestimmtes Lernen
Was ist der Inhalt des Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick zum Thema selbstbestimmtes Lernen. Er beinhaltet eine Einleitung, eine Definition des Konzepts, einen geschichtlichen Abriss, eine Analyse des aktuellen Stands in deutschen Schulen, die Beschreibung beeinflussender Faktoren, eine Betrachtung der Umsetzung im schulischen Kontext (inkl. Vergleich mit fremdbestimmtem Lernen und Methoden), und abschließend ein Resümee und Schlüsselbegriffe.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Der Text zielt darauf ab, das Konzept des selbstbestimmten Lernens zu untersuchen, dessen historische Entwicklung aufzuzeigen und den aktuellen Stand in deutschen Schulen zu beleuchten. Im Mittelpunkt steht die Identifizierung der wesentlichen Komponenten selbstbestimmten Lernens und die Analyse seiner Umsetzung im schulischen Kontext.
Wie wird selbstbestimmtes Lernen definiert?
Selbstbestimmtes Lernen wird definiert als die Entscheidungsfreiheit des Lernenden über Ziele, Inhalte, Methoden, Ergebnisse und Zeitpunkte des Lernprozesses. Es betont die Autonomie des Lernenden in Bezug auf alle Aspekte des Lernens.
Welche historischen Entwicklungen werden im Text behandelt?
Der Text skizziert die Geschichte des selbstbestimmten Lernens, beginnend mit frühen Ansätzen im 19. Jahrhundert (Diesterweg, Selbsttätigkeit), über die Reformpädagogik (Montessori, Gaudig, Freiarbeit) bis hin zur endgültigen Etablierung des Begriffs „selbstbestimmtes Lernen“ im Zusammenhang mit dem amerikanischen „self-directed learning“ und Knowles.
Wie wird der aktuelle Stand des selbstbestimmten Lernens in deutschen Schulen bewertet?
Der Text bewertet den aktuellen Stand des selbstbestimmten Lernens in deutschen Schulen als unzureichend. Leistungsbewertung und vorgegebene Lernziele werden als entgegenwirkende Faktoren genannt. Ein großer Nachholbedarf wird festgestellt.
Welche Faktoren beeinflussen selbstbestimmtes Lernen?
Als entscheidende Faktoren für erfolgreiches selbstbestimmtes Lernen werden Motivation, Bedürfnis nach Wissensaneignung, Selbstkontrolle, Volition (Willensstärke), Neugier und geeignete Lernstrategien (kognitive und metakognitive Strategien) identifiziert. Metakognitive Strategien werden als interne Erfolgskontrolle und Übernahme lehrertypischer Aufgaben durch den Lernenden beschrieben.
Wie wird selbstbestimmtes Lernen im schulischen Kontext behandelt?
Der Text untersucht die Anwendung des Konzepts im schulischen Kontext und betont, dass selbstbestimmtes Lernen nur dann gegeben ist, wenn Schüler bei relevanten Entscheidungen mitwirken dürfen. Die Mitbestimmung bei Themenwahl und -bewertung wird als essentiell hervorgehoben. Ein Vergleich mit fremdbestimmtem Lernen zeigt, dass Schüler oft Autonomie in Bezug auf Zeit, Ort und manchmal Thema haben, die Konzeption und Bewertung aber vom Lehrer bestimmt wird.
Welche Methoden des selbstbestimmten Lernens in der Schule werden diskutiert?
Stationenlernen und Wochenplanarbeit werden als Annäherungen an selbstbestimmtes Lernen diskutiert, jedoch als nicht vollständig selbstbestimmt eingestuft, da Aufgaben und Methoden vom Lehrer vorgegeben sind. Die Schüler können lediglich die Reihenfolge der Aufgaben selbst bestimmen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Selbstbestimmtes Lernen, Fremdbestimmung, Lernmotivation, Lernstrategien, kognitive Strategien, metakognitive Strategien, Schulunterricht, PISA-Studie, Reformpädagogik, Autonomie.
- Quote paper
- Christine Sitter (Author), 2006, Selbstbestimmtes Lernen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/142563