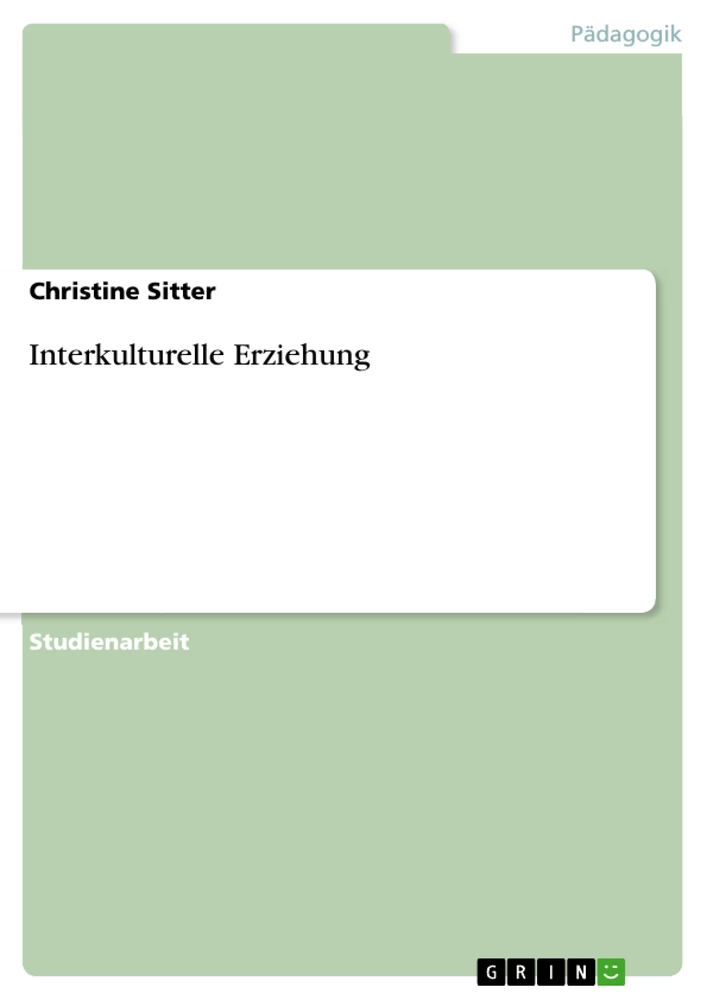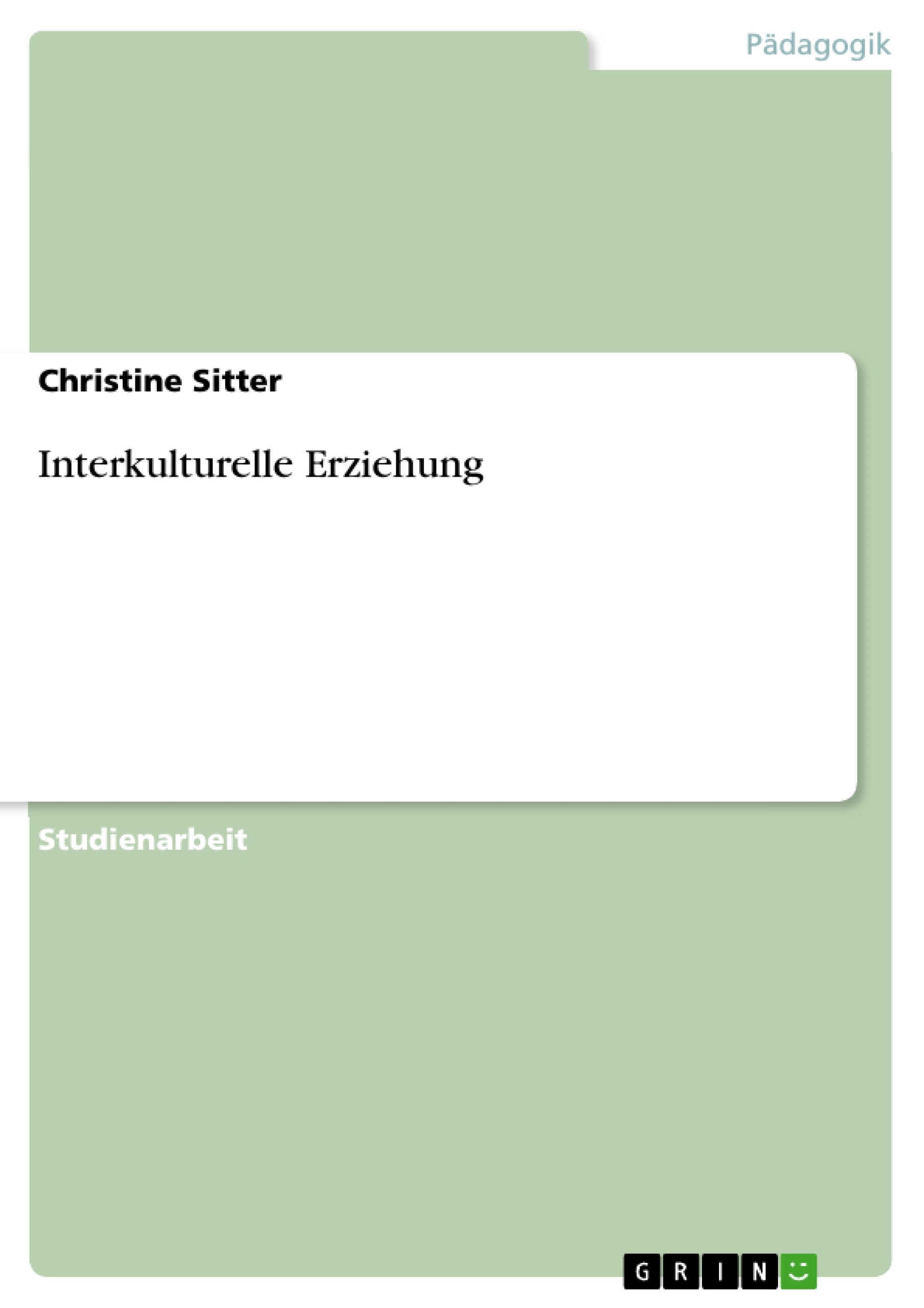In einer multikulturellen Gesellschaft wie der unseren kommen Kinder schon zu einem frühen Zeitpunkt ihres Lebens mit Kindern anderer Herkunft und aus anderen Kulturen in Berührung. Bemerken sie anfangs den Unterschied noch nicht in vollem Umfang, so geschieht dies nach und nach. Hier beginnt eine kritische Phase, in der Kinder nicht wissen, wie sie mit den neu erkannten Unterschieden umgehen sollen. Auf der anderen Seite werden die Kinder der Immigranten vor das Problem gestellt, in einer anderen Kultur als die ihrer Eltern aufzuwachsen. Sie müssen es schaffen, sich zwischen der Kultur der Eltern, die meist zuhause gelebt wird, und der Kultur des Landes zurechtzufinden. Hier setzt die interkulturelle Erziehung ein. Sie soll den Kindern helfen, diese Probleme zu meistern und die unterschiedlichen Kulturen einander näher bringen.
Die folgende Ausarbeitung beschäftigt sich mit dem Thema interkulturelle Erziehung.
Zu Beginn wird der Begriff „interkulturelle Erziehung“ erklärt, es wird geklärt, was er genau bedeutet und welche Richtziele verfolgt werden. Anschließend folgt eine Beleuchtung der Situation der interkulturellen Erziehung in Deutschland. Dabei werden die Phasen der Konzeptionalisierung zusammengefasst und bewertet. Es wird dann vorgestellt, welche Konsequenzen aus der Kritik gezogen wurden. Daraufhin folgt ein Zwischenfazit, welches die momentane Situation der inter-kulturellen Erziehung in Deutschland zusammenfasst.
Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich dann mit der Realisierung einer interkulturellen Erziehung in Deutschland. Es wird erläutert, welche interkulturelle Bedeutung die Sprache hat und welchen Stellenwert die interkulturelle Erziehung in der Schule hat. Daran anknüpfend werden die Möglichkeiten einer Institutiona-lisierung und die Realisierung im Unterricht beleuchtet. Es wird auch aufgezeigt, wie Lehrer mit interkulturellen Konflikten umgehen sollten.
Im letzten Abschnitt der Arbeit wird dann die Bedeutung der Integration und der interkulturellen Pädagogik beleuchtet. Das Ende der Arbeit bildet ein Fazit, dass die Bedeutung der interkulturellen Erziehung nochmals zusammenfasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff „Interkulturelle Erziehung“
- Bedeutung und Ausrichtung
- Richtziele der Interkulturellen Erziehung
- Interkulturelle Erziehung in der Bundesrepublik Deutschland
- Drei Phasen der Entwicklung in der Konzeptualisierung von „Ausländerpädagogik“ und „Interkultureller Erziehung“ in der Bundesrepublik Deutschland
- Gastarbeiterkinder an deutschen Schulen: „Ausländerpädagogik“ als Nothilfe
- Kritik an der „Ausländerpädagogik“
- Konsequenzen aus der Kritik: Differenzierung von Förderpädagogik und Interkultureller Erziehung
- Drei Phasen der Entwicklung in der Konzeptualisierung von „Ausländerpädagogik“ und „Interkultureller Erziehung“ in der Bundesrepublik Deutschland
- Interkulturelle Bildung und Erziehung – zum aktuellen Stand der Diskussion
- Ziele und Aufgaben interkultureller Erziehung – eine Übersicht
- Interkulturelle Bildung und Erziehung – ein erstes Fazit
- Interkulturelle Erziehung und Bildung in der Schule
- Die interkulturelle Funktion der Sprache
- Möglichkeiten der Institutionalisierung
- Realisierungsmöglichkeiten im Unterricht
- Der Umgang von Lehrerinnen und Lehrern mit interkulturellen Konflikten
- Integration und Interkulturelle Pädagogik
- Integration
- Interkulturelle Pädagogik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Begriff und die Praxis interkultureller Erziehung, insbesondere im deutschen Kontext. Sie beleuchtet die historische Entwicklung des Konzepts, analysiert dessen Ziele und Herausforderungen und betrachtet die Umsetzung in schulischen Settings. Der Fokus liegt auf der Bedeutung interkultureller Kompetenz für Lehrer und Schüler sowie den Umgang mit interkulturellen Konflikten.
- Definition und Entwicklung des Begriffs „Interkulturelle Erziehung“
- Ziele und Richtziele interkultureller Erziehung
- Herausforderungen und Umsetzung in der deutschen Schullandschaft
- Die Rolle der Sprache in der interkulturellen Bildung
- Der Umgang mit interkulturellen Konflikten im Schulalltag
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema interkulturelle Erziehung ein und beschreibt die Herausforderungen, vor denen Kinder aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen in einer multikulturellen Gesellschaft stehen. Sie umreißt den Aufbau der Arbeit und die darin behandelten Aspekte.
Der Begriff „Interkulturelle Erziehung“: Dieses Kapitel definiert den Begriff „interkulturelle Erziehung“, vergleicht ihn mit dem englischen Pendant „multicultural education“ und verfolgt dessen Entwicklung in Deutschland. Es beleuchtet die Bedeutung und Ausrichtung interkultureller Erziehung, definiert deren Richtziele und analysiert kritische Phasen in der Konzeptualisierung in Deutschland, einschließlich der Diskussion um „Ausländerpädagogik“. Das Kapitel gipfelt in einem Zwischenfazit zur aktuellen Situation.
Interkulturelle Erziehung und Bildung in der Schule: Dieses Kapitel widmet sich der konkreten Umsetzung interkultureller Erziehung im schulischen Kontext. Es untersucht die Bedeutung der Sprache als interkulturelles Werkzeug, diskutiert Möglichkeiten der Institutionalisierung und präsentiert konkrete Realisierungsmöglichkeiten im Unterricht. Ein wichtiger Aspekt ist der Umgang von Lehrkräften mit interkulturellen Konflikten.
Integration und Interkulturelle Pädagogik: Dieses Kapitel beleuchtet die enge Verknüpfung zwischen Integration und interkultureller Pädagogik. Es analysiert die Bedeutung beider Konzepte für den erfolgreichen Umgang mit kultureller Vielfalt und deren Beitrag zu einem inklusiven Bildungssystem.
Schlüsselwörter
Interkulturelle Erziehung, Multicultural Education, Ausländerpädagogik, Integration, Inklusion, kulturelle Vielfalt, Kommunikation, Konfliktmanagement, Schule, Deutschland, Identität, Toleranz, Vorurteile.
Häufig gestellte Fragen zu: Interkulturelle Erziehung in der Bundesrepublik Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit dem Begriff und der Praxis der interkulturellen Erziehung, insbesondere im deutschen Kontext. Sie untersucht die historische Entwicklung des Konzepts, analysiert dessen Ziele und Herausforderungen und betrachtet die Umsetzung in schulischen Settings. Der Fokus liegt auf der Bedeutung interkultureller Kompetenz für Lehrer und Schüler sowie dem Umgang mit interkulturellen Konflikten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Entwicklung des Begriffs „Interkulturelle Erziehung“, Ziele und Richtziele interkultureller Erziehung, Herausforderungen und Umsetzung in der deutschen Schullandschaft, die Rolle der Sprache in der interkulturellen Bildung und den Umgang mit interkulturellen Konflikten im Schulalltag. Es werden auch die Begriffe „Ausländerpädagogik“ und „Multicultural Education“ im Vergleich zu „Interkultureller Erziehung“ beleuchtet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung und einem Kapitel zur Definition und Entwicklung des Begriffs „Interkulturelle Erziehung“. Es folgt ein Kapitel zur Umsetzung interkultureller Erziehung in der Schule, welches die Rolle der Sprache, Institutionalisierungsansätze und den Umgang mit Konflikten behandelt. Ein weiteres Kapitel widmet sich der Integration und interkulturellen Pädagogik. Die Arbeit schließt mit einem Fazit.
Welche Schlüsselbegriffe werden verwendet?
Schlüsselbegriffe sind: Interkulturelle Erziehung, Multicultural Education, Ausländerpädagogik, Integration, Inklusion, kulturelle Vielfalt, Kommunikation, Konfliktmanagement, Schule, Deutschland, Identität, Toleranz und Vorurteile.
Welche Phasen der Entwicklung der Interkulturellen Erziehung in Deutschland werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt drei Phasen der Entwicklung in der Konzeptualisierung von „Ausländerpädagogik“ und „Interkultureller Erziehung“ in Deutschland: 1. Gastarbeiterkinder an deutschen Schulen: „Ausländerpädagogik“ als Nothilfe; 2. Kritik an der „Ausländerpädagogik“; 3. Konsequenzen aus der Kritik: Differenzierung von Förderpädagogik und Interkultureller Erziehung.
Was ist das Ziel der interkulturellen Erziehung?
Die Arbeit benennt verschiedene Ziele und Richtziele interkultureller Erziehung. Übergeordnete Ziele sind der Umgang mit kultureller Vielfalt, die Förderung von Toleranz und der Abbau von Vorurteilen. Konkrete Ziele beziehen sich auf die Entwicklung interkultureller Kompetenz bei Schülern und Lehrern sowie die Gestaltung eines inklusiven Bildungssystems.
Wie wird der Umgang mit interkulturellen Konflikten im Schulalltag behandelt?
Die Arbeit thematisiert den Umgang mit interkulturellen Konflikten als wichtigen Aspekt der interkulturellen Erziehung im schulischen Kontext. Es werden Möglichkeiten der Konfliktlösung und der Umgang damit von Seiten der Lehrkräfte beleuchtet.
Welche Rolle spielt die Sprache in der interkulturellen Bildung?
Die Arbeit hebt die zentrale Bedeutung der Sprache als interkulturelles Werkzeug hervor. Sie diskutiert den Einfluss von Sprache auf den Lernprozess und die Kommunikation in multikulturellen Kontexten.
- Arbeit zitieren
- Christine Sitter (Autor:in), 2007, Interkulturelle Erziehung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/142556