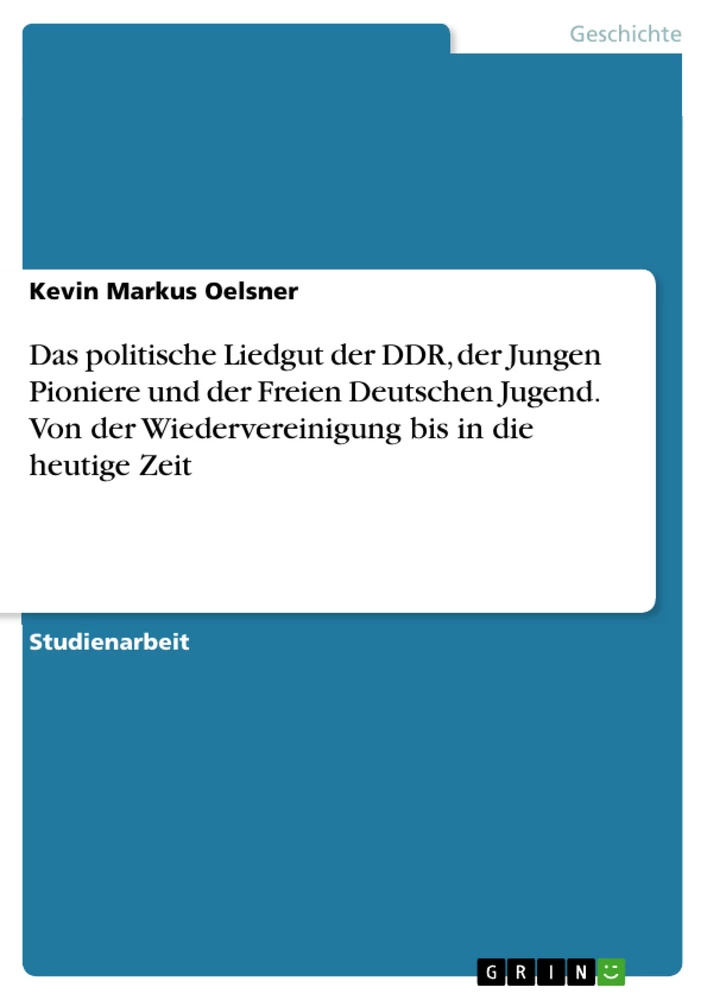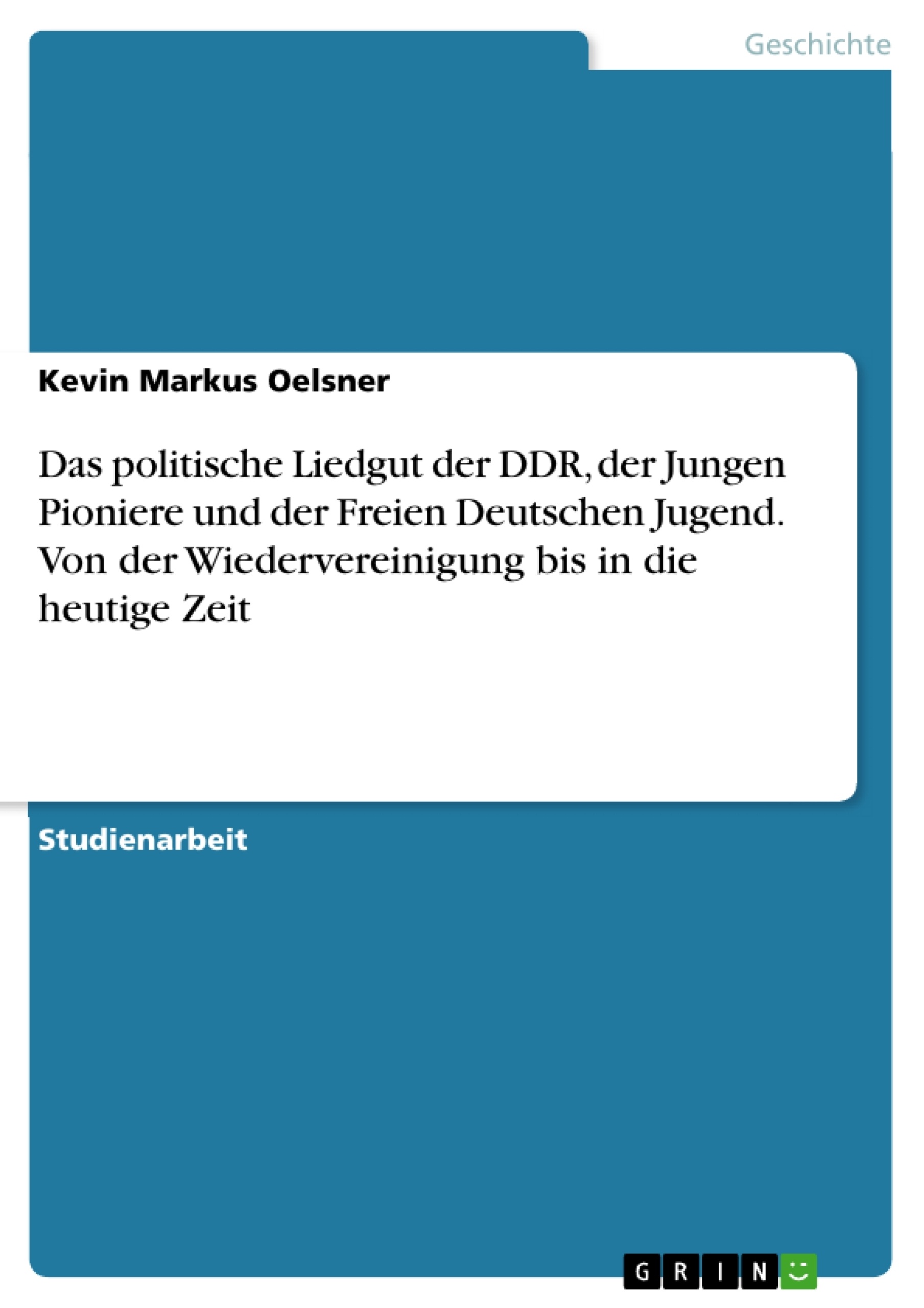Die Arbeit beantwortet folgende Forschungsfragen: Was blieb von dem politisch-musikalischen Erbe des sozialistischen Deutschlands übrig? Inwiefern ist es vergessen oder doch erinnerungswürdig?
Die Erinnerung an die DDR ist in aller Munde. Aufgrund des Jubiläums 30 Jahre Mauerfall, gab die SUPERillu ein Erinnerungsheft heraus, welches die Geschichte der DDR und vor allem deren positiven Seiten beleuchtet. Es gibt also neben jenen, die den Mauerfall feiern, auch jene, die am 7. Oktober nostalgisch in die DDR-Zeit zurückblicken. Die Erinnerungskultur boomt in diesen Tagen und mit Freude, aber auch mit Wehmut sehen die ehemaligen Bürger des verschwundenen Deutschlands in diese Zeit zurück.
Die Lebenserinnerungen an die Musik der DDR gehören ebenfalls zu dieser "Ostalgie". Bei Befragungen oder Feiern mit dem Motto "DDR", spielen die typischen Rock- und Poplieder aus den 70er und 80er Jahren eine vorrangige Rolle. Es werden die Puhdys, City oder Karat gespielt. Das politische Liedgut wird dagegen kaum beachtet.
Folgende Thesen sollen diskutiert werden:
1. Das politische Erbe der Arbeiter-, Kampf-, Jung Pionierlieder (JP) und der Lieder der Freien Deutschen Jugend (FDJ) ist fast vergessen. Sie spielen kaum eine Rolle in dem heutigen Alltag der ehemaligen DDR-Bürger und werden rudimentär genannt bei der Erinnerungskultur. Bei solchen Angaben ist der politische Inhalt der Lieder nicht federführend für das Erinnern, sondern die Personen entsinnen sich an die Kindheit. Der tiefere Sinn der musikalischen Werke ging verloren und sie bleiben als "Ostalgie" oder "Kultobjekt" einzeln bestehen, sodass sich dieses Vergessen auch innerhalb der sozialen Netzwerke widerspiegelt.
2. Trotz der Vielzahl an Liedern der FDJ und der Jungen Pioniere werden ausschließlich wenige stereotypische und repräsentative genannt. Dies spielgelt sich auch bei der Erwähnung solcher Lieder in den sozialen Netzwerken wieder.
3. Die Lieder der Jungen Pioniere und der Freien Deutschen Jugend sind zu politisch durch die DDR geprägt, sodass sich bei der heutigen, linken und öffentlichen Rezeption ausschließlich auf Arbeiter- und Kampflieder. Diese haben eine längere und kämpferische Tradition mit dem Hauptziel des Sozialismus. Mithilfe dieser ist es zudem möglich, trotz einer linken Gesinnung, eine Distanz zur DDR zu schaffen. Dies ist mit den Liedern der JP und der FDJ nicht möglich.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das sozialistische Liedgut der DDR
- 2.1. Arbeiter- und Kampflied
- 2.2. Lieder der Jungen Pioniere und der Freien Deutschen Jugend
- 3. Rezeption der Lieder in der aktuellen Zeit
- 3.1. Heutiger Vertrieb und Rezensionen
- 3.2. In den sozialen Medien
- 3.2.1. Facebook
- 3.2.2. Instagram
- 3.2.3. Youtube
- 3.3. Öffentlich-gesellschaftliche Rezeption
- 3.3.1. Luxemburg-Liebknecht-Demonstration
- 3.3.2. Rote Hering“ – Klassenkampfchor
- 3.3.3. Commandantes“
- 4. Auswertung der Umfrage
- 5. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Schicksal des politischen Liedgutes der DDR nach der Wiedervereinigung. Sie beleuchtet, inwieweit Lieder der Arbeiterbewegung, der Jungen Pioniere und der Freien Deutschen Jugend im kollektiven Gedächtnis präsent sind oder in Vergessenheit geraten sind. Die Analyse konzentriert sich auf die Rezeption dieser Lieder in verschiedenen Kontexten – von kommerziellen Vertriebswegen bis hin zu sozialen Medien und öffentlichen Auftritten.
- Das Ausmaß des Vergessens des politischen Liedgutes der DDR im heutigen Kontext.
- Die Rolle der sozialen Medien in der Rezeption und Verbreitung dieser Lieder.
- Der Einfluss der politischen Konnotation der Lieder auf ihre aktuelle Rezeption.
- Die unterschiedliche Rezeption von Arbeiterliedern und Liedern der Jugendorganisationen.
- Die Verwendung dieser Lieder in öffentlichen Demonstrationen und Veranstaltungen.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar. Sie verweist auf das wiedererwachte Interesse an der DDR im 30. Jahrestag des Mauerfalls und den damit verbundenen Boom der „Ostalgie“. Im Fokus steht dabei das weitgehend vernachlässigte politische Liedgut der DDR, das im Gegensatz zu populärer Musik kaum Beachtung findet. Die Arbeit untersucht das Ausmaß des Vergessens dieses Erbes und die Gründe dafür. Sie skizziert die zentralen Thesen: das fast vollständige Vergessen des politischen Liedguts, die selektive Erinnerung an bestimmte Lieder und die Schwierigkeit, diese Lieder aufgrund ihrer starken politischen Aufladung im aktuellen linken Kontext zu rezipieren.
2. Das sozialistische Liedgut der DDR: Dieses Kapitel analysiert das politische Liedgut der DDR, indem es auf die Arbeit von Eva Hillmann zurückgreift. Hillmanns Ausführungen über den Zweck und die Wirkung sozialistischer Lieder bilden den theoretischen Rahmen. Es werden die Kategorien „Arbeiterlied“ und „Kampflied“ differenziert, wobei deren Abgrenzung als schwierig dargestellt wird. Das Kapitel beleuchtet die idealisierte Darstellung der Arbeiterklasse in Arbeiterliedern sowie die Mythisierung von Märtyrern und Helden im Kontext der Kampflieder.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema "Sozialistisches Liedgut der DDR nach der Wiedervereinigung"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Schicksal des politischen Liedgutes der DDR nach der Wiedervereinigung. Der Fokus liegt auf der Frage, inwieweit Lieder der Arbeiterbewegung, der Jungen Pioniere und der Freien Deutschen Jugend im kollektiven Gedächtnis präsent sind oder in Vergessenheit geraten sind. Analysiert wird die Rezeption dieser Lieder in verschiedenen Kontexten, von kommerziellen Vertriebswegen bis hin zu sozialen Medien und öffentlichen Auftritten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit dem Ausmaß des Vergessens des politischen Liedgutes der DDR, der Rolle der sozialen Medien in der Rezeption und Verbreitung dieser Lieder, dem Einfluss der politischen Konnotation auf die aktuelle Rezeption, der unterschiedlichen Rezeption von Arbeiterliedern und Liedern der Jugendorganisationen sowie der Verwendung dieser Lieder in öffentlichen Demonstrationen und Veranstaltungen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) stellt den Kontext der Arbeit dar und skizziert die zentralen Thesen. Kapitel 2 ("Das sozialistische Liedgut der DDR") analysiert das politische Liedgut der DDR, unter anderem anhand der Arbeit von Eva Hillmann, und differenziert zwischen Arbeiterliedern und Kampflieder. Kapitel 3 ("Rezeption der Lieder in der aktuellen Zeit") untersucht die Rezeption in verschiedenen Bereichen, einschließlich sozialer Medien und öffentlicher Veranstaltungen. Kapitel 4 ("Auswertung der Umfrage") präsentiert die Ergebnisse einer Umfrage (der Inhalt der Umfrage wird nicht im Preview beschrieben). Kapitel 5 (Resümee) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Analyse der Rezeption des politischen Liedgutes der DDR. Die Analyse bezieht sich auf verschiedene Quellen wie kommerzielle Vertriebswege, soziale Medien (Facebook, Instagram, Youtube), öffentliche Auftritte (z.B. Luxemburg-Liebknecht-Demonstration, "Rote Hering" – Klassenkampfchor, "Commandantes") und greift auf die theoretischen Arbeiten von Eva Hillmann zurück.
Welche konkreten Beispiele für die Rezeption des Liedgutes werden genannt?
Die Arbeit nennt Beispiele für die Rezeption in sozialen Medien (Facebook, Instagram, YouTube) und bei öffentlichen Veranstaltungen wie der Luxemburg-Liebknecht-Demonstration, dem Klassenkampfchor "Rote Hering" und der Gruppe "Commandantes".
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen (laut Zusammenfassung)?
Die Zusammenfassung deutet auf ein fast vollständiges Vergessen des politischen Liedguts, eine selektive Erinnerung an bestimmte Lieder und die Schwierigkeit hin, diese Lieder aufgrund ihrer starken politischen Aufladung im aktuellen linken Kontext zu rezipieren.
- Quote paper
- Kevin Markus Oelsner (Author), 2019, Das politische Liedgut der DDR, der Jungen Pioniere und der Freien Deutschen Jugend. Von der Wiedervereinigung bis in die heutige Zeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1419654