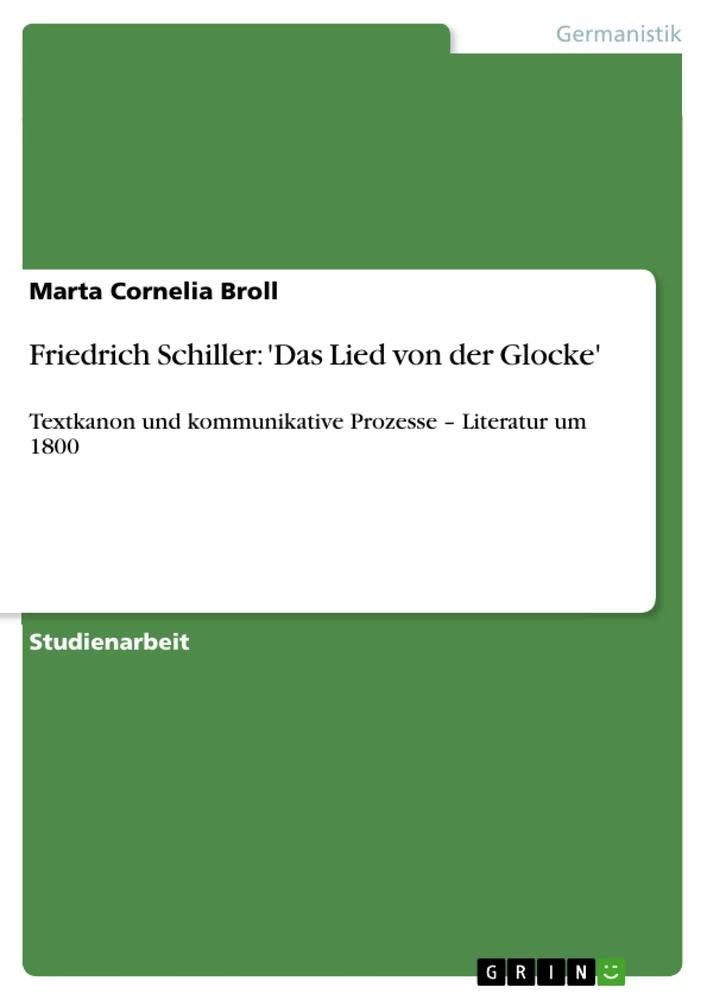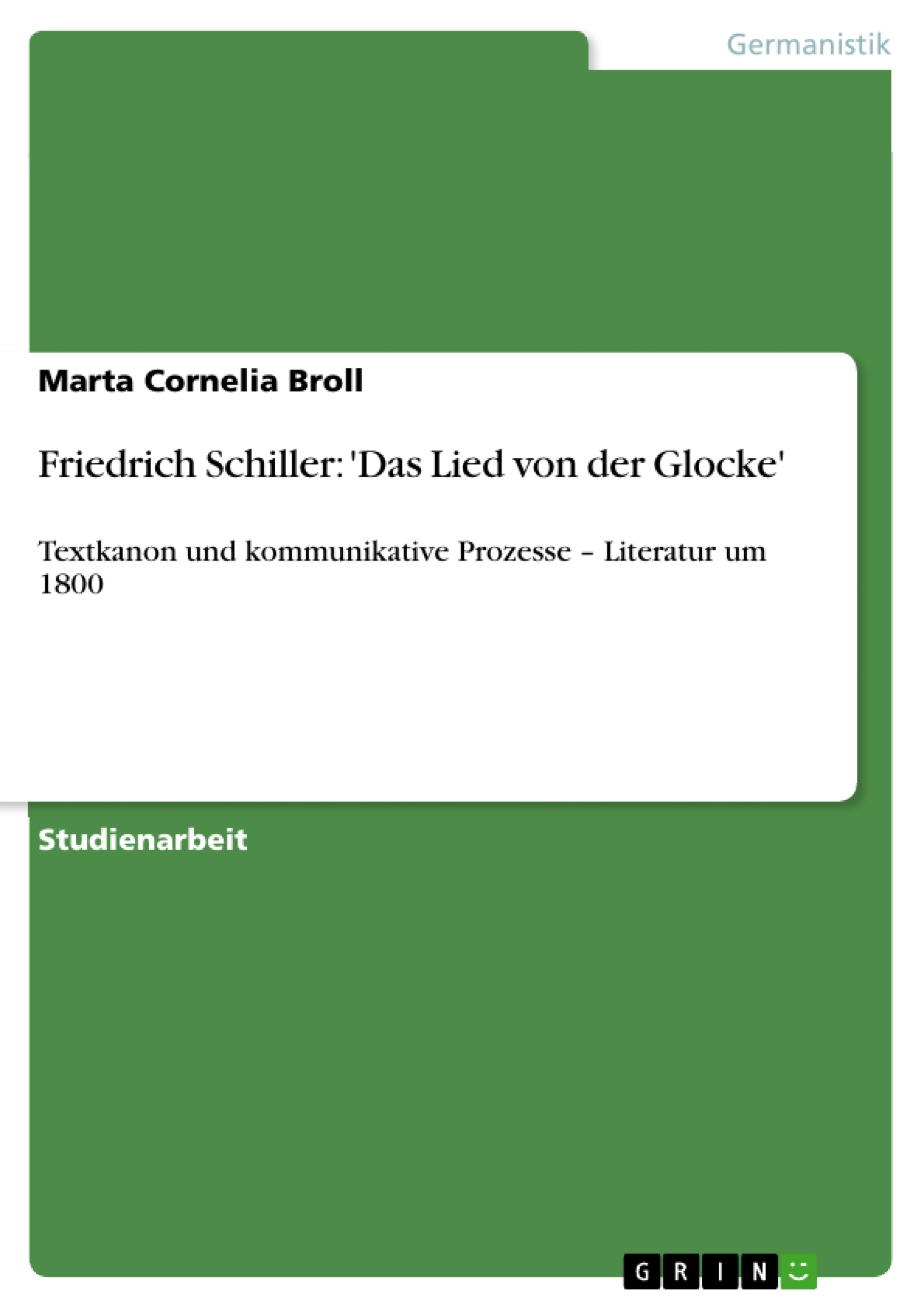»...Jetzo mit der Kraft des Stranges
Wiegt die Glock’ mir aus der Gruft,
Daß sie in das Reich des Klanges
Steige, in die Himmelsluft.
Ziehet, ziehet, hebt!
Sie bewegt sich, schwebt,
Freude dieser Stadt bedeute,
Friede sey ihr erst Geläute. «
An diesen Vers aus Schillers Lied von der Glocke werden viele, der mehr als 100.000 Menschen in Dresden gedacht haben, als die sieben Glocken der Frauenkirche zum Pfingstfest 2003 in einer Prozession zum Schlossplatz gebracht wurden. Nachdem der Landesbischof die Glocken geweiht hatte, wurde das vollständige Geläut in den Dienst der Frauenkirche gestellt und am Pfingstsonntag 2003 ertönten sie erstmals in ihren Glockenstühlen. Das Geläut der Frauenkirche bilden acht Glocken. Eine Glocke des Geläuts, Maria, stand bereits zwischen den Jahren 1734 und 1925 im Dienste der früheren Dresdner Frauenkirche. Sie kam 1998 wieder zurück nach Dresden. Jede Glocke trägt nach alter Tradition einen Namen, einen Bibelvers und eine Glockenzier. Name, Vers und Zier orientieren sich an der gottesdienstlichen Aufgabe sowie an der Geschichte und Bedeutung der Frauenkirche. Als Gedächtnisglocke vervollständigt Maria (328 kg) das Geläut.
Sieben Glocken wurden neu gegossen: die Friedensglocke Jesaja (1750 kg), die Verkündigungsglocke Johannes (1228 kg), die Stadtglocke Jeremia (900 kg), die Trauglocke Josua (645 kg), die Gebetsglocke David (475 kg), die Taufglocke Philippus (392 kg) und die Dankglocke Hanna (291 kg).
Der Nachguss von fünf Glocken für die Frauenkirche fand in der Karlsruher Gießerei Bachert statt, nachdem die im Dezember 2002 in Bad Friedrichshall gegossenen Glocken nicht den Qualitätsansprüchen entsprachen, da im mittleren Teil des Mantels der Glocken ein Teilton zweimal auftrat, was durch die starken Inschriften und Reliefs bedingt war.
Am 20.12.2002 traditionell zur Todesstunde Christi um 15.30 Uhr, begleitet vom Segen der Geistlichen und Gebeten der Gläubigen wurden die Glocken für die Frauenkirche in Dresden und eine für die Basilika von Vézelay, einem Wallfahrtsort in Burgund, aus Bronze gegossen.
Anfang Januar 2003 zeigte sich beim Leeren der Gießgruben, dass der Guss gelungen war. Der Brauch des Glockengießens, dem Friedrich Schiller in seinem berühmten, erstmals 1800 erschienen Lied von der Glocke ein literarisches Denkmal setzte, hat sich seither wenig geändert. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Friedrich Schillers klassische Lyrik
- 2. Entstehung und Erstdruck der Glocke
- 3. Friedrich Schiller: Das Lied von der Glocke
- 3.1. Metrische und sprachliche Besonderheiten
- 3.2. Die Glocke als >redende Figur<
- 4. Forschungsansichten
- 5. Gesellschaftstypus als thematisch-strukturelle Konstituente von Literatur
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Friedrich Schillers Gedicht "Das Lied von der Glocke" und analysiert seine Bedeutung im Kontext der klassischen Lyrik des Autors. Es werden die Entstehungsgeschichte des Gedichts, seine metrischen und sprachlichen Besonderheiten sowie die Funktion der Glocke als "redende Figur" untersucht. Darüber hinaus werden verschiedene Forschungsansichten zu Schillers Glocke beleuchtet und der Gesellschaftstypus als zentrale Struktur im Gedicht herausgearbeitet.
- Analyse der klassischen Lyrik Friedrich Schillers
- Entstehung und Erstdruck von Schillers "Das Lied von der Glocke"
- Metrische und sprachliche Besonderheiten des Gedichts
- Die Rolle der Glocke als "redende Figur"
- Der Gesellschaftstypus als strukturelle Komponente der Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt den Kontext des Gedichts "Das Lied von der Glocke" dar. Sie beleuchtet die Rezeption des Gedichts im Wandel der Zeit und die unterschiedlichen Perspektiven auf Schillers Werk.
- 1. Friedrich Schillers klassische Lyrik: Dieses Kapitel widmet sich der Analyse der klassischen Lyrik Schillers, die vor allem in der Zeit von 1795-1799 entstand. Es werden die wichtigsten Merkmale von Schillers lyrischem Schaffen in dieser Periode herausgestellt und die Bedeutung des Gedichts "Das Lied von der Glocke" im Kontext seiner Lyrik verdeutlicht.
- 2. Entstehung und Erstdruck der Glocke: Das zweite Kapitel beleuchtet die Entstehung und den Erstdruck von "Das Lied von der Glocke". Es werden die historischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Entstehung des Gedichts sowie die Umstände seines ersten Erscheinens im Jahr 1800 dargestellt.
- 3. Friedrich Schiller: Das Lied von der Glocke: In diesem Kapitel wird das Gedicht selbst analysiert. Dabei werden insbesondere die metrischen und sprachlichen Besonderheiten, die Rolle der Glocke als "redende Figur" und die darin enthaltenen symbolischen Bedeutungen untersucht.
- 4. Forschungsansichten: Das vierte Kapitel präsentiert verschiedene Forschungsansichten zu Schillers "Das Lied von der Glocke". Es werden unterschiedliche Interpretationen des Gedichts beleuchtet und ihre jeweiligen Stärken und Schwächen diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Begriffen und Themen der klassischen Lyrik Friedrich Schillers, insbesondere mit dem Gedicht "Das Lied von der Glocke". Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: klassische Lyrik, Friedrich Schiller, "Das Lied von der Glocke", Metrik, Sprache, Symbolismus, Gesellschaftstypus, Forschungsansichten, Interpretationen.
- Quote paper
- Magistra Artium Marta Cornelia Broll (Author), 2009, Friedrich Schiller: 'Das Lied von der Glocke', Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/140692