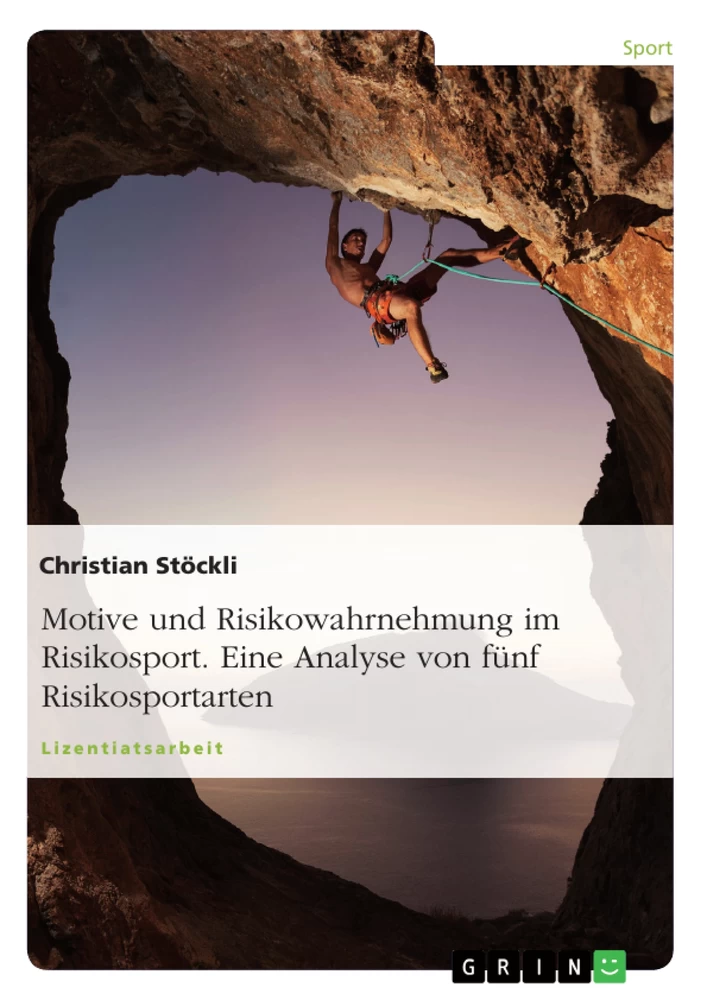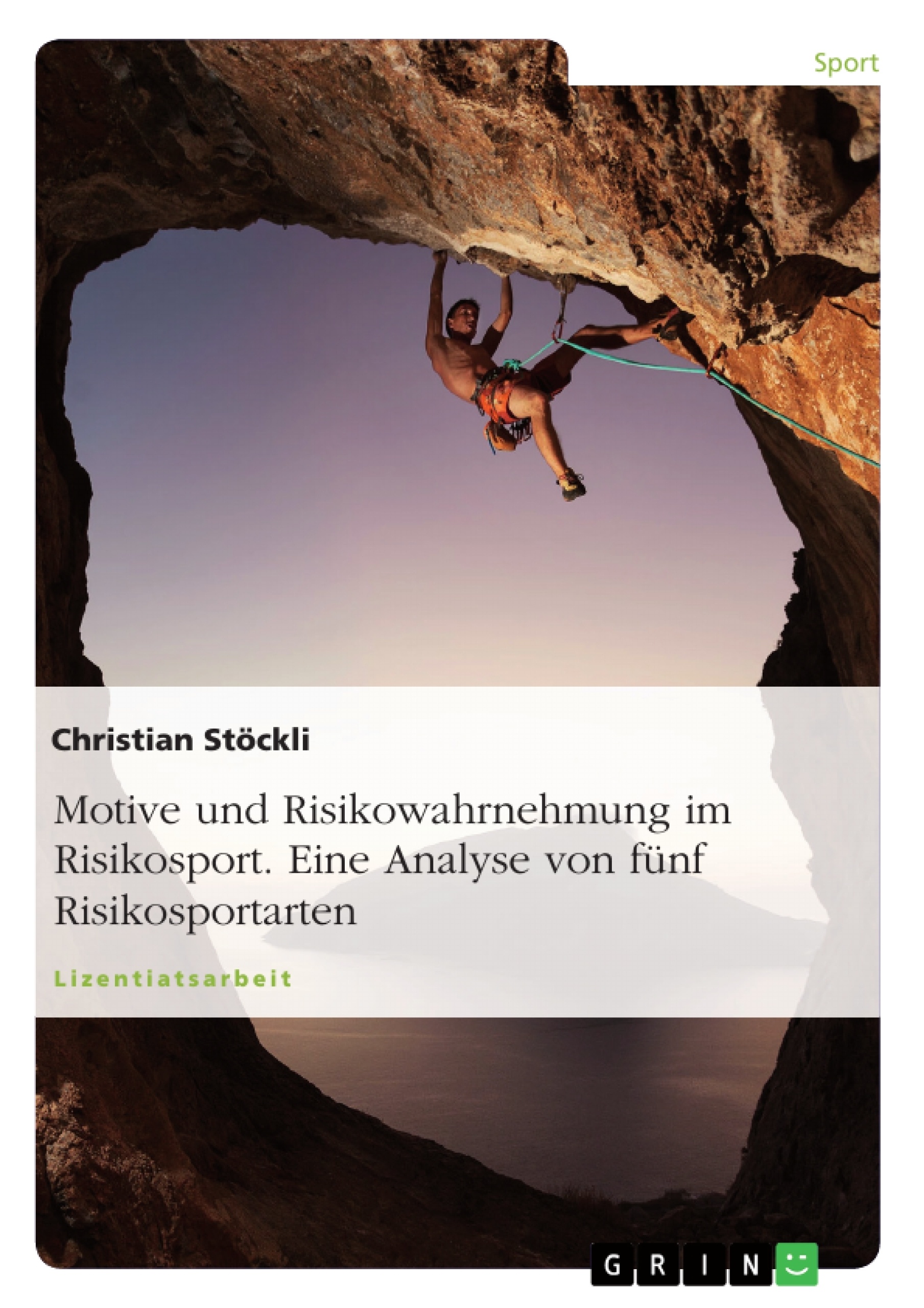Die vorliegende Arbeit untersucht Motive für die Partizipation am Risikosport und die Risikowahrnehmung der Risikosportler. Die Probanden sind männliche Sportler, die eine oder mehrere Risikosportarten wie Base Jumping, Downhill Biking, Extrembergsteigen, Fallschirmspringen oder Freeriding betreiben. Denen gegenübergestellt wird eine Kontrollgruppe bestehend aus Sportstudenten, die Nicht-Risikosport betreiben.
Der erste Teil der Arbeit setzt sich mit dem Begriff „Risikosport“ auseinander (Kapitel 2). Da dieser jedoch nicht eindeutig abgrenzbar zum „Extremsport“ ist, wird Letzterer ebenfalls betrachtet. Es wird erklärt, was eine Sportart zu einer Risikosportart macht und die Merkmale eines Risikosportlers werden dargestellt. Zudem wird erläutert, mit welchen zentralen Problematiken zum Risikosport sich die Sportwissenschaft beschäftigt.
Im zweiten Teil werden zuerst mögliche Motive für eine Sportpartizipation erläutert (Kapitel 3). Anschliessend werden Motive für die Risikosportpartizipation zusammengestellt
aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen wie der Verhaltenspsychologie oder -biologie, der Psychoanalytik, der Geschichte etc. (Kapitel 4). Die verschiedenen Ansätze werden nicht vertieft behandelt, ausgenommen das Sensation
Seeking-Konzept von Marvin Zuckerman (1994) (Kapitel 5). Es ist eines der meist erforschten Konzepte und ein möglicher Erklärungsansatz.
Diese Theorie wurde zu Beginn der 1970er-Jahre in den Vereinigten Staaten durch Zuckerman entwickelt und bis heute vielfach verwendet und angepasst. Sensation Seeking ist ein relativ überdauerndes Persönlichkeitsmerkmal, das sich durch das Bedürfnis nach Abwechslung und der ständigen Suche nach neuen Reizen, unter Inkaufnahme von Risiken, auszeichnet. Das Sensation Seeking-Merkmal wird mit der Sensation Seeking Scale V, einem psychometrischen Erhebungsinstrument, bestehend aus den vier Subskalen „Thirll and Adventure Seeking“ (TAS), „Experience Seeking“ (ES), „Disinhibition“ (Dis) und „Boredom Susceptibility“, erfasst. Nach der Theorie von Zuckerman (2007) haben Personen mit einer hohen Sensation Seeking-Ausprägung das Bedürfnis nach häufiger Abwechslung und sind ständig auf der Suche nach starken Reizen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Problemstellung
- Risikosport
- Definition von Risikosport
- Merkmale des Risikosports
- Merkmale von Risikosportlern
- Motive im Sport
- Begriffserklärung von Motiv und Motivation
- Vielfalt der Motive im Sport
- Motive im Risikosport – eine Übersicht der Erklärungsansätze
- Risiko- und Extremsport als Reizsuche - die Revisionstheorie nach Apter
- Risiko- und Extremsport als Angstüberwindung
- Angstlust nach Balint
- Die Lust an der Angst - Erklärungsansatz nach Semler
- Risiko- und Extremsport als Grenzsuche
- Die Lust am Risiko - die Ordaltheorie von Le Breton
- Allmer: die Suche nach persönlichen Leistungs- und Risikogrenzen
- Suche nach aussergewöhnlichen Emotionszuständen - Das Flow-Konzept nach Csikszentmihalyi
- Risikosport zur Suche nach Sicherheit: das Sicherheitssuche-Modell von Von Cube
- Risikosport zur Identitätssuche - das Modell von Aufmuth
- Sensation Seeking
- Das Sensation Seeking-Konzept
- Erfassen des Sensation Seeking-Merkmals
- Die Sensation Seeking Scale-V
- Die deutschsprachige Version der SSS-V
- Kritik an Zuckerman
- Sensation Seeking und Risikosport
- Studien zum Sensation Seeking im Risikosport
- Studien zu Risikosport im Allgemeinen
- Spezifische Studien zu Bergsteigen
- Spezifische Studien zu Fallschirmspringen
- Studien zu diversen Risikosportarten
- Risikowahrnehmung
- Begriffserklärung von Risikowahrnehmung
- Risikoverhalten, Risikobereitschaft und Risikoakzeptanz
- Studien zur Risikowahrnehmung im Risikosport
- Objektive Gefährlichkeit der fünf Risikosportarten Freeriding, Downhill Biking, Fallschirmspringen, Extrembergsteigen und Base Jumping
- Base Jumping
- Freeriding
- Downhill Biking
- Extrembergsteigen
- Fallschirmspringen
- Forschungshypothesen und Operationalhypothesen
- Forschungshypothesen
- Operationalhypothesen (OH)
- OH zu den FH über die Partizipation am Risikosport
- OH zu den FH über das Sensation Seeking-Motiv
- OH zu den FH über die Risikowahrnehmung im Risikosport
- Methode
- Untersuchungsverfahren und -instrumente
- Untersuchungsverfahren
- Untersuchungsinstrumente
- Stichprobe und Untersuchungsdurchführung
- Untersuchungsplan und -design
- Untersuchungsauswertung und Auswertungsverfahren
- Untersuchungsverfahren und -instrumente
- Darstellung, Interpretation und Diskussion der Ergebnisse
- Motive für die Partizipation am Risikosport
- Stellenwert des SS-Motivs im Vergleich zu anderen Motiven
- Vergleich des Motivs „Risikosuche" unter den Risikosportarten
- Vergleich der Motive der Risikosportler und der Kontrollgruppe für die Sportpartizipation
- Persönliche, zusätzlich erwähnte Motive der Risikosportler
- Sensation Seeking
- SS-Niveau der Risikosportsportler und der Kontrollgruppe
- Unterschiede im SS-Motiv zwischen Novizen und Experten
- Risikowahrnehmung
- Einschätzung des objektiven Risikos in den Sportarten
- Unterschied in der Bewertung der Gefährlichkeit der Sportart nach Novizen und Experten
- Unterschied zwischen objektivem und subjektivem Risiko
- Zusammenhang zwischen der subjektiven Risikowahrnehmung und dem SS-Niveau der Sportler
- Unterschied in der Risikowahrnehmung zwischen Risikosportlern und der Kontrollgruppe
- Motive für die Partizipation am Risikosport
- Schlussfolgerungen, Kritik und Ausblick
- Schlussfolgerungen
- Kritik an der methodischen Vorgehensweise
- Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Lizentiatsarbeit von Christian Stöckli befasst sich mit der Analyse von Motiven für die Partizipation am Risikosport und der Risikowahrnehmung von Risikosportlern. Die Arbeit untersucht fünf Risikosportarten: Base Jumping, Downhill Biking, Extrembergsteigen, Fallschirmspringen und Freeriding. Ziel ist es, die Motivlandschaft von Risikosportlern zu erforschen und den Stellenwert des Sensation Seeking-Motivs zu analysieren. Darüber hinaus wird die subjektive Risikowahrnehmung der Sportler untersucht und ein möglicher Zusammenhang mit dem Sensation Seeking-Niveau geprüft.
- Motive für die Partizipation am Risikosport
- Das Sensation Seeking-Motiv
- Die Risikowahrnehmung von Risikosportlern
- Der Zusammenhang zwischen Sensation Seeking und Risikowahrnehmung
- Vergleich von Risikosportlern und einer Kontrollgruppe
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung der Arbeit vor und führt in die Thematik des Risikosports ein. Kapitel 2 definiert den Risikosport, beschreibt seine Merkmale und charakterisiert Risikosportler. Kapitel 3 beleuchtet die Bedeutung von Motiven im Sport und erläutert den Begriff der Motivation. Kapitel 4 bietet eine umfassende Übersicht verschiedener Erklärungsansätze für die Motive im Risikosport, darunter die Revisionstheorie nach Apter, die Angstüberwindungstheorie, die Grenzsuchetheorie und das Flow-Konzept nach Csikszentmihalyi. Kapitel 5 widmet sich dem Sensation Seeking-Konzept, beschreibt die Sensation Seeking Scale-V und analysiert die Bedeutung dieses Motivs im Risikosport. Kapitel 6 behandelt die Risikowahrnehmung und beleuchtet die Zusammenhänge zwischen Risikoverhalten, Risikobereitschaft und Risikoakzeptanz. Kapitel 7 untersucht die objektive Gefährlichkeit der fünf untersuchten Risikosportarten. Kapitel 8 formuliert die Forschungshypothesen und Operationalhypothesen der Arbeit. Kapitel 9 beschreibt die Methode der Untersuchung, die Stichprobe und die Untersuchungsdurchführung. Kapitel 10 präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung und diskutiert diese im Detail. Kapitel 11 fasst die Schlussfolgerungen der Arbeit zusammen, kritisiert die methodische Vorgehensweise und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Risikosport, Motive, Sensation Seeking, Risikowahrnehmung, Base Jumping, Downhill Biking, Extrembergsteigen, Fallschirmspringen, Freeriding, Sportpsychologie, Verhaltenspsychologie, Motivforschung, Persönlichkeitsmerkmale, subjektive Risikowahrnehmung, objektive Gefährlichkeit, Vergleichsgruppe, Sportstudenten, empirische Forschung.
- Quote paper
- Christian Stöckli (Author), 2009, Motive und Risikowahrnehmung im Risikosport. Eine Analyse von fünf Risikosportarten, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/140607