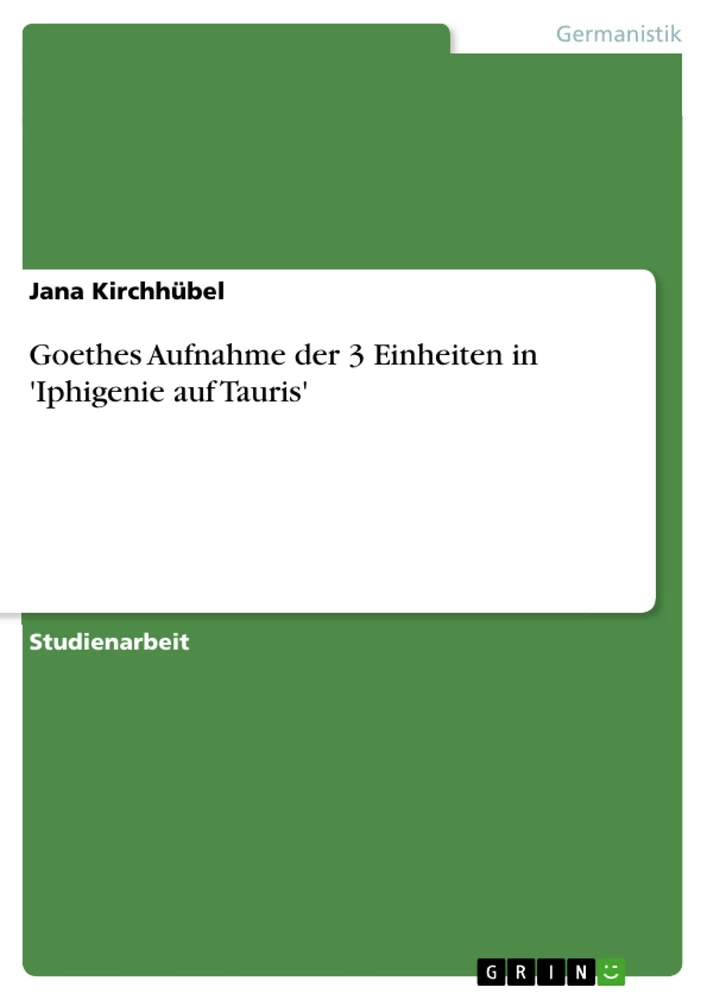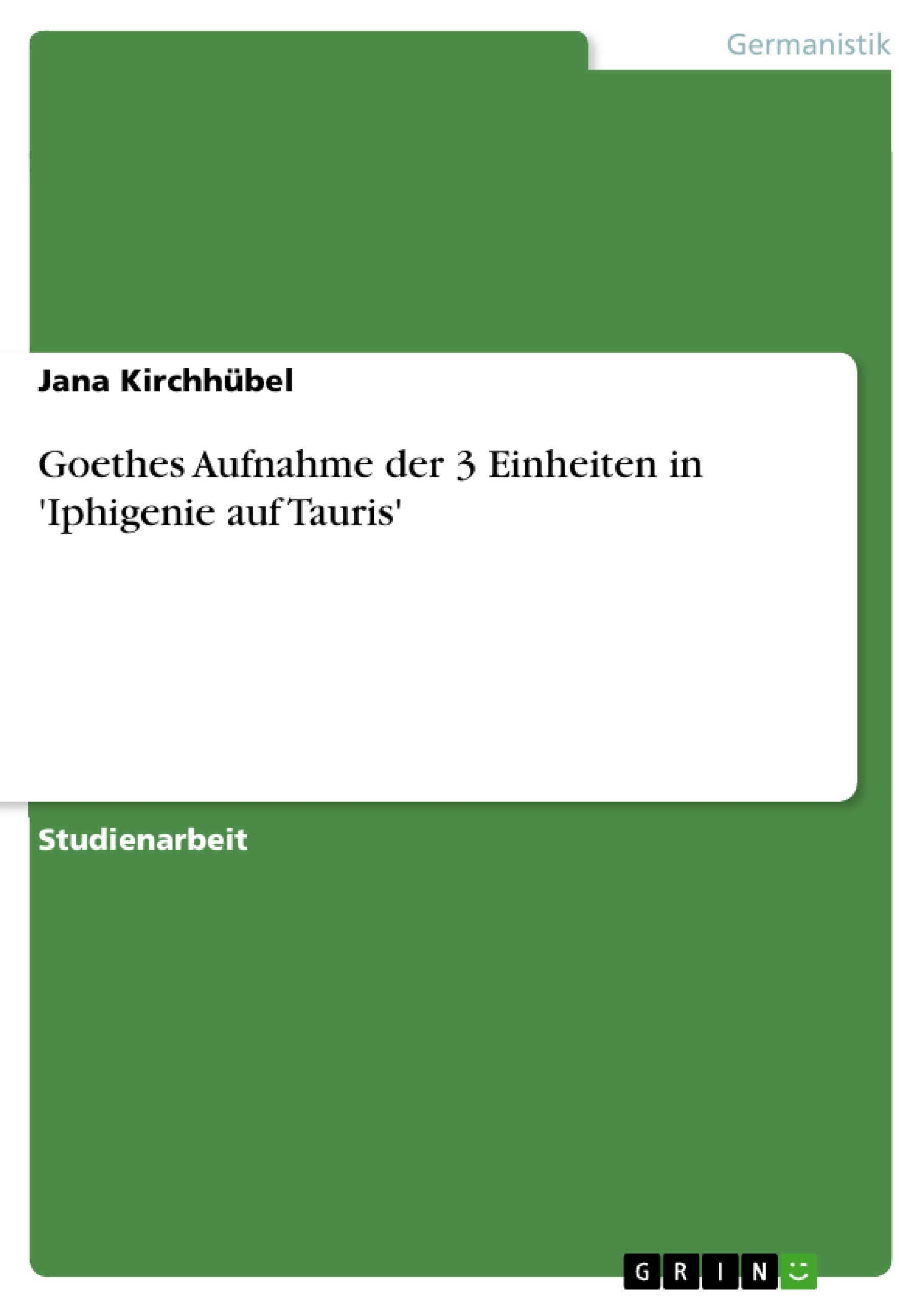Im Jahre 1771 schreibt Goethe in seiner Rede ‚Zum Shakespears Tag‘, dass er zugunsten Shakespeares und dessen Dramen „keinen Augenblick [zweifelte] dem regelmäßigen Theater“ der Franzosen mitsamt des strengen Aufbaus und den ‚drei Einheiten‘ „zu entsagen“. Kurz darauf entsteht das Sturm-und-Drang-Drama ‚Götz von Berlichingen‘, mit dem er, erfüllt von seinem Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit, jegliche klassizistischen Konventionen bricht und so manche kritische Rezension erfährt. Doch es sollte kein Jahrzehnt vergehen bis Goethe in seiner Zeit am Weimarer Hofe unter Herzog Carl August ein Werk zur Aufführung bringt, das außerordentlich klassisch geprägt war und mit welchem er eben jene Regeln des französischen Klassizismus, denen er gerade noch „Fehde" verkündet hatte, wiederentdeckt – oder, auf seine Art und Weise, völlig neu entdeckt. Dieses Werk, das im April 1779 im Rahmen des Liebhabertheaters aufgeführt wird, ist die erste Fassung der ‚Iphigenie auf Tauris‘. Es sollten noch weitere sieben Jahre vergehen, bis diese erste, Prosafassung der ‚Iphigenie‘, „in neue Verse geschnitten“, ihre endgültige (Blankvers-)Form findet. So wird in Rom am 29. Dezember 1786 ein Werk fertiggestellt, das bis heute aufgrund seines regelmäßigen Aufbaus und seiner Formstrenge zu den hervorragendsten Werken zählt – wenn es nicht gar als das klassischste aller deutschen Dramen angesehen wird.
Nun ist es mehr als verwunderlich, dass Goethe, nachdem er soeben den Franzosen mit ihren ‚drei Einheiten‘ e n t sagte, ein Drama verfasste, das diesen Regeln – zumindest scheinbar – in ihrer gänzlichen und vollkommenen Ausprägung z u sagte. Folglich gilt es also zu klären: Was mag Goethe dazu bewegt haben, wieder den alten klassizistischen Faden aufzunehmen? Setzte er tatsächlich alle Forderungen im französischen Sinne um? Oder passte er diese nicht vielmehr seinen eigenen Vorstellungen und denen seiner Zeitgenossen an? Auf welche Art und Weise geschah das? Dazu muss zunächst einmal untersucht werden, was die Forderungen überhaupt besagten, die vor allem durch die französischen Dramatiker Pierre Corneille und Jean Racine an Bedeutung erfahren haben, aber bereits in Aristoteles‘ ‚Poetik‘ ihren Ursprung finden. Bei allen diesen Untersuchungen steht die Thematik der ‚drei Einheiten‘ im Vordergrund.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Lehre von den drei Einheiten in der griechischen Dramatik
- Die Auseinandersetzung mit der antiken Regelpoetik in der Neuzeit
- Die Umsetzung der drei Einheiten in Goethes „Iphigenie“
- Die Einheit der Handlung
- Die Einheit des Ortes und der Zeit
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht Goethes „Iphigenie auf Tauris" im Kontext der „drei Einheiten“ und analysiert, wie Goethe diese antiken dramatischen Regeln in seinem Werk umsetzt. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung der „drei Einheiten“ in der griechischen Dramatik und die Auseinandersetzung mit der antiken Regelpoetik in der Neuzeit.
- Die „drei Einheiten“ als dramatisches Prinzip
- Goethes Umgang mit den „drei Einheiten“ in „Iphigenie auf Tauris“
- Die Bedeutung der „drei Einheiten“ für die Interpretation des Dramas
- Der Vergleich von Goethes „Iphigenie“ mit anderen dramatischen Werken
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Goethes Werk „Iphigenie auf Tauris“ vor und erläutert die Relevanz der „drei Einheiten“ für die Analyse des Dramas. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Lehre von den drei Einheiten in der griechischen Dramatik, insbesondere mit Aristoteles' Poetik. Das dritte Kapitel untersucht die Auseinandersetzung mit der antiken Regelpoetik in der Neuzeit, wobei insbesondere die französischen Dramatiker Pierre Corneille und Jean Racine betrachtet werden. Das vierte Kapitel analysiert die Umsetzung der drei Einheiten in Goethes „Iphigenie“ im Detail, wobei die Einheit der Handlung, des Ortes und der Zeit beleuchtet werden. Der Schluss fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und diskutiert die Bedeutung der „drei Einheiten“ für Goethes Werk.
Schlüsselwörter
Die „drei Einheiten“, griechische Dramatik, Aristoteles, Regelpoetik, französische Dramatik, Pierre Corneille, Jean Racine, Goethe, „Iphigenie auf Tauris“, klassisches Drama.
- Quote paper
- Jana Kirchhübel (Author), 2005, Goethes Aufnahme der 3 Einheiten in 'Iphigenie auf Tauris', Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/140599