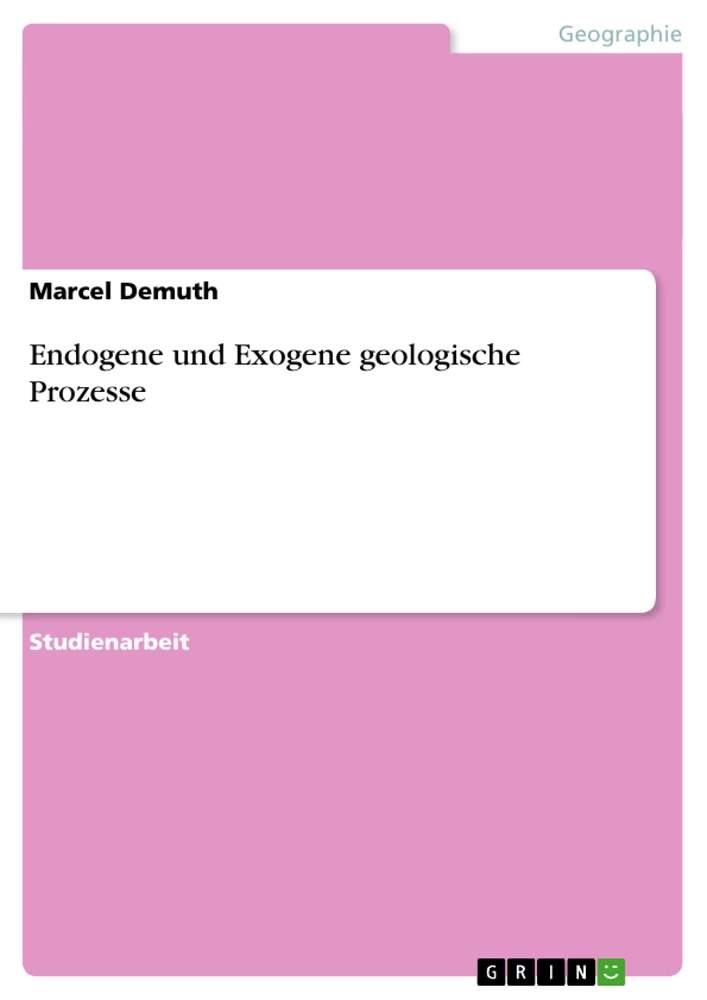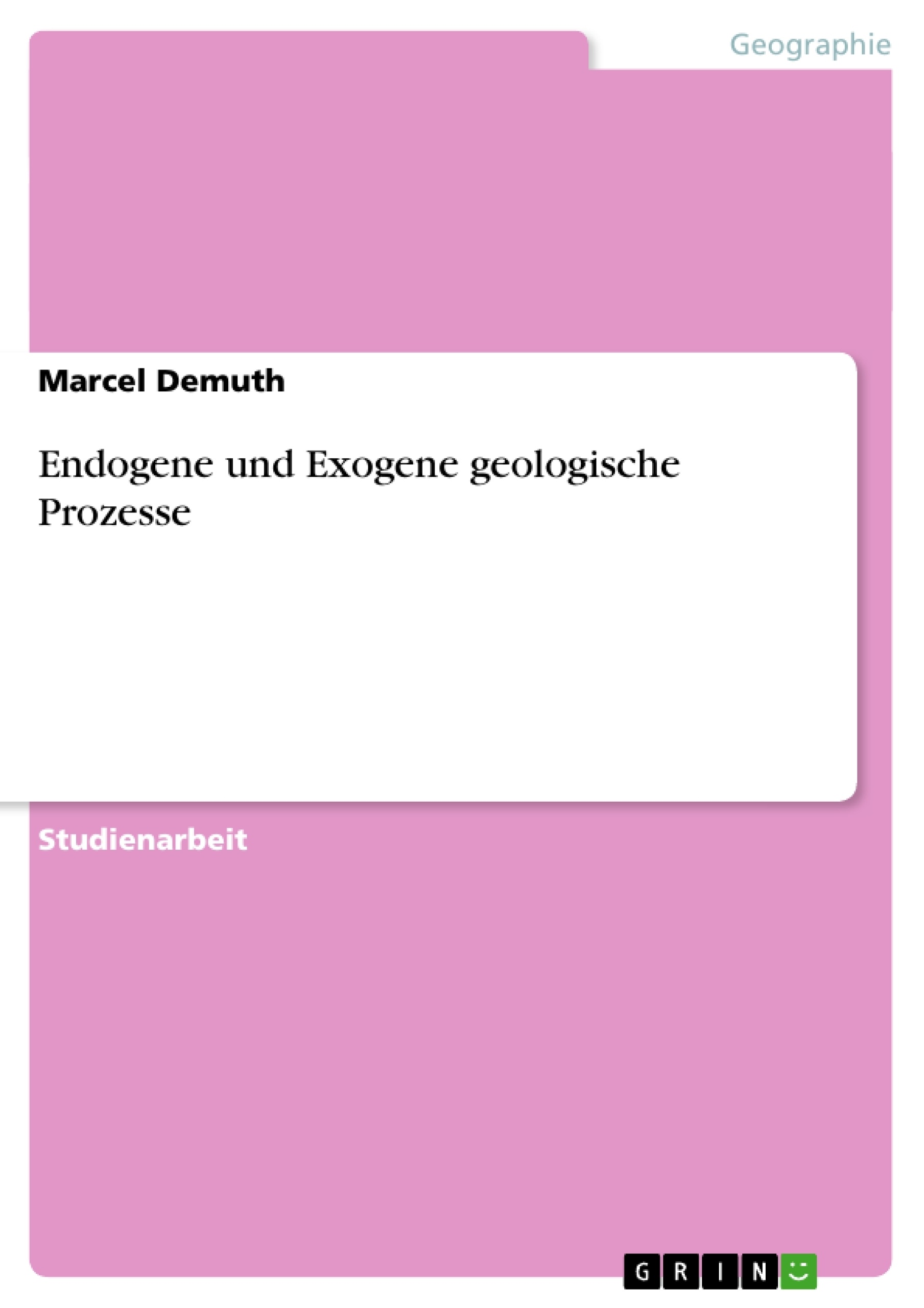Der Bau der Erde wird durch geologische Prozesse beeinflusst. Dabei kann man unterscheiden, durch welche Kräfte diese Prozesse ausgelöst und gesteuert werden. Handelt es sich um Kräfte aus dem Erdinneren, so spricht man von endogenen geologischen Prozessen.
Vor allem die Plattentektonik, angetrieben durch Konvektionsströme1, spielt hier eine entscheidende Rolle. Jene Prozesse, welche durch Kräfte außerhalb der Erde angetrieben werden, bezeichnet man als exogene geologische Prozesse. Die Energie, welche diese Kräfte antreibt, generiert sich zum Einen durch den radioaktiven Zerfall im Erdkern (endogene Prozesse) und zum Anderen durch thermonukleare Reaktionen in der Sonne (exogene Prozesse). Die grundlegendsten dieser geologischen Prozesse spielen eine wesentliche Rolle bei der Entstehung der Gesteine. Diese ist in besonders anschaulicher Weise zum „Kreislauf der Gesteine“ zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Magma
2.1 Abkühlungsprozesse
3 Magmatit
3.1 Hebungs-und Senkungsprozesse
4 Verwitterung-Erosion-Abtragung
5 Lockersedimente-Sedimentgestein
5.1 Ablagerungsprozess
5.2 Verfestigung und Diagenese
6 Metamorphose
7 Magma-und Krustenbildung
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Gesteinskreislauf
Abbildung 2: Granit
Abbildung 3: Basalt
Abbildung 4: Schalenbau der Erde
Abbildung 5: Platten und Plattengrenzen
Abbildung 6: Krustentypen
Abbildung 7: Kollision von zwei ozeanischen Platten
Abbildung 8: Kollision einer ozeanischer mit einer kontinentalen Platte
Abbildung 9: Kollision von zwei kontinentalen Platten
Abbildung 10: Hebungs- und Senkungsprozesse
Abbildung 11: Verwitterung – Abtragung – Ablagerung
Abbildung 12: Sedimentationsräume
Abbildung 13: Evaporitbildung
Abbildung 14: Sedimentbecken
Abbildung 15: Diageneseprozesse
Abbildung 16: Metamorphosearten
Abbildung 17: Magma- und Krustenbildung 1
Abbildung 18: Magma- und Krustenbildung 2
1 Einleitung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Gesteinskreislauf (Quelle: Press / Siever (2003), S. 69, Abb. 3.6)
Der Bau der Erde wird durch geologische Prozesse beeinflusst. Dabei kann man unterscheiden, durch welche Kräfte diese Prozesse ausgelöst und gesteuert werden. Handelt es sich um Kräfte aus dem Erdinneren, so spricht man von endogenen geologischen Prozessen. Vor allem die Plattentektonik, angetrieben durch Konvektionsströme[1], spielt hier eine entscheidende Rolle. Jene Prozesse, welche durch Kräfte außerhalb der Erde angetrieben werden, bezeichnet man als exogene geologische Prozesse. Die Energie, welche diese Kräfte antreibt, generiert sich zum Einen durch den radioaktiven Zerfall im Erdkern (endogene Prozesse) und zum Anderen durch thermonukleare Reaktionen in der Sonne (exogene Prozesse). Die grundlegendsten dieser geologischen Prozesse spielen eine wesentliche Rolle bei der Entstehung der Gesteine. Diese ist in besonders anschaulicher Weise zum „Kreislauf der Gesteine“ (siehe Abbildung 1) zusammengefasst (PRESS / Siever 2005, S. 69 f).
2 Magama
Die Wahl des Magmas als Startpunkt im Kreislauf der Gesteine hat keinerlei Bedeutung und soll nur den Einstieg in dieses Thema ermöglichen. Da Magma das am tiefsten vorkommende „Element“ dieses Kreislaufes ist, scheint dieser Punkt jedoch der sinnvollste für den Einstieg in diese Thematik. Magma ist ein „natürlich vorkommendes, geschmolzenes Gesteinsmaterial, aus dem durch Abkühlung magmatisches Gestein entsteht“ (Press / Siever 2003, S. 692). Es hat eine Mindesttemperatur von 700oC und ist, wie in der Definition erwähnt, flüssig. Die flüssige Gesteinsschmelze hat eine geringere Dichte als ihr festes Pendant, wodurch das Magma aufsteigt. Einerseits durch den Auftrieb, welcher durch die Druckunterschiede hervor gerufen wird, aber auch durch das Einwirken des hydrostatischen Druckes (Bahlburg / Breitkreutz 2004, S. 268).
2.1 Abkühlungsprozesse
Abb. 3: Basalt (Quelle: Press / Siever (2003), S. 64, Abb. 3.2)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Granit (Quelle: Press / Siever (2003), S. 64, Abb. 3.2)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Durch den Aufstieg in kalte Gesteinsschichten gibt das Magma Wärmeenergie an das umliegende Gestein ab. Der Aufstieg und somit auch die Abkühlung geschehen in zweierlei Weise. Einerseits kann der Aufstieg langsam erfolgen, wodurch das Magma sehr langsam abkühlt. Ab einer bestimmten Temperatur, welche als Kristallisationstemperatur bezeichnet wird, beginnen sich in der Schmelze kleine Kristalle zu bilden. Diese Kristalle benötigen eine bestimmte Zeit um zu wachsen, welche nur bei einer langsamen Abkühlung gegeben ist. Das Magma kann sehr langsam aufsteigen, wodurch es bereits in der Erdkruste erstarrt. Die dort entstehenden Gesteine werden als Intrusivgestein oder Plutonite bezeichnet. Dieses Gestein ist sehr grobkristallin und grobkörnig. Ein Intrusivgestein ist beispielsweise der Granit (siehe Abbildung 2). Andererseits kann Magma sehr schnell abkühlen. Dies geschieht durch den schnellen Transport des Magmas durch die Erdkruste an die Erdoberfläche. Wenn das Magma an der Oberfläche durch vulkanische Tätigkeiten austritt, wird es als Lava bezeichnet. Wie schnell diese Lava abkühlt, hängt von den vorhandenen Medien ab. Kommt es zur Abkühlung der Lava durch den Kontakt mit Wasser, so findet eine regelrechte Abschreckung statt und es können sich keinerlei Kristalle bilden. Das Erscheinungsbild des dabei entstehenden Gesteins ist dem des Glases ähnlich. Erfolgt die Abkühlung durch die Luft, so haben die Kristalle eine gewisse Zeit zum auskristallisieren und es entstehen feinkristalline Gesteine, wie beispielsweise Basalt (siehe Abbildung 3). Man bezeichnet diese Gesteine als Effusivgestein oder Vulkanite. Diese beiden Gesteinsarten werden in der Gruppen der Magmatite zusammengefasst (Zeil 1990, S. 201 f).
3 Magmatite
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4: Schalenbau der Erde (Quelle: Press / Siever (2003), S. 13, Abb. 1.6c)
Nach der Bildung der Magmatite kommt es entweder zu Hebungs- oder zu Senkungsprozessen der Festgesteine. Die Erde hat einen schalenförmigen Aufbau, dessen äußere Schale die Erdkruste ist (siehe Abbildung 4). Diese Schale ist nicht durchgehend, sondern in starre Platten zerbrochen (siehe Abbildung 5). Diese Platten sind ständig in Bewegung, angetrieben durch die Konvektionsströme im Erdmantel. Dadurch sind die Grenzen dieser Platten geologisch höchst aktive Gebiete und der größte Teil der Hebungs- und Senkungsprozesse finden dort statt (Press /Siever 2003, S. 20).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 5: Platten und Plattengrenzen (Quelle: Press / Siever (2003), S. 20, Abb. 1.12)
Es lassen sich drei Hauptbewegungstypen und daraus resultierend drei unterschiedliche Plattengrenzen charakterisieren: Bewegen sich die Platten aufeinander zu, liegt eine konvergierende Plattengrenze vor. Entfernen sich die Platten voneinander, handelt es sich um eine divergierende Plattengrenze. Wenn sich die Platten aneinander vorbei bewegen, wird dies als eine Transformstörung bezeichnet. Hebungsprozesse am Rande von Platten finden konzentriert an den konvergierenden Plattengrenzen statt (Richter 1992, S. 263 f).
[...]
[1] „Bewegungen im zähplastischen Bereich des Magmas unterhalb der Erdkruste, die letztlich zu Erdkrustenbewegungen und zur Großformenbildungen führen“ (Leser 2005, S. 450).
- Quote paper
- B.Sc. Marcel Demuth (Author), 2007, Endogene und Exogene geologische Prozesse, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/140238