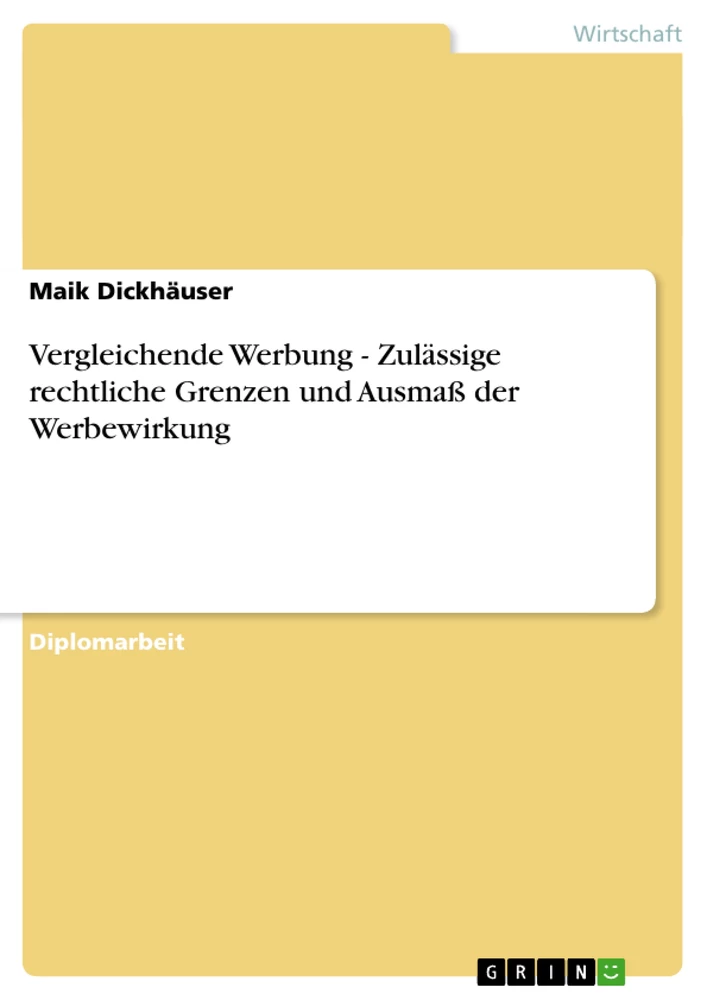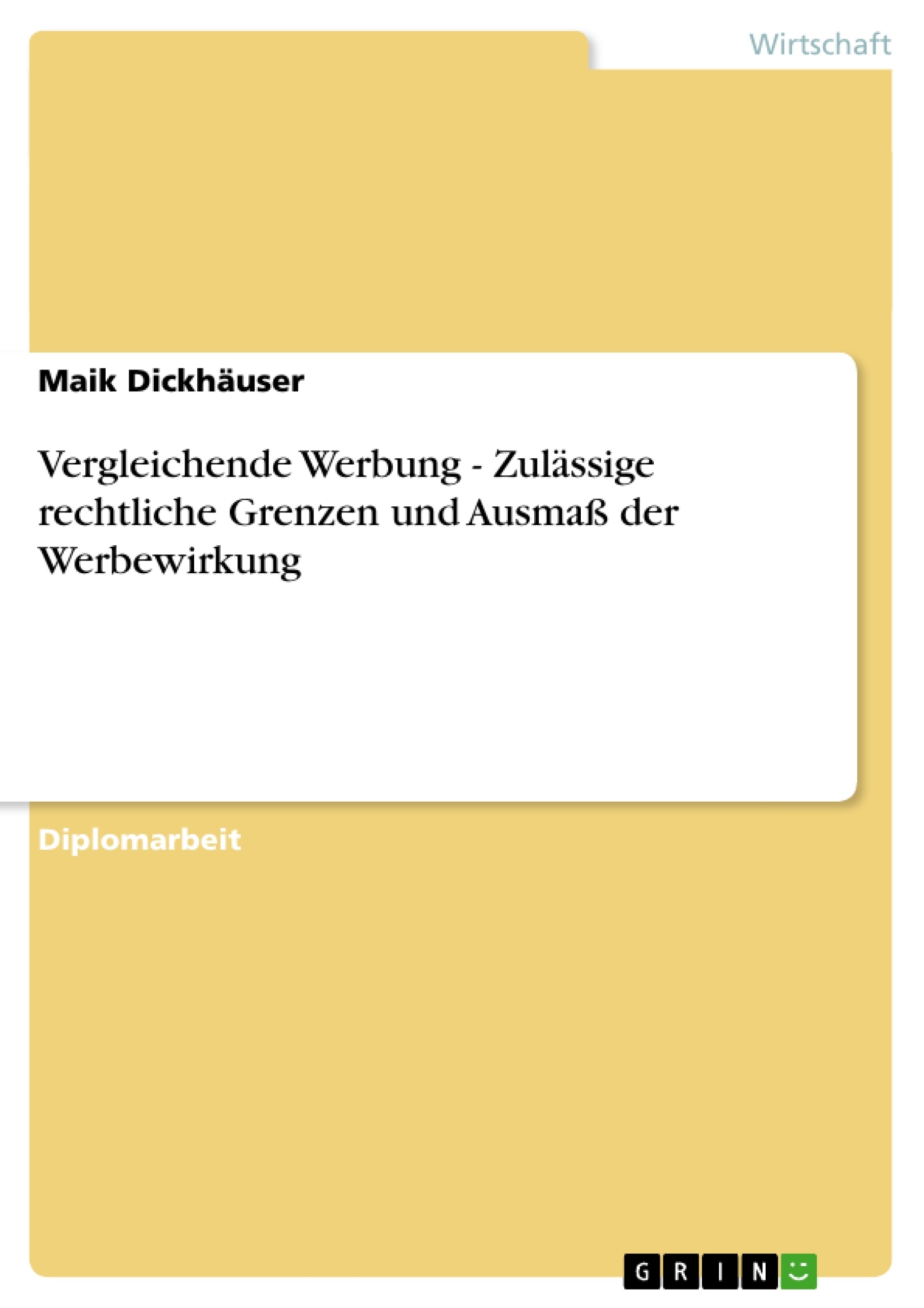Im ersten Teil erfolgt zunächst die Klärung der Bedeutung und Definition vergleichender Werbung. Ebenso wird eine Einordnung von vergleichender Werbung in den wissenschaftlichen Kontext der allgemeinen Werbung vorgenommen. Um den weitgefassten Begriff von vergleichender Werbung besser operationalisieren zu können, wird dann eine Kategorisierung der verschiedenen Ausprägungen vergleichender Werbung vorgenommen.
Im zweiten Teil werden die rechtlich zulässigen Grenzen für vergleichende Werbung in Deutschland behandelt. Die Basis für die Regelungen zur vergleichenden Werbung bilden die verschiedenen Richtlinien, welche für die heutige Form des § 6 UWG maßgeblich sind. Zu Anfang werden daher die wichtigsten Erwägungsgründe der Richtlinie 97/55/EG, ihre Umsetzungsgegebenheiten und weitere wichtige Richtlinienerlasse kurz vorgestellt. Zugleich wird auch ein Blick auf die Auswirkungen und Erwartungen gerichtet, die die Richtlinien nach ihrer Umsetzung auf die Werbenden hatte. Anschließend erfolgt die schwerpunktmäßige Erläuterung der einzelnen Tatbestandmerkmale der vergleichenden Werbung in § 6 UWG.
Im dritten Teil wird das Ausmaß der Werbewirkung von vergleichender Werbung mithilfe verschiedener Modelle untersucht und die Faktoren vorgestellt, welche einen maßgeblichen Einfluss auf die Stärke der Werbewirkung vergleichender Werbung haben. Anschließend werden die einzelnen Chancen und Risiken eruiert, die mit der Verwendung dieses Werbeinstrumentes einhergehen. Neben der Frage nach den Gründen für die geringe Verbreitung wird auch die Bedeutung von vergleichender Werbung innerhalb der Marketingstrategie berücksichtigt. Darauf basierend folgen einige praktische Gestaltungshinweise für den Werbenden, sowie Handlungs-empfehlungen für betroffene Konkurrenten.
Schließlich liefert eine Zusammenfassung die Schlusszüge aus den rechtlichen Vorschriften und dem Stand der die Werbewirkung vergleichender Werbung betreffenden Forschung.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einführung
- B. Erster Teil: Begriffsbestimmung und Formen der vergleichenden Werbung
- I. Begriffliche Grundlagen
- 1. Werbung im wissenschaftlichen Kontext
- 2. Definition der vergleichenden Werbung
- 3. Ökonomische Bedeutung
- II. Formen der vergleichenden Werbung
- 1. Unterscheidung nach Vergleichsgegenstand
- a) Direkte Bezugnahme
- b) Indirekte Bezugnahme
- 2. Unterscheidung nach Vergleichsaussage
- a) Kritisierende vergleichende Werbung
- b) Anlehnende vergleichende Werbung
- c) Persönlich vergleichende Werbung
- d) Alleinstellungs- und Spitzengruppenwerbung
- 3. Vergleichende Werbung ohne Mitbewerberbezug
- C. Zweiter Teil: Rechtsvorschriften zur Zulässigkeit vergleichender Werbung
- I. Die Richtlinie 97/55/EG
- 1. Entstehung
- 2. Erwägungsgründe
- 3. Umsetzung in nationales Recht
- 4. Weitere Richtlinienerlasse
- 5. Einfluss der RL auf die Aktivitäten der Werbenden
- II. § 6 UWG, Allgemeines
- 1. Anwendungsbereich
- a) Abgrenzung zur persönlich vergleichenden Werbung
- b) Abgrenzung zur Alleinstellungs- und Spitzengruppenwerbung
- c) Aufforderung zum Vergleich
- 2. Verhältnis zu anderen UWG Vorschriften
- a) Die Generalklausel des § 3 UWG
- b) § 4 Nr. 7 UWG, Herabsetzung
- c) § 4 Nr. 8 UWG, Anschwärzung
- d) § 4 Nr. 9 UWG
- e) § 4 Nr. 10 UWG, Behinderung
- f) § 5 Nr. 3 UWG, Irreführungsverbot
- 3. Verhältnis zu anderen Normen
- a) Verbote und Beschränkungen
- b) Markengesetz
- c) Urheberrecht
- III. § 6 Abs. 1 UWG
- 1. Der Vergleich
- a) Vorbemerkung
- b) Erforderlichkeit eines Vergleichs
- c) Voraussetzungen eines Vergleichs
- d) Fehlen eines Vergleichs
- 2. Begriff der Werbung in § 6 UWG
- a) Legaldefinition
- b) Analogie zur Wettbewerbshandlung
- c) Äußerung
- d) Unternehmerisches Handeln
- e) Zweck der Absatzförderung
- f) Werbung durch Dritte Personen
- 3. Mitbewerber
- a) Legaldefinition
- b) Erkennbarkeit des Mitbewerbers
- IV. § 6 Abs. 2 UWG
- 1. Allgemeines
- 2. Verbotstatbestand der Irreführung
- 3. Übrige Verbotstatbestände
- a) Fehlende Vergleichbarkeit
- b) Unsachlicher Vergleich
- c) Verwechselungsgefahr
- d) Rufausnutzung und Rufbeeinträchtigung
- e) Herabsetzung und Verunglimpfung
- f) Imitation bzw. Nachahmung
- V. Weitere Voraussetzungen und Rechtsfolgen
- 1. Klagebefugnis
- 2. Beweislast
- 3. Rechtsfolgen
- D. Dritter Teil: Werbewirkung, Chancen und Risiken vergleichender Werbung
- I. Zusammenspiel von Werbewirkung und Werbeerfolg
- II. Modelle der Werbewirkung
- 1. Hierarchy-of-Effects-Modell
- 2. Das Modell der Wirkungspfade
- 3. Modell zur Werbewirkung vergleichender Werbung
- III. Einfluss der Werbewirkungskriterien
- IV. Weitere Einflussfaktoren der Werbewirkung
- 1. Merkmale der Werbeaussage
- a) Art des Vergleichs
- b) Vergleichsrichtung
- c) Vergleichsdarstellung
- d) Vergleichsintensität
- e) Argumentation und Kommunikator
- 2. Merkmale der verglichenen Produkte
- a) Marktanteil
- b) Produktkategorie
- c) Produktattribut
- d) Konkurrenzprodukt
- 3. Ausgewählte Merkmale der Werbeempfänger
- a) Involvement
- b) Markentreue
- c) Psychografische und demografische Kriterien
- V. Chancen und Risiken vergleichender Werbung
- VI. Verbreitung der vergleichenden Werbung
- VII. Empfehlungen für die praktische Anwendung
- 1. Strategische Bedeutung vergleichender Werbung
- 2. Geeignete Kommunikationsmittel
- 3. Vergleichende Werbung aus Sicht des Werbenden
- 4. Vergleichende Werbung aus Sicht des Betroffenen
- a) Abwehrvergleich
- b) Rechtliche Gegenmaßnahmen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die rechtlichen Grenzen und die Werbewirkung vergleichender Werbung. Ziel ist es, die Zulässigkeit vergleichender Werbung im Kontext des deutschen Rechts zu analysieren und deren Auswirkungen auf den Werbeerfolg zu beleuchten.
- Begriffsbestimmung und Formen der vergleichenden Werbung
- Rechtliche Zulässigkeit vergleichender Werbung nach deutschem Recht und EU-Recht
- Modelle der Werbewirkung und deren Einflussfaktoren
- Chancen und Risiken vergleichender Werbung
- Empfehlungen für die praktische Anwendung vergleichender Werbung
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einführung: Diese Einleitung führt in das Thema der vergleichenden Werbung ein und skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit. Sie legt den Fokus auf die Analyse der rechtlichen Grenzen und der Werbewirkung dieser Werbeform. Der wissenschaftliche Kontext wird kurz angerissen, um die Relevanz der Thematik zu unterstreichen.
B. Erster Teil: Begriffsbestimmung und Formen der vergleichenden Werbung: Dieser Teil beschäftigt sich umfassend mit der Definition und den verschiedenen Ausprägungen vergleichender Werbung. Es werden unterschiedliche Klassifizierungskriterien vorgestellt, wie die Unterscheidung nach Vergleichsgegenstand (direkte und indirekte Bezugnahme) und nach Vergleichsaussage (kritisierend, anlehnend, persönlich, Alleinstellungs- und Spitzengruppenwerbung). Die ökonomische Bedeutung der vergleichenden Werbung wird ebenfalls beleuchtet, um deren Stellenwert im Marketingkontext zu verdeutlichen. Die verschiedenen Formen werden anhand von Beispielen veranschaulicht und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile diskutiert.
C. Zweiter Teil: Rechtsvorschriften zur Zulässigkeit vergleichender Werbung: Dieser zentrale Teil der Arbeit analysiert die relevanten Rechtsvorschriften, die die Zulässigkeit vergleichender Werbung regeln. Im Fokus steht die Richtlinie 97/55/EG und deren Umsetzung in deutsches Recht (§ 6 UWG). Die Arbeit untersucht detailliert den Anwendungsbereich des § 6 UWG, seine Abgrenzung zu anderen Vorschriften des UWG und das Verhältnis zu anderen Normen wie dem Markengesetz und dem Urheberrecht. Es werden die einzelnen Tatbestände des § 6 Abs. 2 UWG (Irreführung, fehlende Vergleichbarkeit, unsachlicher Vergleich etc.) eingehend erläutert und anhand von Rechtsprechung und Literatur diskutiert. Die Analyse geht tief in die rechtlichen Feinheiten und Fallstricke der vergleichenden Werbung ein.
D. Dritter Teil: Werbewirkung, Chancen und Risiken vergleichender Werbung: Dieser Teil befasst sich mit der Werbewirkung vergleichender Werbung. Es werden verschiedene Modelle der Werbewirkung vorgestellt und deren Anwendbarkeit auf vergleichende Werbung diskutiert. Die Arbeit analysiert die Einflussfaktoren auf die Werbewirkung, wie Merkmale der Werbeaussage, Merkmale der verglichenen Produkte und Merkmale der Werbeempfänger. Schließlich werden die Chancen und Risiken vergleichender Werbung abgewogen und Empfehlungen für die praktische Anwendung gegeben. Der Teil schließt mit einer Betrachtung der Verbreitung und strategischen Bedeutung dieser Werbeform.
Schlüsselwörter
Vergleichende Werbung, Rechtliche Zulässigkeit, UWG, Richtlinie 97/55/EG, Werbewirkung, Marketing, Konsumentenverhalten, Wettbewerbsrecht, Irreführung, Vergleichbarkeit, Markengesetz, Urheberrecht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Vergleichende Werbung - Rechtliche Zulässigkeit und Werbewirkung
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die rechtlichen Grenzen und die Werbewirkung vergleichender Werbung. Sie analysiert die Zulässigkeit im deutschen Recht und beleuchtet die Auswirkungen auf den Werbeerfolg.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Begriffsbestimmung und Formen der vergleichenden Werbung, rechtliche Zulässigkeit nach deutschem und EU-Recht, Modelle der Werbewirkung und deren Einflussfaktoren, Chancen und Risiken vergleichender Werbung sowie Empfehlungen für die praktische Anwendung.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in vier Teile: Einleitung, Begriffsbestimmung und Formen der vergleichenden Werbung, Rechtsvorschriften zur Zulässigkeit und Werbewirkung, Chancen und Risiken sowie praktische Empfehlungen. Jeder Teil ist in Kapitel und Unterkapitel unterteilt, die im detaillierten Inhaltsverzeichnis ersichtlich sind.
Welche Rechtsvorschriften werden analysiert?
Die Arbeit analysiert vor allem die Richtlinie 97/55/EG und deren Umsetzung im deutschen Recht (§ 6 UWG). Es wird der Anwendungsbereich des § 6 UWG detailliert untersucht, seine Abgrenzung zu anderen UWG-Vorschriften und das Verhältnis zu anderen Normen wie dem Markengesetz und Urheberrecht.
Welche Modelle der Werbewirkung werden betrachtet?
Die Arbeit stellt verschiedene Modelle der Werbewirkung vor und diskutiert deren Anwendbarkeit auf vergleichende Werbung. Es werden Einflussfaktoren wie Merkmale der Werbeaussage, der verglichenen Produkte und der Werbeempfänger analysiert.
Welche Chancen und Risiken der vergleichenden Werbung werden diskutiert?
Die Arbeit bewertet die Chancen und Risiken vergleichender Werbung und gibt Empfehlungen für die praktische Anwendung. Es wird die Verbreitung und die strategische Bedeutung dieser Werbeform betrachtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Vergleichende Werbung, Rechtliche Zulässigkeit, UWG, Richtlinie 97/55/EG, Werbewirkung, Marketing, Konsumentenverhalten, Wettbewerbsrecht, Irreführung, Vergleichbarkeit, Markengesetz, Urheberrecht.
Wie werden die verschiedenen Formen der vergleichenden Werbung klassifiziert?
Die Arbeit unterscheidet die Formen der vergleichenden Werbung nach verschiedenen Kriterien, wie dem Vergleichsgegenstand (direkte und indirekte Bezugnahme) und der Vergleichsaussage (kritisierend, anlehnend, persönlich, Alleinstellungs- und Spitzengruppenwerbung). Diese werden mit Beispielen erläutert.
Wie wird das Verhältnis von §6 UWG zu anderen Rechtsnormen dargestellt?
Die Arbeit beleuchtet detailliert das Verhältnis von § 6 UWG zu anderen Vorschriften des UWG (z.B. Generalklausel § 3 UWG, Herabsetzung § 4 Nr. 7 UWG) und zu anderen Normen wie dem Markengesetz und Urheberrecht.
Welche praktischen Empfehlungen werden gegeben?
Die Arbeit gibt Empfehlungen für die strategische Bedeutung vergleichender Werbung, geeignete Kommunikationsmittel und betrachtet die Perspektive sowohl des Werbenden als auch des Betroffenen, einschließlich Abwehrmaßnahmen.
- Quote paper
- Maik Dickhäuser (Author), 2009, Vergleichende Werbung - Zulässige rechtliche Grenzen und Ausmaß der Werbewirkung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/139200