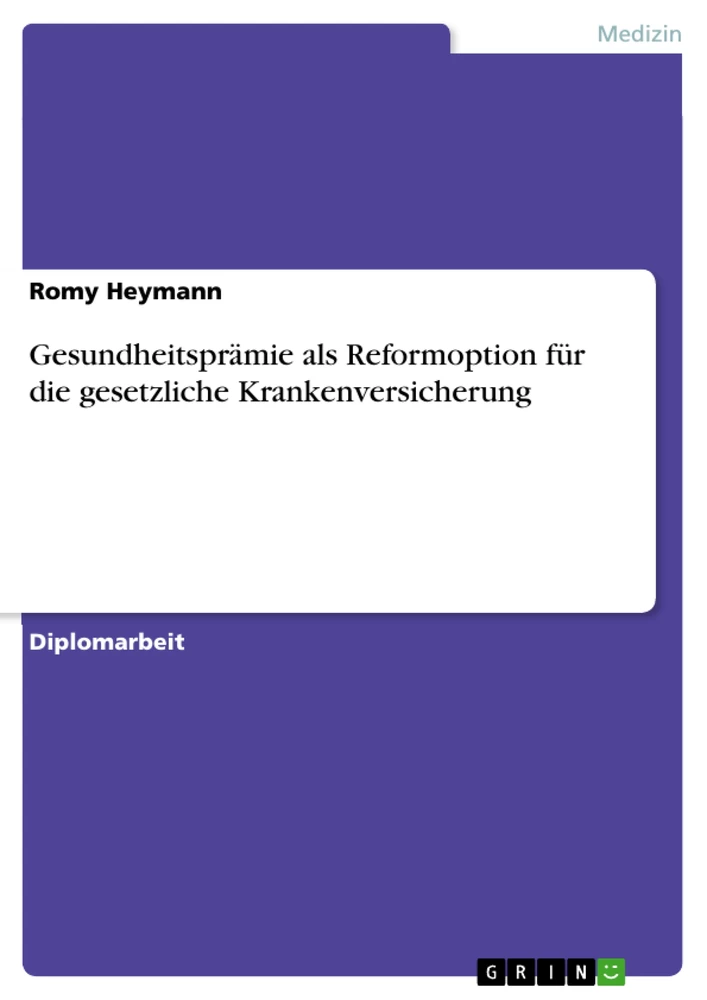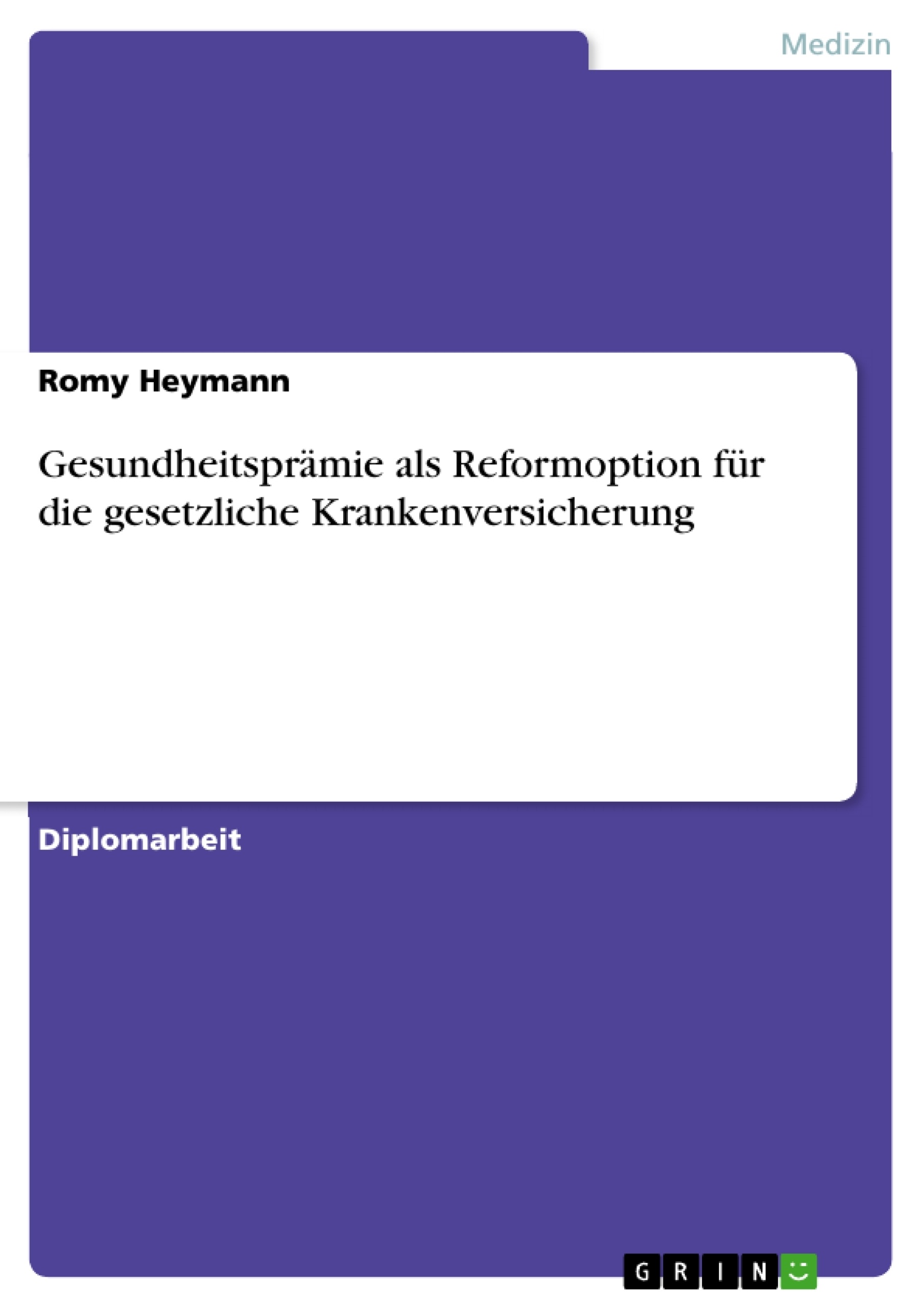Im Rahmen dieser Arbeit werden, nach einer kurzen Beschreibung der GKV und der Herausforderungen, denen sich diese gegenüber sieht, vier Reformvorschläge für eine Gesundheitsprämie vorgestellt. Der Fokus liegt dabei auf dem Modell von Rürup und Wille. Jede Reform, die neue Finanzierungsquellen zu Lasten der Versicherten erschließen soll, verändert zugleich auch die Verteilung der Beitragslast unter den und für die Versicherten. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird dann herausgestellt, welche Versichertengruppen durch eine Umstellung des Gesundheitssystems auf Gesundheitsprämien finanzielle Belastung oder Entlastung des Einkommens erfahren. Die besondere Herausforderung liegt nun darin, anhand der hier herausgearbeiteten Be- und Entlastungseffekte auf das Bruttoeinkommen der GKV-Mitglieder, eine Einschätzung darüber abzugeben, ob eine Umstellung des Gesundheitssystems eine Alternative zum derzeitigen System darstellen kann.
Inhaltsverzeichnis
ABBKÜRZUNGSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
1 PROBLEMSTELLUNG UND AUFBAU DER ARBEIT
2 STATUS QUO DER GESETZLICHEN KRANKENVERSICHERUNG
2.1 BEITRAGSPFLICHTIGE EINNAHMEN
2.2 UMVERTEILUNGSEFFEKTE
2.3 FINANZIERUNGSPROBLEME DER GKV
2.3.1 Demographische Einflussfaktoren
2.3.2 Über-, Unter- und Fehlversorgung in der GKV
3 GESUNDHEITSPRÄMIE ALS ALTERNATIVE IN DER GKV
3.1 GRUNDIDEE DER GESUNDHEITSPRÄMIE
3.2 KOPFPRÄMIENMODELL NACH RÜRUP ET AL
3.2.1 Abkopplung des GKV-Beitrags vom Arbeitsentgelt
3.2.2 Höhe der Kopfprämie
3.2.3 Steuer-Transfer-System im Kopfprämienmodell
3.2.4 Berechnung des Prämienzuschusses
3.2.5 PKV im Kopfprämiensystem
3.2.6 Veränderung des Risikostrukturausgleichs
3.2.7 Aufkommensneutralität
3.3 WEITERE MODELLE FÜR EINE GESUNDHEITSPRÄMIE
3.3.1 Modell von Knappe et al
3.3.2 Modell von Zweifel et al
3.3.3 Modell von Henke et al
4 AUSWIRKUNGEN UND ENTWICKLUNG DER KOPFPRÄMIE
4.1 BEWERTUNG DER KOPFPRÄMIENMODELLE
4.1.1 Wirkung auf den Arbeitsmarkt
4.1.2 Grenzbelastung des Faktors Arbeit
4.1.3 Steuer-Transfer- System und der Prämiensubventionsbedarf
4.1.4 Zielgenauigkeit des Umverteilungsmechanismus
4.1.5 Der Versichertenkreis
4.1.6 Risikostrukturausgleich
4.1.7 Horizontale Gerechtigkeit
4.1.8 Kapitaldeckung
4.2 BE- UND ENTLASTUNGSWIRKUNG AUF FAMILIENHAUSHALTSEBENE
4.3 BE- UND ENTLASTUNGSWIRKUNGEN EINZELNER FAMILIENTYPEN
4.3.1 Modellannahmen
4.3.2 Be- und Entlastungswirkung eines Singlehaushaltes
4.3.3 Be- und Entlastungswirkung eines Einverdiener-Ehepaares
4.3.4 Be- und Entlastungswirkung eines Zweiverdiener-Ehepaares
4.3.5 Schlussfolgerungen für die einzelnen Familientypen
4.4 PROZENTUALE BE- UND ENTLASTUNG DER BEVÖLKERUNG
4.5 ENTWICKLUNG DER KOPFPRÄMIE
4.5.1 Entwicklung der Kopfprämie in der Schweiz
4.5.2 Parallele Entwicklungen in Deutschland
5 ABSCHLIEßENDE STELLUNGNAHME
ANHANG
LITERATURVERZEICHNIS
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Durchschnittliche Krankenkassenbeiträge der GKV
Abbildung 2: Höhe der Belastung in Abhängigkeit vom Familientyp
Abbildung 3: GKV-Beiträge und Kopfprämien für Singles
Abbildung 4: Belastung des Bruttoeinkommens von Singles
Abbildung 5: GKV-Beiträge und Kopfprämien für Einverdiener- Ehepaare
Abbildung 6: Belastung des Bruttoeinkommens von Einverdiener-Ehepaaren
Abbildung 7: GKV-Beiträge und Kopfprämien für Zweiverdiener-Ehepaare
Abbildung 8: Belastung des Bruttoeinkommens von Zweiverdiener-Ehepaare
Abbildung 9: Prozentualer Anteil der Versicherten, die durch die Gesundheitsprämie be- bzw. entlastet werden
Abbildung 10: Durchschnittliche Kopfprämie in der Schweiz
1 Problemstellung und Aufbau der Arbeit
In den vergangenen Jahren wurden verschiedene Gesetzespakete zur Reform des Gesundheitswesens verabschiedet. Die unterschiedlichen Bezeichnungen dieser Gesetze, wie bspw. das Gesundheitsmodernisierungsgesetz (GMG) oder das Gesundheitsstrukturgesetz (GSG), lassen dabei zunächst nicht erkennen, dass alle Gesetze dasselbe Ziel verfolgen: einen Anstieg der Beitragssätze zu begrenzen. Oft wird dieser Anstieg vereinfacht als „Kostenexplosion im Gesundheitswesen“ bezeichnet. Die meisten der bisherigen Reformen setzten an der Ausgabenseite an und versuchten, das Ausgabenvolumen vor allem über Kürzungen im Leistungsspektrum und durch die Vergütungsgestaltung bei den Leistungserbringern zu senken. Die Einnahmenseite blieb vergleichsweise unbeachtet. Nur wenige Gesetze hatten zum Ziel die Finanzierungsbasis pro Versichertem zu verbreitern, etwa durch Ausweitung des pflichtversicherten Personenkreises mittels Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze (BBG). Mit dem weiter steigenden Finanzierungsbedarf1 wird nun verstärkt der Einnahmenseite Beachtung geschenkt.
Für die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) befinden sich derzeit besonders zwei alternative Reformkonzepte in der öffentlichen Diskussion. Auf der einen Seite wird die Bürgerversicherung als Weiterentwicklung der derzeitigen GKV in Richtung einer Erwerbstätigenversicherung für die gesamte Bevölkerung mit erhöhter Beitragsbemessungs- und Versicherungspflichtgrenze favorisiert. Bei diesem Reformvorschlag soll weiterhin an einkommensabhängigen Beiträgen festgehalten werden. Auf der anderen Seite steht das Gesundheitsprämienmodell. Die zukünftige Sicherung der Finanzierung der GKV soll hier über die Umwandlung der einkommensabhängigen Beiträge in einkommensunabhängige Prämien erfolgen. Diese Prämien sollen von allen Versicherten unabhängig von ihrer sozialen Stellung oder ihrem Einkommen gezahlt werden.
Seitdem die Diskussion um diese Reformkonzepte intensiviert wurde, folgten verschiedene Varianten zu beiden Modellen, für die Gesundheitsprämie2 bspw. das Modell der Rürup-Kommission3 oder von Henke et al.4 und für die Bürgerversicherung Sehlen et al.5 oder Lauterbach6. Aktuelle Entwicklungen zeigen, dass Bürgerversicherung kontra Gesundheitsprämie eines der entscheidenden Themen des nächsten Wahlkampfes sein wird. Bereits jetzt kristallisiert sich heraus, dass die Regierungsparteien SPD und Bündnis´90 Grüne eine deutliche Mehrheit für die Bürgerversicherung stellen,7 während die CDU für die Einführung eines Gesundheitsprämienmodells eintritt.8 Welche der beiden Reformalternativen sich durchsetzen wird, ist abhängig von der politischen Konstellation nach den Bundestagswahlen 2006.
Im Rahmen dieser Arbeit werden, nach einer kurzen Beschreibung der GKV und der Herausforderungen, denen sich diese gegenüber sieht, vier Reformvorschläge für eine Gesundheitsprämie vorgestellt. Der Fokus liegt dabei auf dem Modell von Rürup und Wille.9 Jede Reform, die neue Finanzierungsquellen zu Lasten der Versicherten erschließen soll, verändert zugleich auch die Verteilung der Beitragslast unter den und für die Versicherten. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird dann herausgestellt, welche Versichertengruppen durch eine Umstellung des Gesundheitssystems auf Gesundheitsprämien finanzielle Belastung oder Entlastung des Einkommens erfahren. Die besondere Herausforderung liegt nun darin, anhand der hier herausgearbeiteten Be- und Entlastungseffekte auf das Bruttoeinkommen der GKV-Mitglieder, eine Einschätzung darüber abzugeben, ob eine Umstellung des Gesundheitssystems eine Alternative zum derzeitigen System darstellen kann.
2 Status quo der gesetzlichen Krankenversicherung
Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die Grundprinzipien der (GKV) gegeben. Ebenso werden die Herausforderungen, denen sich diese gegenüber sieht, aufgezeigt.
2.1 Beitragspflichtige Einnahmen
Die Beiträge zur GKV sind abhängig von der Höhe der beitragspflichtigen Einnahmen der Versicherten. Die Berechnung der Beitragshöhe des einzelnen Versicherungsnehmers erfolgt durch Multiplikation seines beitragspflichtigen Einkommens mit einem von der Höhe des Einkommens abhängigen Prozentsatz und soll damit seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit entsprechen. Die beitragspflichtigen Einnahmen (§§ 226-240 SGB V) sind bei nichtselbständig Beschäftigten der Bruttoarbeitslohn, bei Rentnern deren Rente und bei Arbeitslosen 80 % des Arbeitslosengeldes. Im Jahr 2003 lag der durchschnittliche Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung bei 14,4 % pro Monat.10 Die Finanzierung der Krankenkassenbeiträge erfolgt bei Arbeitnehmern paritätisch11. So zahlen jeweils die Arbeitgeberseite und Arbeitnehmerseite den gleichen Anteil zur GKV (§ 249 SGB V). Rentner tragen gemeinsam mit der Rentenversicherung die Beiträge zu je 50 Prozent (§ 249a SGB V).
Das Bruttogehalt des Arbeitnehmers wird bis zur so genannten Beitragsbemessungsgrenze (BBG) von derzeit 3.487,50 Euro zur Berechnung der Beitragshöhe herangezogen (§ 223 SGB V). Bis zu einem Bruttolohn von 3.862,50 Euro (2004) monatlich sind alle Arbeitnehmer in der GKV grundsätzlich pflichtversichert. Diese Einkommensgrenze wird als Versicherungspflichtgrenze (VpfG) bezeichnet.12 Alle Arbeitnehmer, die über dieser Grenze liegen, können entscheiden, ob sie freiwillig in der GKV bleiben möchten oder sich privat versichern wollen.
2.2 Umverteilungseffekte
Die GKV ist ein umlagefinanziertes System. Das heißt, es findet einerseits eine Umverteilung von den Besserverdienenden zu den Geringverdienern statt; andererseits existiert durch die beitragsfreie Mitversicherung von Familienangehörigen ebenfalls eine Umverteilung von Haushalten ohne Kinder zu Haushalten mit Kindern.13 Des Weiteren kommt es durch die nicht berücksichtigten individuellen Erkrankungsrisiken zu einer Umverteilung von denjenigen Versicherten, die tatsächlich nicht erkranken zu denen, die tatsächlich erkranken. Unterschiedliche geschlechtspezifische Gesundheitsausgaben pro Kopf (bspw. durch Schwangerschaft) werden ebenso nicht betrachtet, was zu einer Umverteilung zwischen Männern und Frauen führt. Auch die durchschnittlich höheren Krankheitskosten einer Altersgruppe (im Querschnitt) und die unterschiedlich starke Besetzung der Kohorten junger und alter Versicherter bei mit dem Alter steigenden Krankheitskosten (im Längsschnitt) werden in der GKV zur Berechnung nicht herangezogen. Damit finden auch hier eine Umverteilung von Jungen zu Alten im Querschnitt und eine Umverteilung zwischen den Generationen im Längsschnitt in der GKV statt. Ein gesunder Versicherter mit niedrigem Einkommen subventioniert also die Krankenversicherung eines wohlhabenden aber gesundheitlich beeinträchtigten Versicherten mit.14 Selbiges gilt für ein Zweiverdiener-Ehepaar ohne Kinder, die Einverdiener-Ehepaare mit Kindern durch die beitragsfreie Mitversicherung der Familienangehörigen subventionieren.
Außerdem werden nicht alle Bürger in den Sozialausgleich der GKV miteinbezogen. So bleiben diejenigen außen vor, die nicht Mitglieder in der GKV sind, z.B. privat Versicherte.15 Zudem nehmen gesetzlich Versicherte, die oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze (BBG) liegen nur noch eingeschränkt an diesem Ausgleich teil, da die Umverteilung der GKV durch die BBG beschränkt.16
2.3 Finanzierungsprobleme der GKV
Die Finanzierungsprobleme der GKV werden häufig mit einem überproportionalen Kostenanstieg im Gesundheitswesen erklärt, um damit ein Ansteigen des Beitragssatzes zu rechtfertigen. Hierbei ist zu differenzieren zwischen den so genannten Prozessinnovationen, welche kostenintensive Behandlungsmethoden optimieren bzw. ersetzen und Produktinnovationen. Im Gegensatz zu den Prozessinnovationen wirken sich diese hingegen negativ auf die Gesamtausgaben der GKV aus, da sich die hohen Entwicklungs- und Herstellungskosten im Produktpreis niederschlagen und hohe Anwendungskosten entstehen können.17
In den vergangenen Jahren überwogen im deutschen Gesundheitswesen die teuren Produktinnovationen. Experten sehen in absehbarer Zeit keine Veränderung dieser Entwicklung.18 Die Behauptung, dass die Beitragssatzsteigerungen hauptsächlich auf die steigenden Kosten im Gesundheitswesen zurückzuführen sind, ist nur eingeschränkt richtig. In der Fachliteratur ist in diesem Zusammenhang häufig von einer Einnahmenschwäche der GKV die Rede. Anstatt der steigenden Kosten im Gesundheitswesen wird hier eine zunehmende Wachstumsschwäche der beitragspflichtigen Einnahmen der Versicherten als Ursache der Beitragssatzsteigerungen genannt.19 Seit der Einführung der GKV für ganz Deutschland im Jahr 1991 stiegen die Beitragssätze der Fachliteratur zufolge im Durchschnitt um 2,1 Prozentsatzpunkte, von 12,3 % auf 14,4 % (Vgl. Abbildung 1).20
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Vgl. Drabinski (2003)21 und eigene Berechnung)
Die Politik versuchte dem Ausgabenanstieg der letzten Jahre durch diverse Gesundheitsreformen entgegen zu wirken.22 Diese Bemühungen bestanden z.B. in einer Einschränkung des Leistungskataloges oder in der Einführung bzw. Erhöhung von Selbstbeteiligungen des Patienten.23 Die so erreichten Kostendämpfungsmaßnahmen führten dazu, dass die Wachstumsrate der GKV-Ausgaben seit 1975 weitestgehend mit der Steigerungsrate des Bruttoinlandprodukts (BIP24) übereinstimmte.25
Sowohl auf der Ausgabenseite, als auch auf der Einnahmenseite gibt es Einflussgrößen, die sich negativ auf die Finanzierung der GKV auswirken. In der Literatur wird kontrovers diskutiert, ob die Ursachen der Beitragssatzsteigerungen einnahmenseitiger oder ausgabenseitiger Natur sind.26 Auf die Gesundheitsausgaben wirken vor allem die angebotsinduzierte Nachfrage, der medizinisch-technische Fortschritt und der sog. negative Preisstruktureffekt27. Die wichtigsten nachfrageseitigen Einflussgrößen sind der demographische Strukturwandel, die Veränderung des Krankheitsspektrums, die veränderten Präferenzen der Patienten, dass was ihnen an Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung steht auch in Anspruch zu nehmen, sowie auf Patientenseite der Anreiz zu übermäßiger Leistungsinanspruchnahme (Moral Hazard).28
Die Höhe der Einnahmen der GKV hängen von der Höhe der beitragspflichtigen Einnahmen der Versicherten ab. Bei schlechter Konjunktur und mit steigendem Anteil der Rentner in der gesetzlichen Krankenversicherung sinken die Beiträge.29
[...]
1 Vgl. Kapitel 2.3 und 2.4.
2 Im Folgenden auch als Kopfprämie oder Kopfpauschale bezeichnet.
3 Vgl. Rürup-Kommission (2003).
4 Vgl. Henke et al. (2002).
5 Vgl. Sehlen et al. (2004).
6 Vgl. Lauterbach (2004).
7 Vgl. SPD (2004).
8 Vgl. CDU (2004).
9 Vgl. Rürup et al. (2004).
10 Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft Köln (2004), S. 75.
11 Arbeitgeberseite und Beschäftigte zahlen zu gleichen Teilen Beiträge für die GKV.
12 Vgl. BMGS (2003), S.1.
13 Vgl. im Folgenden Wasem et al. (2003a), S. 5.
14 Vgl. im Folgenden Breyer et al. (1999), S. 61 f.
15 Vgl. Zweifel et al. (2003b), S. 45.
16 Vgl. Niedlich (2002), S. 15.
17 Vgl. SVRKAG (2003), S. 85.
18 Vgl. Hof (2001), S. 29.
19 Vgl. Jacobs et al. (2003), S. 7 ff.
20 Vgl. Drabinski (2003), S. 34
21 Vgl. Anhang G, S. XII.
22 z.B. das Gesundheitsreformgesetz (GRG) 1988, das Gesundheitsstrukturgesetz (GSG) 1992, das GKV Neuordnungsgesetz 1997 oder das Gesundheitsmodernisierungsgesetz (GMG) 2004.
23 Vgl. Jacobs et al. (2003), S. 5 ff.
24 In diesem Faktor spiegelt sich der Wert aller Waren und Dienstleistungen wider, die in einem Jahr im Inland produziert werden, einschließlich der Einkommen, die vom Inland an Menschen im Ausland gezahlt werden. Durch die Verwendung dieses Faktors werden alle gesamtwirtschaftlichen Faktoren mitberücksichtigt. Der Vergleich des BIP über mehrere Jahre ergibt das Wirtschaftswachstum.
25 Vgl. SVRKAG (2003), S. 82.
26 Vgl. Wasem et al. (2003b), S. 13.
27 Vom negativen Preisstruktureffekt (PSE) ist besonders der Dienstleistungsbereich betroffen. In dieser Branche kann Arbeit nicht so leicht durch Kapital substituiert werden. Der Begriff beschreibt einen überdurchschnittlichen Preisanstieg. Aufgrund fehlender Automatisierungs-möglichkeiten steigt die Arbeitsproduktivität nicht entsprechend der durchschnittlichen Lohnentwicklung. Folglich steigen die Preise arbeitsintensiver Branchen stärker als in der gesamten Wirtschaft.
28 Vgl. SVRKAG (2003a), S. 22.
29 Vgl. Jacobs et al. (2003), S. 7 ff.
- Quote paper
- Dipl. Kffr. Romy Heymann (Author), 2005, Gesundheitsprämie als Reformoption für die gesetzliche Krankenversicherung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/138932