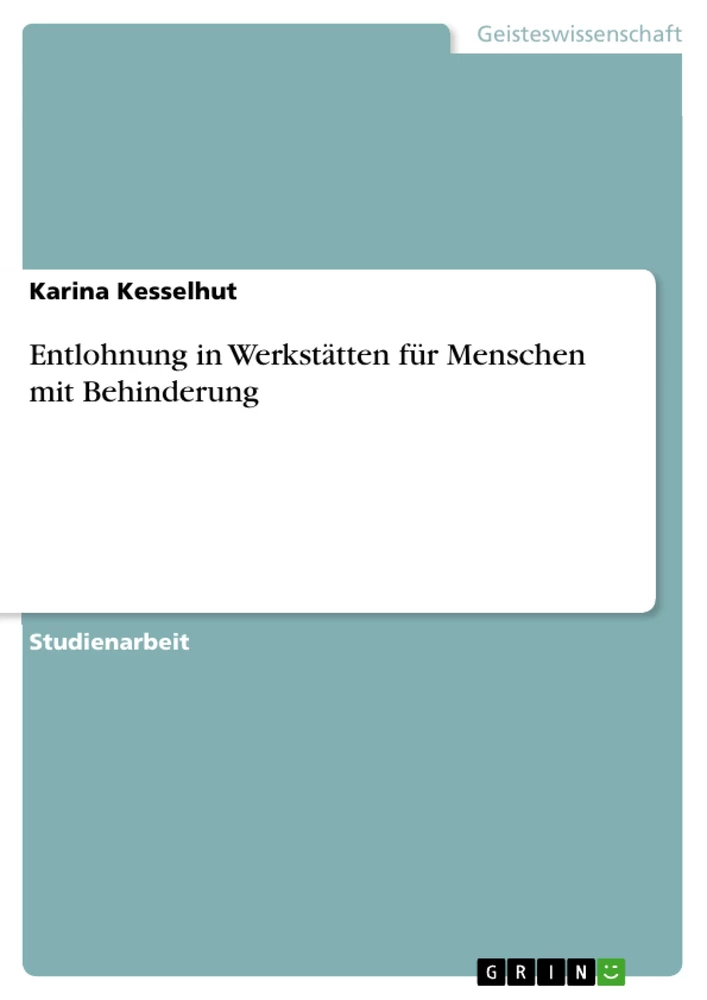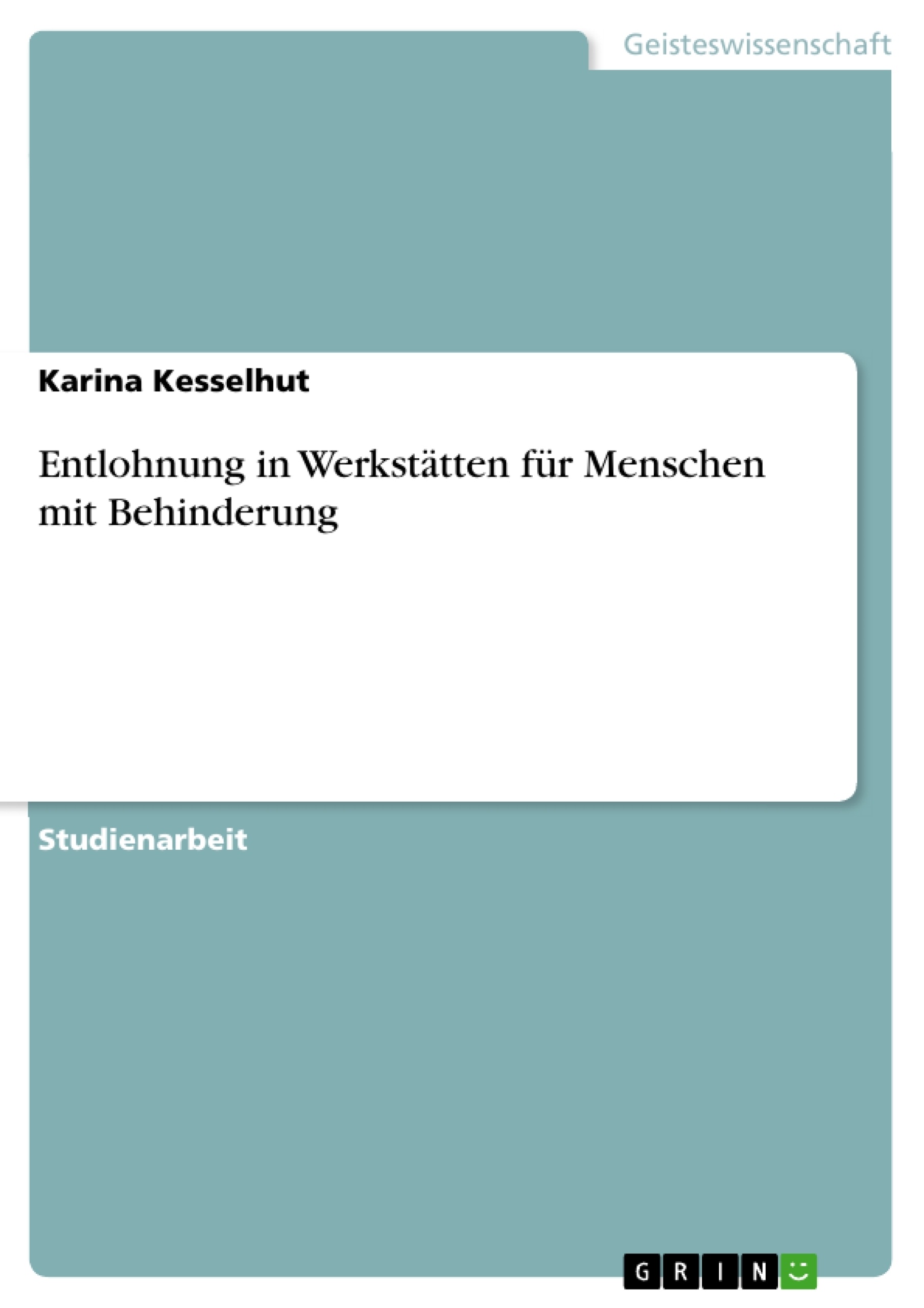Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Entlohnung von Menschen mit Behinderung in Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Die Forschungsfrage lautet: Warum steht Menschen mit Behinderung der Mindestlohn nicht zu. Dies wird in dieser Hausarbeit thematisiert und untersucht. Die Arbeit erkundet die Definition von Behinderung, die UN-Behindertenrechtskonvention und ihre Entstehung, speziell Artikel 27 über Arbeit. Sie untersucht auch das Bundesteilhabegesetz, die WfbM in Nordrhein-Westfalen, einschließlich Zugang, Rechtsstatus, Bezahlung und zukünftige Aussichten.
Deutsche Unternehmen sind aufgrund einer Beschäftigungsquote verpflichtet, 5% der Arbeitsplätze mit Menschen mit Behinderung zu besetzen. Dies gilt für Unternehmen ab 20 Mitarbeitenden. Erfüllen die Unternehmen diese Quote nicht, zahlen diese monatliche Abgabepauschalen an die Integrationsämter in Höhe von 125 bis 320 Euro pro unbesetzter Stelle oder sie geben Aufträge an die WfbM, sodass nur 50% der Ausgleichsabgabe gezahlt werden muss. Auf wirtschaftlicher Ebene ist die Vergabe von Verträgen an die WfbM für die Unternehmen ein lukratives Geschäft, die im Verlauf dieser Hausarbeit näher erläutert werden. Was für die Wirtschaft ein lukratives Geschäft ist, sieht für die beschäftigte Person in einer WfbM anders aus: umgerechnet erhält diese einen Stundenlohn von ca. einem Euro. Einen Lohn, von dem ein Mensch mit oder ohne Behinderung nicht leben kann und somit auf existenzsichernde Leistungen des Staates angewiesen ist. Ausgehend von einem Stundenlohn von einem Euro darf eine Einzelperson in Deutschland nicht in einem Arbeitsverhältnis arbeiten, da der Staat einen Mindestlohn festgelegt hat. Es gibt für diese Regelung Ausnahmen: Auszubildende, Praktikanten oder Selbstständige erhalten keinen gesetzlichen Mindestlohn, die WfbM fällt nicht unter diese Ausnahmen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition Mensch mit Behinderung
- 3. UN-Behindertenrechtskonvention
- 3.1. Entstehung der UN-Behindertenrechtskonvention
- 3.2. Artikel 27 der UN-Behindertenrechtskonvention (Arbeit und Beschäftigung)
- 3.3. Bundesteilhabegesetz und Finanzierung des Lebensunterhaltes
- 4. Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM) in Nordrhein-Westfalen
- 4.1. Definition und Zugangsvoraussetzungen WfbM
- 4.2. Rechtsstatus und Bezahlung der Klientel
- 4.3. Tripelmandat der WfbM
- 4.4. Zukunftsaussichten der WfbM nach UN-BRK
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Angemessenheit der Entlohnung von Menschen mit Behinderung in Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM) in Deutschland. Sie analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere die UN-Behindertenrechtskonvention und das Bundesteilhabegesetz, und setzt diese in Bezug zu den tatsächlichen Arbeitsbedingungen und der Bezahlung in WfbM.
- Angemessenheit der Entlohnung von Menschen mit Behinderung in WfbM
- Rechtliche Grundlagen der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung (UN-BRK, Bundesteilhabegesetz)
- Arbeitsbedingungen und Bezahlung in WfbM in Nordrhein-Westfalen
- Das Tripelmandat der WfbM und seine Auswirkungen auf die Beschäftigten
- Zukunftsperspektiven für Menschen mit Behinderung im Kontext der UN-BRK
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der unzureichenden Entlohnung von Menschen mit Behinderung in Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM) ein. Sie verdeutlicht den Widerspruch zwischen dem Anspruch auf angemessene Arbeit und der Realität eines Stundenlohns von circa einem Euro, der existenzsichernde staatliche Leistungen notwendig macht. Die Einleitung hebt die Diskrepanz zwischen dem wirtschaftlichen Nutzen der WfbM für Unternehmen und den prekären Arbeitsbedingungen der Beschäftigten hervor und formuliert die zentrale Forschungsfrage der Arbeit.
2. Definition Mensch mit Behinderung: Dieses Kapitel befasst sich mit der komplexen Definition von Behinderung. Es vergleicht den sozialrechtlichen Begriff aus dem SGB IX mit dem Verständnis der UN-BRK. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen Perspektiven und den damit verbundenen Herausforderungen für eine inklusive Teilhabe am Arbeitsleben. Die Kritik an der Umsetzung der Teilhabeorientierung im SGB IX wird diskutiert, um die Lücke zwischen Gesetzgebung und Praxis zu beleuchten.
3. UN-Behindertenrechtskonvention: Das Kapitel beschreibt die Entstehung und die zentralen Inhalte der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). Besonders Artikel 27, der sich mit Arbeit und Beschäftigung befasst, wird im Detail betrachtet. Der Abschnitt beleuchtet den Einfluss der UN-BRK auf die rechtlichen Rahmenbedingungen der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung und den damit verbundenen Anspruch auf angemessene Entlohnung. Die Diskussion fokussiert auf den Paradigmenwechsel von einem Defizit- zu einem Teilhabemodell.
4. Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM) in Nordrhein-Westfalen: Dieses Kapitel analysiert die Struktur und den rechtlichen Status von WfbM in Nordrhein-Westfalen. Es untersucht die Zugangsvoraussetzungen, den Rechtsstatus der Beschäftigten und die oft unzureichende Bezahlung. Das Tripelmandat der WfbM (Arbeit, Bildung, Therapie) wird kritisch beleuchtet im Hinblick auf seine Auswirkungen auf die Beschäftigten und die Vereinbarkeit von Arbeit und angemessener Entlohnung. Der Ausblick auf die zukünftige Rolle der WfbM im Lichte der UN-BRK wird gegeben.
Schlüsselwörter
Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM), UN-Behindertenrechtskonvention, Bundesteilhabegesetz, angemessene Entlohnung, inklusive Teilhabe, Arbeit und Beschäftigung, Menschen mit Behinderung, Rechtsstatus, Tripelmandat, Nordrhein-Westfalen, Sozialgesetzbuch (SGB IX).
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit "Angemessenheit der Entlohnung von Menschen mit Behinderung in WfbM"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Angemessenheit der Entlohnung von Menschen mit Behinderung in Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM) in Deutschland. Sie analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen (UN-Behindertenrechtskonvention, Bundesteilhabegesetz) und deren Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen und Bezahlung in WfbM.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Angemessenheit der Entlohnung in WfbM, rechtliche Grundlagen der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung (UN-BRK, Bundesteilhabegesetz), Arbeitsbedingungen und Bezahlung in WfbM in Nordrhein-Westfalen, das Tripelmandat der WfbM und dessen Auswirkungen, sowie Zukunftsperspektiven für Menschen mit Behinderung im Kontext der UN-BRK.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Definition „Mensch mit Behinderung“, UN-Behindertenrechtskonvention, Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM) in Nordrhein-Westfalen und Fazit. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Thematik, beginnend mit einer Einführung und endend mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse und Zukunftsaussichten.
Wie wird die Definition von Behinderung behandelt?
Das Kapitel „Definition Mensch mit Behinderung“ vergleicht den sozialrechtlichen Begriff aus dem SGB IX mit dem Verständnis der UN-BRK. Es beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven und Herausforderungen für inklusive Teilhabe am Arbeitsleben und kritisiert die Umsetzung der Teilhabeorientierung im SGB IX.
Welche Rolle spielt die UN-Behindertenrechtskonvention?
Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) spielt eine zentrale Rolle. Das Kapitel beschreibt Entstehung und Inhalte, insbesondere Artikel 27 (Arbeit und Beschäftigung). Es analysiert den Einfluss der UN-BRK auf die rechtlichen Rahmenbedingungen und den Anspruch auf angemessene Entlohnung, mit Fokus auf den Paradigmenwechsel von einem Defizit- zu einem Teilhabemodell.
Was wird über Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM) in Nordrhein-Westfalen gesagt?
Das Kapitel zu WfbM in Nordrhein-Westfalen analysiert die Struktur und den rechtlichen Status, Zugangsvoraussetzungen, den Rechtsstatus der Beschäftigten, die Bezahlung und das Tripelmandat (Arbeit, Bildung, Therapie). Es beleuchtet kritisch die Auswirkungen des Tripelmandats auf die Beschäftigten und die Vereinbarkeit von Arbeit und angemessener Entlohnung, sowie die Zukunftsaussichten im Lichte der UN-BRK.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM), UN-Behindertenrechtskonvention, Bundesteilhabegesetz, angemessene Entlohnung, inklusive Teilhabe, Arbeit und Beschäftigung, Menschen mit Behinderung, Rechtsstatus, Tripelmandat, Nordrhein-Westfalen, Sozialgesetzbuch (SGB IX).
Welche zentrale Forschungsfrage wird in der Arbeit gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage der Arbeit ist implizit in der Einleitung formuliert und befasst sich mit dem Widerspruch zwischen dem Anspruch auf angemessene Arbeit und der Realität der oft unzureichenden Entlohnung von Menschen mit Behinderung in WfbM, insbesondere im Kontext der UN-BRK und des Bundesteilhabegesetzes.
- Arbeit zitieren
- Karina Kesselhut (Autor:in), 2021, Entlohnung in Werkstätten für Menschen mit Behinderung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1389041