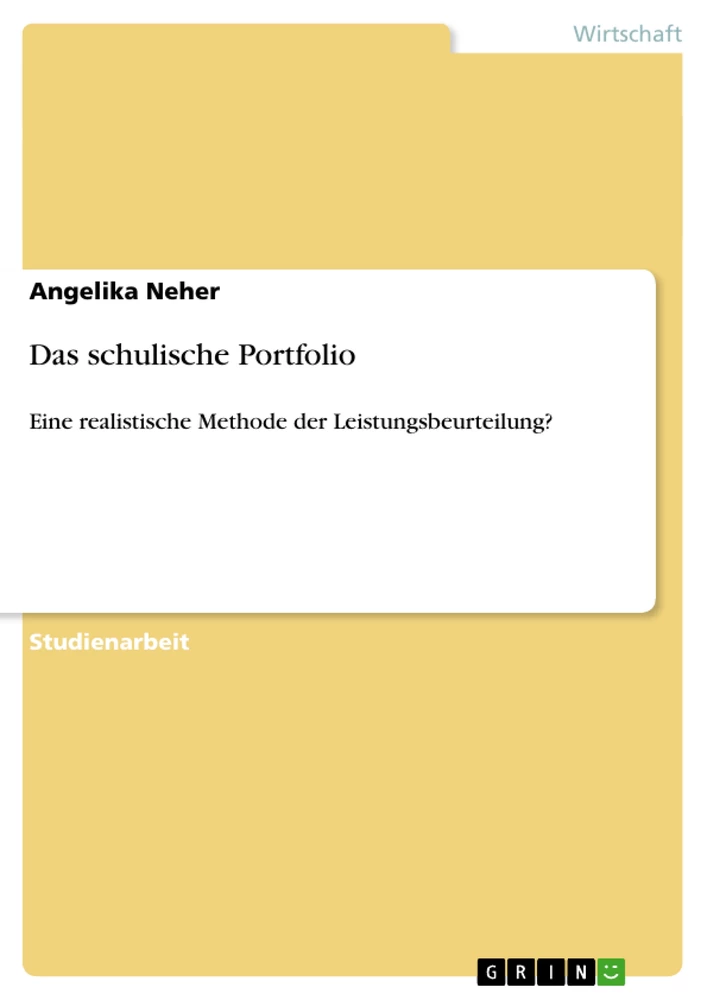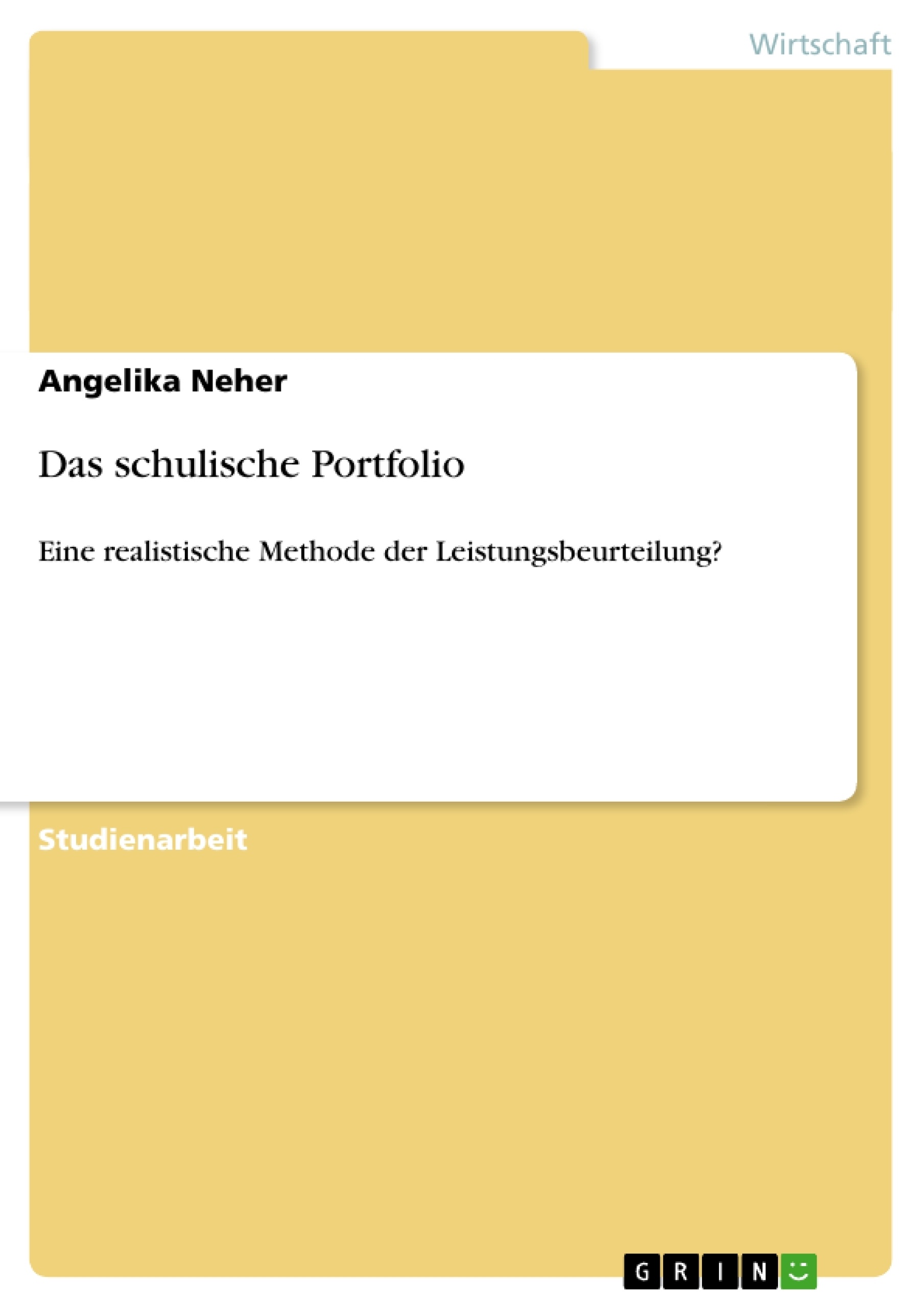„Schlüsselqualifikationen“, „Leistungsgesellschaft“, „PISA-Schock“ (u. a. TOPSCH 2002, 134; KLAFKI 1976, 152). Das alles sind Begriffe, die in unserer heutigen Gesellschaft immer wieder reges Aufsehen erzeugen, gerade dieses Jahr im sogenannten „Superwahljahr 2009“. Viele Politiker machen das Thema „Bildung“ zu einem zentralen Thema, um um die Gunst ihrer Wähler zu werben. Nähern wir uns diesem Thema „Bildung“ einmal näher, kommen wir um die schulische Ausbildung nicht herum. Doch wie sieht es innerhalb dieses Kreises aus? Wenn man einige Schüler befragt, warum sie in die Schule gehen, wird nicht selten die Antworten lauten: „Um gute Noten zu bekommen“ (WINTER 2005a, 69). Die Ziffernbeurteiligung regiert in Deutschland immer noch in sehr weiten Teilen als Leistungsbewertungsinstrument an deutschen Bildungseinrichtungen. Angesichts eines bekannten abgewandelten Zitats Winston Churchills über die Demokratie, das lautet, „die Beurteilung mit Noten sei zwar die (wissenschaftlich nachgewiesener Maßen) denkbar schlechteste aller Beurteilungsformen, es gäbe aber keine bessere“ (ANDEXER / THONHAUSER 2002, 156), sei dies jedoch mehr als kritisch zu hinterfragen. Die Leistungsbeurteilung mittels Noten ist zweifelsohne einfach und leicht nachvollziehbar, doch wie u. a. WEIß und INGENKAMP in ihren zahlreichen Forschungsversuchen bereits 1965 bzw. 1967 belegte, erfüllt die Ziffernbeurteiligung keines der Gütekriterien (Objektivität, Reliabilität und Validität). Warum hat sich in dieser doch enormen Zeitspanne von über 40 Jahren dennoch nichts geändert? Gibt es eine realistische Alternative zur tradierten Leistungsbeurteilung, die die negativen Seiten der Notenzensur aufheben könnte? Auffallend ist, dass in Deutschland zurzeit ein Umstellungsprozess im Gange ist, weg vom instruktionistischen hin zum konstruktivistischen Unterrichtsmethoden (REINMANN / MANDL 2006, 616). Das Portfoliokonzept, das sich seit geraumer Zeit als „neues“ Modewort entpuppt, orientiert sich weitgehend an dieser Lernpsychologie, indem es versucht das „Lernen zu lernen“ (HÄCKER, 17; In: BRUNNER et. al. 2008). Darüberhinaus verspricht die Portfoliomethode weitere Vorzüge zu enthalten, u. a. auch die Verbesserung der viel gefragten Schlüsselqualifikationen wie Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz. Doch kann dieses Konzept auch den „angestrebten Paradigmenwechsel im Prüfungswesen“ (KOCH, 208; In: BRUNNER et. al. 2008) durchführen?
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Theoretische Grundlagen
- Definition und geschichtlicher Hintergrund
- Komponenten der Portfolioarbeit
- Portfolioarten
- Das E-Portfolio als eine spezielle Form des Portfolios
- Portfolioarbeit im Unterricht: Von der Theorie zur Praxis
- Theoretische Realisierungsmöglichkeiten nach INGLIN
- Realisierungsmöglichkeiten in der Schule
- Realisierungsmöglichkeiten in der Lehrerbildung
- Leistungsbeurteilung durch Portfolios
- Spannungsverhältnis: Portfolio vs. Beurteilung
- Möglichkeiten der Leistungsbeurteilung von Portfolios
- Vorgehensweise beim Bewertungsprozess
- Entwickeln und Anwenden von Kriterien
- Mögliche Bewertungsformen
- Messen von Portfolios
- Messqualität und Gütekriterien von Portfolios
- Empirische Befunde zum Status Quo der Portfolioforschung
- Diskussion und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Eignung des Portfolios als alternative Methode der Leistungsbeurteilung im schulischen Kontext. Sie beleuchtet die theoretischen Grundlagen des Portfolioansatzes, seine praktische Umsetzung im Unterricht und die Herausforderungen bei der Leistungsbewertung anhand von Portfolios. Die Arbeit analysiert die Stärken und Schwächen des Portfolio-Konzepts im Vergleich zur traditionellen Notenvergabe.
- Definition und geschichtlicher Hintergrund des Portfolio-Konzepts
- Komponenten und Arten von Portfolios (inkl. E-Portfolio)
- Praktische Umsetzung der Portfolioarbeit im Unterricht
- Methoden der Leistungsbeurteilung mittels Portfolios
- Gütekriterien und empirische Befunde zur Portfolio-Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Problemstellung: Die Arbeit beginnt mit einer kritischen Auseinandersetzung mit der traditionellen Notenvergabe als dominierendes Leistungsbewertungsinstrument im deutschen Schulsystem. Sie hinterfragt die Gültigkeit der Noten aufgrund bekannter Schwächen hinsichtlich Objektivität, Reliabilität und Validität und stellt die Frage nach einer adäquaten Alternative. Der aktuelle Trend hin zu konstruktivistischen Unterrichtsmethoden und die zunehmende Bedeutung von Schlüsselqualifikationen bilden den Kontext für die Einführung des Portfolio-Konzepts als potenzielle Lösung. Die Arbeit skizziert die Forschungsfrage, ob der Portfolioansatz einen Paradigmenwechsel im Prüfungswesen ermöglichen kann.
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Einführung in den Portfolio-Begriff. Es präsentiert verschiedene Definitionen aus der Literatur und analysiert die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Konzepte. Die Kapitel erläutert die Unterscheidung zwischen enger und weiter Fassung von Portfolioarbeit und beleuchtet den geschichtlichen Hintergrund des Begriffs, angefangen von seiner Verwendung in der Renaissance bis hin zur aktuellen Anwendung im Bildungsbereich. Die Entwicklung des Portfolio-Konzepts im angloamerikanischen und deutschsprachigen Raum wird ebenfalls behandelt.
2.2 Komponenten der Portfolioarbeit: Der Abschnitt beschreibt detailliert die sechs Phasen der Portfolioarbeit nach Häcker, Brouër und Wiedenhorn (Kontextdefinition, Sammlung, Auswahl, Reflexion, Projektion, Präsentation). Jede Phase wird im Detail erklärt, und es wird auf die Bedeutung der Schülerbeteiligung, der Transparenz und der Berücksichtigung emotionaler Aspekte hingewiesen. Die Wichtigkeit der schriftlichen Begründung der Schülerauswahl in der Selektionsphase wird hervorgehoben, ebenso wie das „Mehrwert-Prinzip“ als Hilfestellung für die Schüler.
Schlüsselwörter
Portfolio, Leistungsbeurteilung, Notenkritik, Konstruktivismus, Schlüsselqualifikationen, E-Portfolio, Gütekriterien, empirische Forschung, Alternativmethode, Selbstreflexion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema Portfolioarbeit
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Eignung von Portfolios als alternative Methode zur Leistungsbeurteilung im schulischen Kontext. Sie beleuchtet die theoretischen Grundlagen, die praktische Umsetzung im Unterricht und die Herausforderungen bei der Bewertung von Portfolios. Im Vergleich zur traditionellen Notenvergabe werden Stärken und Schwächen des Portfolio-Konzepts analysiert.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Themen: Definition und geschichtlicher Hintergrund des Portfolio-Konzepts, Komponenten und Arten von Portfolios (inkl. E-Portfolio), praktische Umsetzung der Portfolioarbeit im Unterricht, Methoden der Leistungsbeurteilung mittels Portfolios, Gütekriterien und empirische Befunde zur Portfolio-Forschung. Die Arbeit beginnt mit einer Kritik an der traditionellen Notenvergabe und untersucht, ob der Portfolioansatz einen Paradigmenwechsel im Prüfungswesen ermöglichen kann.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit bietet eine umfassende Einführung in den Portfolio-Begriff, präsentiert verschiedene Definitionen aus der Literatur und analysiert die Gemeinsamkeiten verschiedener Konzepte. Sie erläutert die Unterscheidung zwischen enger und weiter Fassung von Portfolioarbeit und beleuchtet den geschichtlichen Hintergrund des Begriffs. Die Entwicklung des Portfolio-Konzepts im angloamerikanischen und deutschsprachigen Raum wird ebenfalls behandelt. Der Abschnitt zu den Komponenten der Portfolioarbeit beschreibt detailliert die sechs Phasen der Portfolioarbeit nach Häcker, Brouër und Wiedenhorn (Kontextdefinition, Sammlung, Auswahl, Reflexion, Projektion, Präsentation).
Wie wird die Leistungsbeurteilung mittels Portfolios behandelt?
Die Arbeit analysiert das Spannungsverhältnis zwischen Portfolio und Beurteilung und beleuchtet Möglichkeiten der Leistungsbeurteilung von Portfolios. Sie beschreibt die Vorgehensweise beim Bewertungsprozess, das Entwickeln und Anwenden von Kriterien sowie mögliche Bewertungsformen. Die Messqualität und Gütekriterien von Portfolios werden ebenfalls untersucht.
Welche empirischen Befunde werden berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht sich auf empirische Befunde zum aktuellen Stand der Portfolioforschung, um die Erkenntnisse zu untermauern und den Praxisbezug herzustellen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Portfolio, Leistungsbeurteilung, Notenkritik, Konstruktivismus, Schlüsselqualifikationen, E-Portfolio, Gütekriterien, empirische Forschung, Alternativmethode, Selbstreflexion.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, die sich mit der Problemstellung, den theoretischen Grundlagen, der praktischen Umsetzung der Portfolioarbeit im Unterricht, der Leistungsbeurteilung durch Portfolios, der Messqualität und Gütekriterien, empirischen Befunden und abschließend mit Diskussion und Ausblick befassen. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
- Quote paper
- Angelika Neher (Author), 2009, Das schulische Portfolio, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/138284