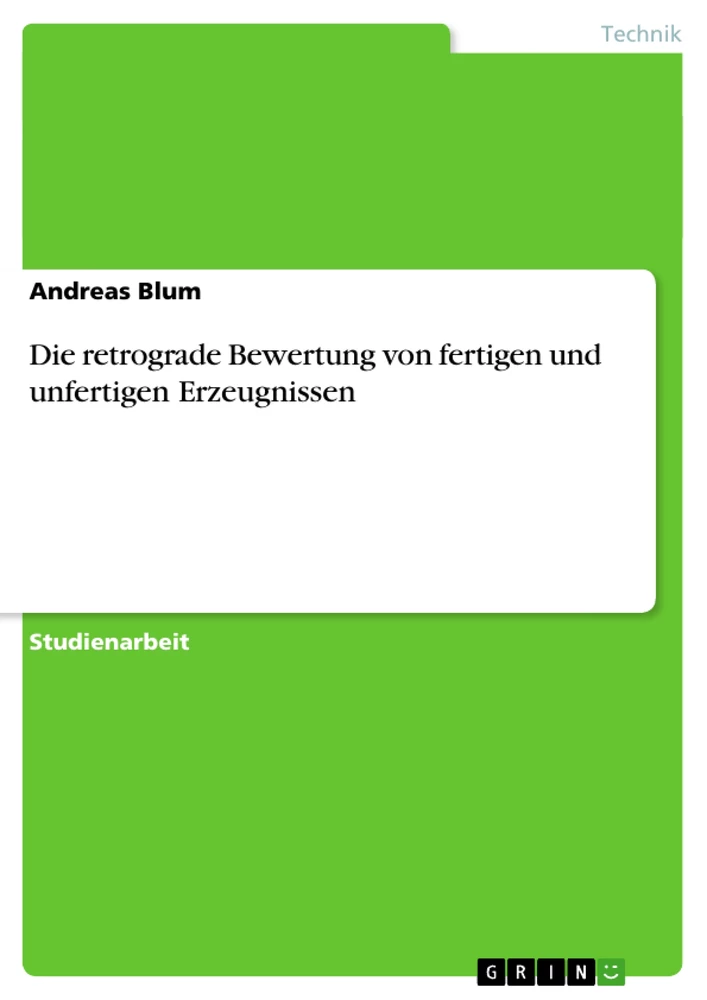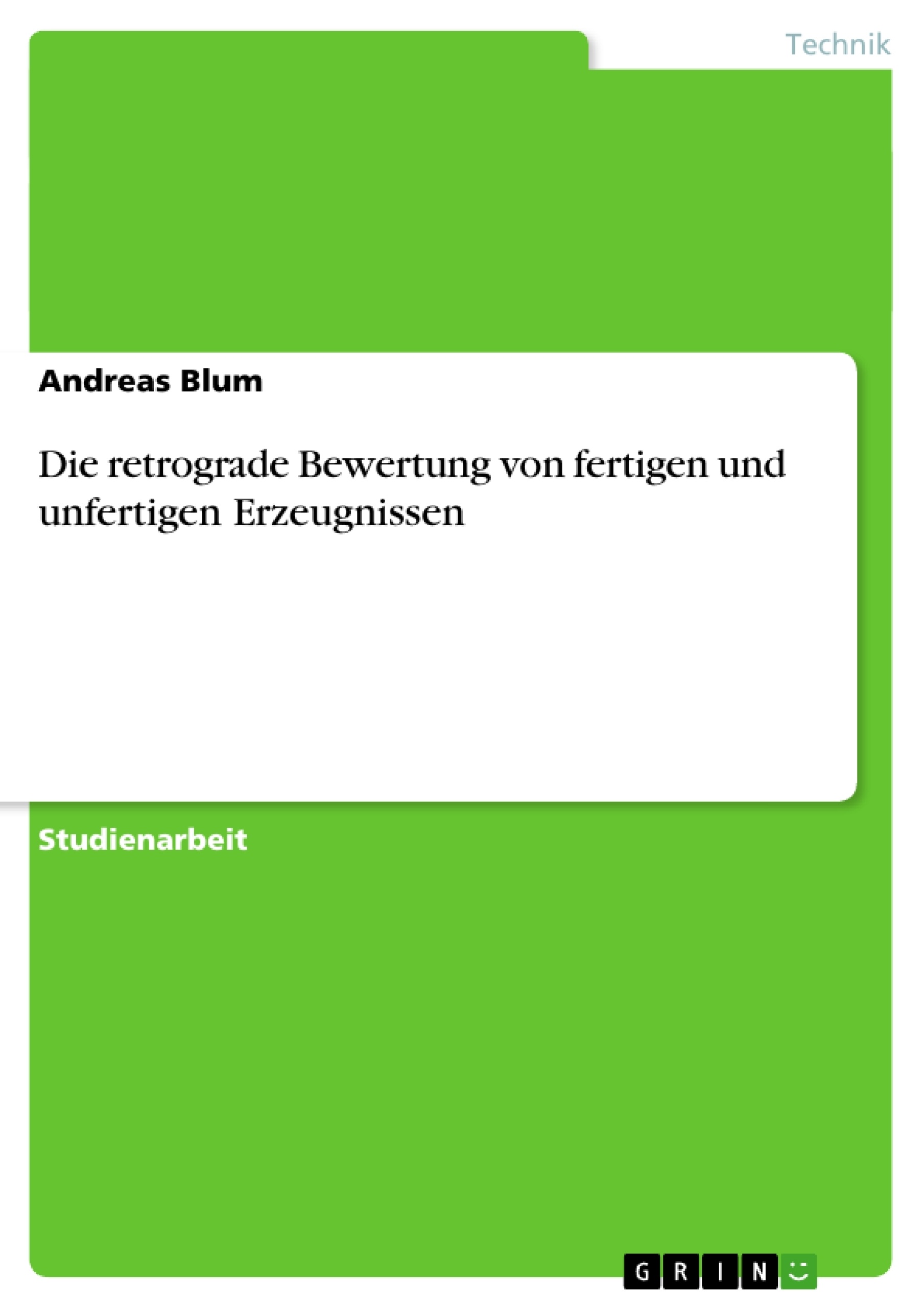Eine Vielzahl von Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass aus unterschiedlichsten Inputgrößen über einen Produktionsprozess, das heißt durch Kombination und Umwandlung von Gütern, Outputs hergestellt werden. Während eines solchen Vorgangs kann es zur Lagerung von Produkten kommen. Die Lagerung betrifft gegebenenfalls den gesamten Produktionsprozess, das heißt auch unfertige und fertige Erzeugnisse. Spätestens beim Aufstellen des Jahresabschlusses stellt sich die Frage, ob und wenn ja in welchem Umfang unfertige und fertige Erzeugnisse bewertet werden dürfen, sollen oder müssen. Hierbei müssen die nach dem Handelsrecht zulässigen Bewertungsvorschriften und -methoden eingehalten bzw. angewendet werden. Eine dieser Methoden ist die so genannte retrograde Bewertung. So steht zum Beispiel im Geschäftsbericht 2001/02 der ThyssenKrupp AG, dass die Ermittlung der Bewertungsansätze für fertige und unfertige Erzeugnisse durch den retrograd vom Absatzmarkt ermittelten Nettoveräußerungserlöse erfolgt. Doch worum handelt es sich bei der retrograden Bewertung genau? Warum und in welcher Form wird diese Bewertungsmethode angewendet? Und welche Schwierigkeiten können im Zuge einer solchen Bewertung auftauchen?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Einführung in die Problemstellung
- 1.2 Ziel der Arbeit
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2. Die Bewertung von fertigen und unfertigen Erzeugnissen
- 2.1 Definitionen
- 2.2 Allgemeine Bewertungsgrundsätze
- 2.3 Anschaffungs- und Herstellungskosten
- 2.4 Niederstwertprinzip
- 3. Retrograde Bewertung
- 3.1 Allgemeine Beschreibung
- 3.2 Beispiel
- 3.3 Probleme
- 4. Zusammenfassung und kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit zielt darauf ab, die retrograde Bewertungsmethode im Kontext der Bewertung von fertigen und unfertigen Erzeugnissen verständlich darzustellen und die damit verbundenen Schwierigkeiten zu beleuchten. Sie schlägt eine Brücke zwischen theoretischen Grundlagen und praktischen Anwendungsfragen im Rahmen des Handelsgesetzbuchs (HGB).
- Definition und Abgrenzung von fertigen und unfertigen Erzeugnissen
- Allgemeine Bewertungsgrundsätze nach HGB
- Anschaffungs- und Herstellungskosten als Bewertungsmaßstab
- Das Niederstwertprinzip und seine Anwendung
- Die retrograde Bewertungsmethode: Beschreibung, Anwendung und Probleme
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Problematik der Bewertung von fertigen und unfertigen Erzeugnissen ein. Sie hebt die Notwendigkeit einer korrekten Bewertung im Jahresabschluss hervor und benennt die retrograde Bewertung als eine relevante Methode. Das Ziel der Arbeit wird klar definiert: eine verständliche Darstellung der retrograden Bewertung, inklusive ihrer Schwierigkeiten, unter Berücksichtigung des HGB. Der Aufbau der Arbeit wird skizziert und die Grenzen des behandelten Umfangs (Ausschluss steuerlicher und internationaler Aspekte) werden definiert.
2. Die Bewertung von fertigen und unfertigen Erzeugnissen: Dieses Kapitel legt die Grundlagen für das Verständnis der retrograden Bewertung. Es beginnt mit präzisen Definitionen von fertigen und unfertigen Erzeugnissen im bilanziellen Kontext. Anschließend werden die allgemeinen Bewertungsgrundsätze nach § 252 HGB detailliert erläutert, einschließlich des Prinzips der Bilanzidentität, des Going-Concern-Prinzips, der Einzelbewertung, des Vorsichtsprinzips, der Periodenabgrenzung und der Bewertungsstetigkeit. Schließlich werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten als Bewertungsmaßstäbe für Vermögensgegenstände eingeführt und das Niederstwertprinzip als relevant für die Bewertung am Bilanzstichtag erläutert. Dieses Kapitel dient als solide Basis für die anschließende Auseinandersetzung mit der retrograden Bewertung.
3. Retrograde Bewertung: Dieses Kapitel widmet sich der zentralen Methode der Arbeit: der retrograden Bewertung. Es beinhaltet zunächst eine detaillierte allgemeine Beschreibung des Verfahrens, inklusive seiner Anwendungsmöglichkeiten. Ein anschauliches Beispiel verdeutlicht den praktischen Ablauf. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf der Analyse möglicher Schwierigkeiten und Probleme, die bei der Anwendung der retrograden Bewertung auftreten können. Die Herausforderungen der Methode werden eingehend diskutiert, um ein umfassendes Verständnis ihrer Anwendungsgrenzen zu ermöglichen.
Schlüsselwörter
Retrograde Bewertung, fertige Erzeugnisse, unfertige Erzeugnisse, Jahresabschluss, Bewertungsgrundsätze, HGB, Anschaffungs- und Herstellungskosten, Niederstwertprinzip, Bilanzierung, Umlaufvermögen.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Retrograde Bewertung von Fertigen und Unfertigen Erzeugnissen
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit behandelt die retrograde Bewertungsmethode im Kontext der Bewertung von fertigen und unfertigen Erzeugnissen im Jahresabschluss. Sie erklärt die Methode, ihre Anwendung und die damit verbundenen Schwierigkeiten, unter Berücksichtigung des Handelsgesetzbuchs (HGB).
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst die Definition und Abgrenzung von fertigen und unfertigen Erzeugnissen, die allgemeinen Bewertungsgrundsätze nach HGB (inkl. Niederstwertprinzip, Anschaffungs- und Herstellungskosten), sowie eine detaillierte Beschreibung, Anwendung und kritische Auseinandersetzung mit der retrograden Bewertungsmethode. Steuerliche und internationale Aspekte werden explizit ausgeschlossen.
Wie ist die Seminararbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur allgemeinen Bewertung von Erzeugnissen, ein Kapitel zur retrograden Bewertung und eine Zusammenfassung/kritische Würdigung. Die Einleitung beschreibt die Problemstellung, die Ziele und den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 legt die Grundlagen der Bewertung nach HGB dar. Kapitel 3 konzentriert sich auf die retrograde Bewertung, inklusive eines Beispiels und einer Diskussion der Herausforderungen. Das abschließende Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen und wertet diese kritisch.
Welche Bewertungsgrundsätze nach HGB werden behandelt?
Die Arbeit erläutert detailliert die allgemeinen Bewertungsgrundsätze nach § 252 HGB, einschließlich des Prinzips der Bilanzidentität, des Going-Concern-Prinzips, der Einzelbewertung, des Vorsichtsprinzips, der Periodenabgrenzung und der Bewertungsstetigkeit. Das Niederstwertprinzip und die Berücksichtigung von Anschaffungs- und Herstellungskosten werden ebenfalls ausführlich behandelt.
Was ist die retrograde Bewertung und welche Probleme können auftreten?
Die retrograde Bewertung ist eine Methode zur Bewertung von unfertigen Erzeugnissen. Die Arbeit beschreibt das Verfahren detailliert und beleuchtet die Schwierigkeiten und Probleme, die bei der Anwendung auftreten können. Diese Probleme werden eingehend diskutiert, um ein umfassendes Verständnis der Anwendungsgrenzen zu ermöglichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Retrograde Bewertung, fertige Erzeugnisse, unfertige Erzeugnisse, Jahresabschluss, Bewertungsgrundsätze, HGB, Anschaffungs- und Herstellungskosten, Niederstwertprinzip, Bilanzierung, Umlaufvermögen.
Für wen ist diese Seminararbeit relevant?
Diese Arbeit richtet sich an Personen, die sich mit der Bewertung von Fertigerzeugnissen und unfertigen Erzeugnissen im Kontext des Jahresabschlusses nach HGB auseinandersetzen, insbesondere Studenten der Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsprüfung.
- Quote paper
- Andreas Blum (Author), 2007, Die retrograde Bewertung von fertigen und unfertigen Erzeugnissen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/137868