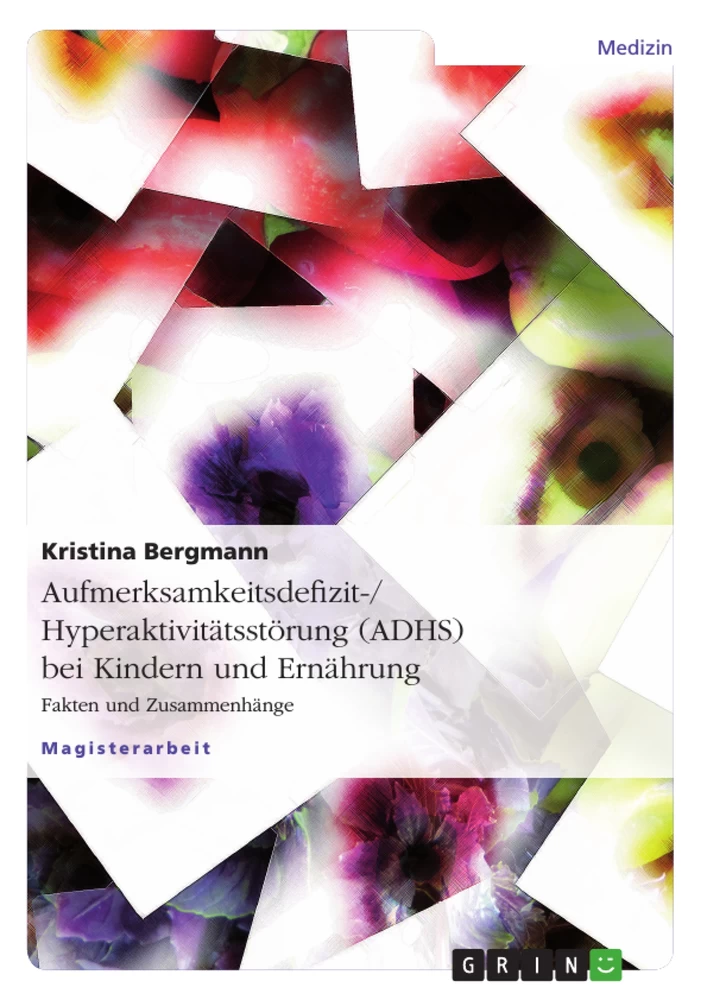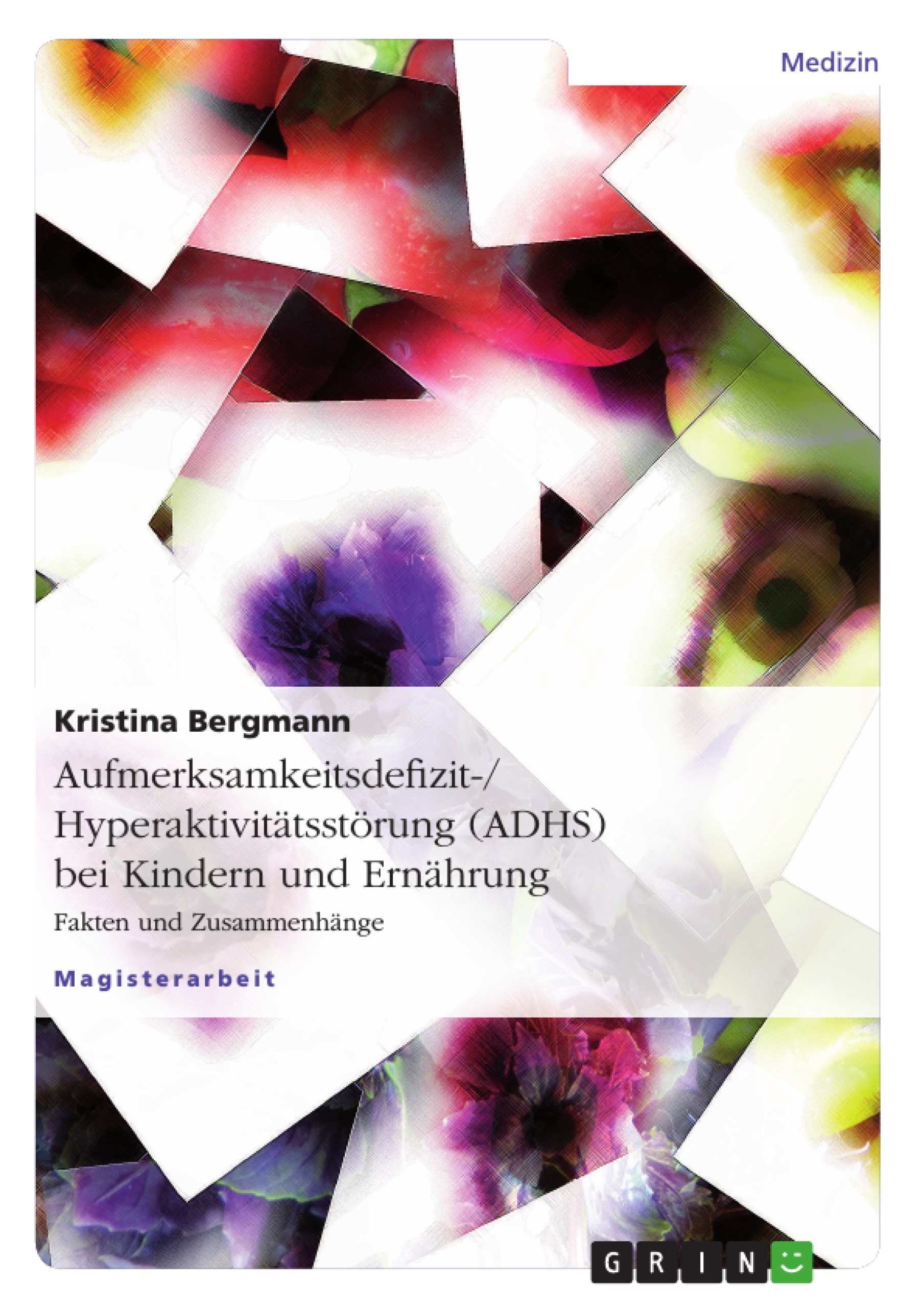Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) gehört zu den am häufigsten diagnostizierten Störungen im Kindesalter. Betroffene sind unaufmerksam und zeigen hyperaktives Verhalten. Seit über 30 Jahren werden die Zusammenhänge zwischen ADHS und Ernährung kontrovers diskutiert. Anhand einer Literaturanalyse wird in dieser Arbeit erörtert, welche Zusammenhänge zwischen ADHS und der Ernährung bestehen, ob diätetische Interventionen die Symptome verbessern können, ob diese eine mögliche Alternative zur medikamentösen Behandlung darstellen sowie welche Empfehlungen sich aus den Ergebnissen ableiten lassen.
Bei ADHS handelt es sich um ein komplexes, multifaktorielles Geschehen, bei dem sowohl genetische Ursachen als auch Umwelteinflüsse eine Rolle spielen. Unter den Umweltfaktoren sind neben exogenen Risikofaktoren und psychosozialen Einflussfaktoren die ernährungsbedingten Einflussfaktoren von Bedeutung, die wiederum Wechselwirkungen mit den anderen Faktoren bedingen.
Die medikamentöse Behandlung mit Stimulanzien hat sich in einer Langzeitstudie im Vergleich mit anderen Therapien als weniger erfolgreich erwiesen. Häufige Nebenwirkungen sind Appetitminderung, Gewichtsverluste und Wachstumsdefizite; diese können möglicherweise zu Nährstoffdefiziten führen. Andererseits ist die Prävalenz von Übergewicht und Adipositas unter von ADHS betroffenen erhöht, was auf eine allgemeine Reizüberflutung zurückgeführt wird. Ergebnisse von Langzeitstudien, die ADHS mit einer erhöhten Manganexposition über Säuglingsnahrung auf Sojaba-sis in Zusammenhang bringen, stehen derzeit noch aus.
Nährstoffe können Funktion und Leistung des Gehirns, und damit auch das Verhalten, spezifisch beeinflussen. So wird von den zwei Grundüberlegungen ausgegangen, dass bei ADHS entweder eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder ein Mangel an einem oder mehreren Nährstoffen vorliegt. Daraus ergeben sich zwei Grundprin-zipien einer entsprechenden Ernährungstherapie: die Elimination bestimmter Lebensmittel und Lebensmittelinhaltsstoffe oder eine Supplementierung von Nährstoffen.
Ein wichtiges Ziel für künftige Studien besteht darin, gezielt und individuell nutritive Risikofaktoren zu identifizieren und Effekte einer darauf aufbauenden gemischten Supplementierung von Nährstoffen zu messen. Auch die Differenzierung zwischen Subtypen der ADHS und nach Geschlecht, wie sie bereits in vielen Studien vorgenommen wurde, kann bedeutsam sein, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu identifizieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Zielsetzung
- 1.2 Vorgehensweise
- 2 Grundlagen
- 2.1 Die Aufmerksamkeits-Defizit-/Hyperaktivitätsstörung
- 2.1.1 Definition und Klassifikation der ADHS
- 2.1.2 Prävalenz der ADHS
- 2.1.3 Diagnostik der ADHS
- 2.1.4 Komorbidität
- 2.2 Ursachen und Entstehungsbedingungen der ADHS
- 2.2.1 Neurophysiologische und genetische Einflussfaktoren
- 2.2.2 Umweltfaktoren
- 2.2.3 Wechselwirkungen zwischen Einflussfaktoren
- 2.3 Therapeutische Maßnahmen bei ADHS
- 2.3.1 Verhaltenstherapie und Elterntraining
- 2.3.2 Medikamentöse Therapie
- 2.4 Zusammenhänge zwischen Ernährung und Verhalten
- 2.4.1 Nährstoffdefizite
- 2.4.2 Nahrungsmittelunverträglichkeiten
- 2.4.3 ADHS, Adipositas und Essstörungen
- 2.4.4 ADHS und Adipositas als Manifestationen eines Reizüberflutungs-Syndroms
- 2.4.5 Säuglingsnahrung auf Sojabasis als möglicher Einflussfaktor
- 3 Geschichte der Ernährungsinterventionen bei ADHS
- 3.1 Diäten bei vermuteten Nahrungsmittelunverträglichkeiten bei ADHS
- 3.1.1 Die Kaiser-Permanente-Diät nach Feingold
- 3.1.2 Die phosphatarme Diät nach Hafer
- 3.1.3 Oligoantigene Diäten
- 3.1.4 Die Rotationsdiät
- 3.1.5 Möglicher Zusammenhang der ADHS mit Zöliakie
- 3.1.6 Gluten- und kaseinfreie Diät
- 3.1.7 Reduzierung raffinierter Zuckerarten in der Kost
- 3.2 Die besondere Rolle von Lebensmittelzusatzstoffen
- 3.2.1 Hypothese
- 3.2.2 Metaanalysen zu adversen Effekten
- 3.2.3 Die Rolle des Konservierungsstoffs Propionat
- 3.2.4 Die Isle of Wight-Studie
- 3.2.5 Die Southampton-Studie
- 3.2.6 Reevaluierung von Lebensmittelzusatzstoffen in der EU
- 3.2.7 Weitere Reaktionen auf die Ergebnisse der Southampton-Studie
- 3.2.8 Die mögliche Rolle von Benzoat
- 3.2.9 Schlussfolgerung
- 3.3 Supplementierung von Nährstoffen
- 3.3.1 Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
- 3.3.2 L-Carnitin
- 3.3.3 Eisen
- 3.3.4 Jod
- 3.3.5 Zink
- 3.3.6 Magnesium
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Aufmerksamkeits-Defizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bei Kindern und Ernährung. Ziel ist es, den aktuellen Forschungsstand zu diesem komplexen Thema darzustellen und die Bedeutung von Ernährungsfaktoren für die Entstehung und Behandlung von ADHS zu beleuchten.
- Definition, Klassifikation und Prävalenz von ADHS
- Ursachen und Entstehungsbedingungen von ADHS, einschließlich genetischer, neurophysiologischer und umweltbedingter Faktoren
- Therapeutische Maßnahmen bei ADHS (Verhaltenstherapie, medikamentöse Therapie)
- Zusammenhänge zwischen Ernährung und Verhalten bei ADHS (Nährstoffdefizite, Unverträglichkeiten, Essstörungen)
- Geschichte und Evaluation verschiedener Ernährungsinterventionen bei ADHS
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Masterarbeit ein, beschreibt die Problemstellung – den Zusammenhang zwischen ADHS und Ernährung – und definiert die Ziele der Arbeit. Die Vorgehensweise bei der Literaturrecherche und -auswertung wird ebenfalls erläutert, um die Methodik der Arbeit transparent darzustellen und die wissenschaftliche Fundiertheit zu gewährleisten. Die Einleitung dient als Grundlage für das Verständnis des gesamten Forschungsprozesses und der dargestellten Ergebnisse.
2 Grundlagen: Dieses Kapitel liefert einen umfassenden Überblick über die Aufmerksamkeits-Defizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Es definiert ADHS, beschreibt ihre Prävalenz und Diagnostik, beleuchtet Komorbiditäten und analysiert die Ursachen und Entstehungsbedingungen. Hierbei werden neurophysiologische und genetische Faktoren ebenso berücksichtigt wie Umweltfaktoren und deren Wechselwirkungen. Der Abschnitt über therapeutische Maßnahmen (Verhaltenstherapie und medikamentöse Therapie) legt den Fokus auf den aktuellen Stand der Behandlungsmethoden und deren Bedeutung im Kontext der vorliegenden Arbeit. Besonders wichtig ist die detaillierte Auseinandersetzung mit den Zusammenhängen zwischen Ernährung und Verhalten bei Kindern mit ADHS, inklusive Nährstoffdefiziten, Unverträglichkeiten und der Verbindung zu Adipositas und Essstörungen. Der Kapitel verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse aus verschiedenen Bereichen um ein ganzheitliches Bild der ADHS-Problematik zu liefern.
3 Geschichte der Ernährungsinterventionen bei ADHS: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit verschiedenen Ernährungsinterventionen, die im Laufe der Zeit zur Behandlung von ADHS eingesetzt wurden. Es werden verschiedene Diäten (z.B. die Feingold-Diät, phosphatarme Diäten, oligoantigene Diäten, Rotationsdiäten, gluten- und kaseinfreie Diäten) detailliert vorgestellt, inklusive ihrer Hypothesen, Durchführung, Ergebnisse und Schlussfolgerungen. Der Fokus liegt auf der kritischen Bewertung dieser Ansätze, der Analyse ihrer Wirksamkeit und der Herausarbeitung möglicher Limitationen. Zusätzlich wird die Bedeutung von Lebensmittelzusatzstoffen wie Propionat und Benzoat beleuchtet und die Ergebnisse relevanter Studien (Isle of Wight, Southampton) eingehend diskutiert. Der Abschnitt über die Supplementierung von Nährstoffen (mehrfach ungesättigte Fettsäuren, L-Carnitin, Eisen, Jod, Zink, Magnesium) fasst den aktuellen Stand der Forschung zusammen und wertet die klinischen Studien kritisch aus. Das Kapitel bietet somit einen umfassenden Überblick über die Entwicklung und den aktuellen Wissensstand zu Ernährungsinterventionen bei ADHS.
Schlüsselwörter
Aufmerksamkeits-Defizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Kinder, Ernährung, Nährstoffdefizite, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Lebensmittelzusatzstoffe, Ernährungsinterventionen, Verhaltenstherapie, medikamentöse Therapie, Feingold-Diät, Adipositas, Essstörungen, Mehrfach ungesättigte Fettsäuren, L-Carnitin, Eisen, Jod, Zink, Magnesium.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: ADHS und Ernährung
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Diese Masterarbeit untersucht den komplexen Zusammenhang zwischen Aufmerksamkeits-Defizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bei Kindern und ihrer Ernährung. Sie beleuchtet die Bedeutung von Ernährungsfaktoren für die Entstehung und Behandlung von ADHS.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition, Klassifikation und Prävalenz von ADHS; Ursachen und Entstehungsbedingungen von ADHS (genetische, neurophysiologische und umweltbedingte Faktoren); Therapeutische Maßnahmen bei ADHS (Verhaltenstherapie, medikamentöse Therapie); Zusammenhänge zwischen Ernährung und Verhalten bei ADHS (Nährstoffdefizite, Unverträglichkeiten, Essstörungen); Geschichte und Evaluation verschiedener Ernährungsinterventionen bei ADHS.
Welche Ernährungsinterventionen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Diäten (Feingold-Diät, phosphatarme Diäten, oligoantigene Diäten, Rotationsdiäten, gluten- und kaseinfreie Diäten), die Rolle von Lebensmittelzusatzstoffen (Propionat, Benzoat), und die Supplementierung von Nährstoffen (mehrfach ungesättigte Fettsäuren, L-Carnitin, Eisen, Jod, Zink, Magnesium).
Welche Studien werden in der Arbeit berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht sich auf zahlreiche Studien, darunter die Isle of Wight-Studie und die Southampton-Studie, die die Auswirkungen von Lebensmittelzusatzstoffen auf ADHS untersucht haben. Darüber hinaus werden diverse klinische Studien zu den Effekten der Supplementierung verschiedener Nährstoffe ausgewertet.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Einleitung (Problemstellung, Zielsetzung, Vorgehensweise); Grundlagen (Definition, Ursachen, Therapie von ADHS, Ernährung und Verhalten); Geschichte der Ernährungsinterventionen bei ADHS (verschiedene Diäten, Lebensmittelzusatzstoffe, Nährstoffsupplementierung).
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel ist es, den aktuellen Forschungsstand zum Zusammenhang zwischen ADHS und Ernährung darzustellen und die Bedeutung von Ernährungsfaktoren für die Entstehung und Behandlung von ADHS zu beleuchten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Aufmerksamkeits-Defizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Kinder, Ernährung, Nährstoffdefizite, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Lebensmittelzusatzstoffe, Ernährungsinterventionen, Verhaltenstherapie, medikamentöse Therapie, Feingold-Diät, Adipositas, Essstörungen, Mehrfach ungesättigte Fettsäuren, L-Carnitin, Eisen, Jod, Zink, Magnesium.
Wie wird die wissenschaftliche Fundiertheit der Arbeit sichergestellt?
Die wissenschaftliche Fundiertheit wird durch eine transparente Darstellung der Methodik (Literaturrecherche und -auswertung) in der Einleitung sichergestellt. Die Arbeit basiert auf einer gründlichen Auswertung relevanter wissenschaftlicher Literatur und Studien.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die konkreten Schlussfolgerungen der Arbeit sind dem Text der Masterarbeit selbst zu entnehmen. Die Zusammenfassung der Kapitel bietet jedoch einen Einblick in die wesentlichen Ergebnisse und Erkenntnisse.
- Quote paper
- M. Sc. troph. Kristina Bergmann (Author), 2008, Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bei Kindern und Ernährung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/137577