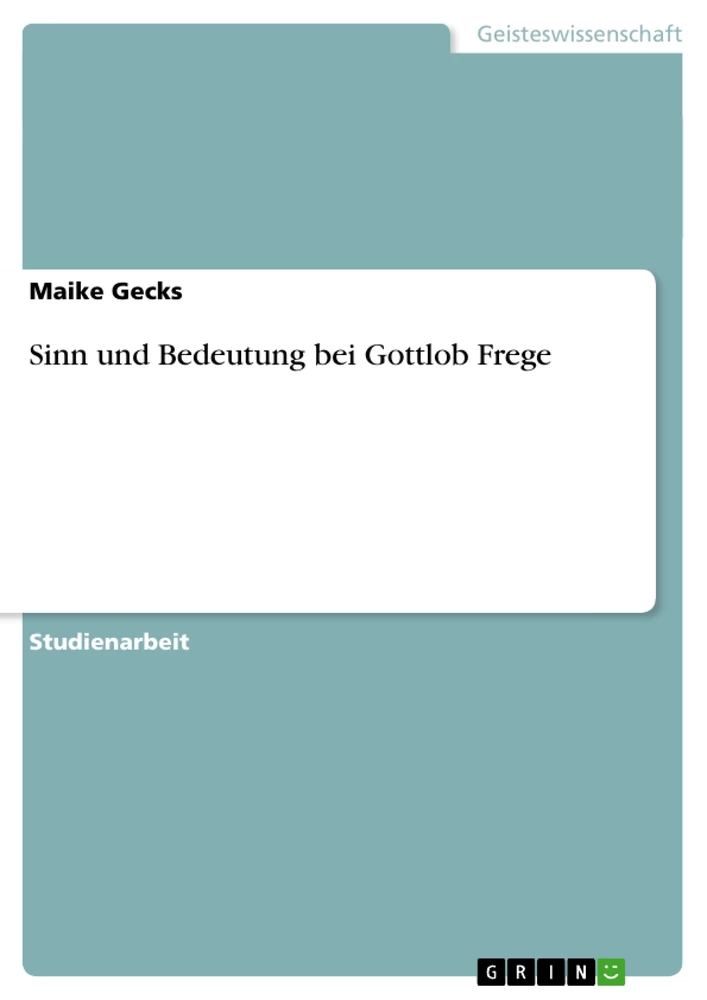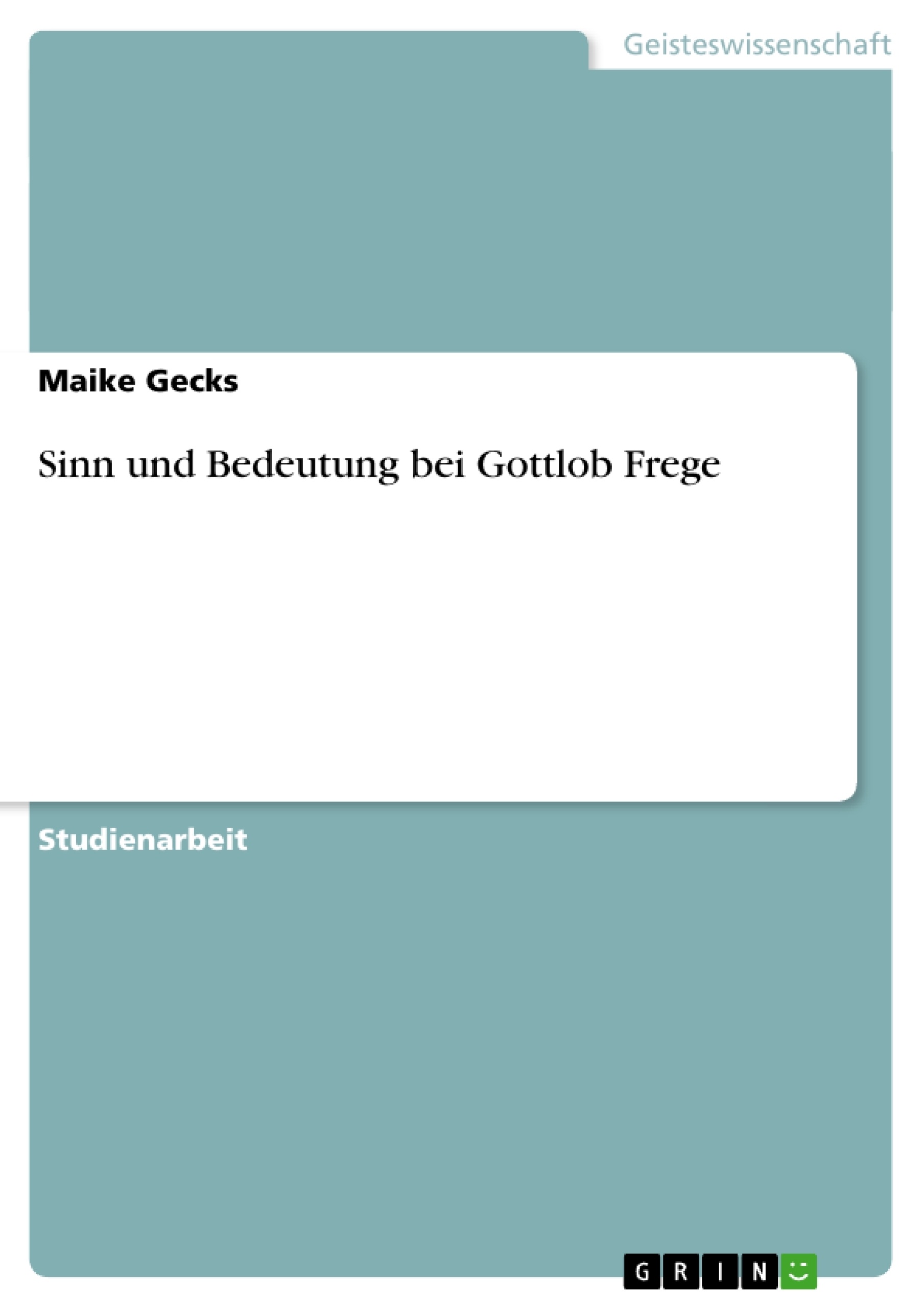Darstellung des Textes "Über Sinn und Bedeutung" von Gottlob Frege. Vergleich der Kennzeichnungstheorie mit Bertrand Russell. Der Aufsatz „Sinn und Bedeutung“ von Gottlob Frege (1848-1925), erschienen in seiner Begriffsschrift „Funktion – Begriff – Bedeutung“, befasst sich mit der Unterscheidung zwischen Zeichen, Sinn und Bedeutung bei sprachlichen Ausdrücken wie Eigennamen, Behauptungs- und Nebensätzen.
Im Verlauf dieser Ausarbeitung werden die Begriffe „Sinn“ und „Bedeutung“ zuerst erläutert und dann unter verschiedenen Aspekten untersucht und die damit verbundenen Probleme aufgezeigt.
Zum Schluss wird die Kennzeichnungstheorie von Frege kritisch hinterfragt und mit den Vorstellungen von Bertrand Russell in Verbindung gebracht.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Einfache Ausdrücke
2.1. Definition von Sinn und Bedeutung bei Eigennamen
2.2 Gerade und ungerade Rede
2.3. Vorstellungen
3. Behauptungssätze
4. Nebensätze
5. Die Kennzeichnungstheorien von Frege und Russell
6. Fazit
Literatur
1. Einleitung
Der Aufsatz „Sinn und Bedeutung“ von Gottlob Frege (1848-1925), erschienen in seiner Begriffsschrift „Funktion – Begriff – Bedeutung“, befasst sich mit der Unterscheidung zwischen Zeichen, Sinn und Bedeutung bei sprachlichen Ausdrücken wie Eigennamen, Behauptungs- und Nebensätzen.
Im Verlauf dieser Ausarbeitung werden die Begriffe „Sinn“ und „Bedeutung“ zuerst erläutert und dann unter verschiedenen Aspekten untersucht und die damit verbundenen Probleme aufgezeigt.
Zum Schluss wird die Kennzeichnungstheorie von Frege kritisch hinterfragt und mit den Vorstellungen von Bertrand Russell in Verbindung gebracht.
2. Einfache Ausdrücke
Sprachliche Ausdrücke wie Worte, Namen, Schriftzeichen oder Sätze werden als Zeichen definiert.
2.1. Definition von Sinn und Bedeutung bei Eigennamen
Die Bedeutung eines Eigennamens ist laut Frege das, worauf der Ausdruck Bezug nimmt, also den Gegenstand des Ausdrucks. Von der Bedeutung hängt der Wahrheitswert des Satzes ab, der entweder „wahr“ oder „falsch“ sein kann. Der Sinn eines Eigennamens steht dagegen für die Art des Gegebenseins des Gegenstandes, somit für das, was ein Mensch unter dem Ausdruck versteht. Er ist zudem objektiv.
Den Unterschied erläutert Frege in dem Beispiel der Venus:
Die Ausdrücke „Morgenstern“ und „Abendstern“ haben nicht denselben Sinn, da einmal die Sichtbarkeit des Sterns am Morgen und einmal die Sichtbarkeit am Abend bekundet wird. Sie haben aber die gleiche Bedeutung, da beide Ausdrücke den Planeten Venus bezeichnen.[1]
Mit diesem Beispiel macht Frege deutlich, dass eine Aussage wie „a = a“ einen anderen Erkenntniswert als eine Aussage der Form „a = b“ besitzt, da über „a = a“ nur eine Identitätsaussage getroffen wird und über „a = b“ zum Ausdruck gebracht wird, dass ein auf eine bestimmte Art gegebener Gegenstand mit einem Gegenstand von anderer Art identisch ist. Somit ist die Aussage, dass der Morgenstern der Morgenstern ist nicht informativ, wobei die Erkenntnis, dass der Morgenstern der Abendstern ist, sehr entscheidend für die Wissenschaft war. Die Bedeutung von „a = a“ und „a = b“ ist dieselbe, es liegt jedoch ein anderer Gedanke vor. Der Wahrheitswert kann hier allerdings derselbe sein, solang die Bedeutung nicht verschieden ist. Dennoch kann der Sinn von „a“ verschieden von dem Sinn von „b“ sein und somit ist auch der Gedanke in „a = b“ ein anderer als in „a = a“. Beide Sätze haben dann einen unterschiedlichen Erkenntniswert, obwohl sie wahr sind.[2]
Die Erkenntnis, dass a = a ist, kann ein Mensch a priori treffen. Doch zu dem Schluss, dass a = b sein kann, gelangt der Mensch nur durch Erfahrung. Voraussetzung ist, dass er die Bedeutung von „a“ und „b“ kennt.
Hier stellt sich das erste Problem, da nicht alle Menschen der Aussage „Abendstern = Morgenstern“ zustimmen würden, weil sie zum Beispiel die Sprache nicht verstehen oder zu wenig Erfahrung besitzen. Dieses Problem umgeht Frege, indem er aussagt:
„Der Sinn eines Eigennamens wird von jedem erfasst, der die Sprache oder das Ganze von Bezeichnungen hinreichend kennt, der er angehört […]. Zu einer allseitigen Erkenntnis der Bedeutung würde gehören, dass wir von jedem gegebenen Sinne sogleich angeben könnten, ob er zu ihr gehöre. Dahin gelangen wir nie.“[3]
Eigennamen vertreten die Bedeutung eines bestimmten Gegenstandes oder auch einer Gegebenheit. Sie bestehen aus Zeichen, Zeichenverbindungen, Namen, Kennzeichnungen, Termen oder Worten. Zudem können sie dieselbe Bedeutung (siehe oberes Beispiel) und zugleich einen unterschiedlichen Sinn haben. Außerdem können Eigennamen einen Sinn ohne eine Bedeutung haben, solang es sich zum Beispiel um einen fiktiven Namen handelt, der nicht in der realen Welt vorkommt.
2.2 Gerade und ungerade Rede
Frege definiert die gerade Rede so: „Es kann aber auch vorkommen, dass man von den Worten selbst oder von ihrem Sinne reden will. Jenes geschieht z.B., wenn man die Worte eines anderen in gerader Rede anführt. Die eigenen Worte bedeuten dann zunächst die Worte des anderen, und erst diese haben die gewöhnliche Bedeutung.“[4]
Ein Satz wird also in gerader Rede verwendet, wenn man ihn erwähnt und nicht gebraucht. Dies macht man durch Anführungszeichen kenntlich.
Beispiel:
Der Satz „Der Morgenstern ist die Venus“ hat 25 Buchstaben.
Die Bedeutung des erwähnten Satzes steht in den Anführungszeichen. Um den Wahrheitswert des Gesamtsatzes zu ermitteln, betrachtet man den vollständigen Satz. In diesem Fall wird nur die Anzahl der Buchstaben des Satzes „Der Morgenstern ist die Venus“ festgestellt, um den Wahrheitswert als „wahr“ zu begründen.
Die Bedeutung des erwähnten Ausdrucks erhält man, wenn man die Anführungszeichen auflöst und nur den eingeschlossen Ausdruck behält. Auch in diesem Fall ist der Satz „wahr“.
Ein Satz wird in ungerader Rede verwendet, wenn ein Teil des Satzes z.B. die Form „A sagt, hört, meint, weiß, dass …“ hat.[5]
[...]
[1] Frege, Gottlob: Über Sinn und Bedeutung, in: Funktion – Begriff – Bedeutung, hrsg. v. Mark Textor, 2. durchgesehene Auflage, Sammlung Philosophie, Band 4, Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, Göttingen, 2007, S. 25
[2] Frege, Gottlob: Über Sinn und Bedeutung, S. 26
[3] Frege, Gottlob: Über Sinn und Bedeutung, S. 27
[4] Frege, Gottlob: Über Sinn und Bedeutung, S. 28
[5] Frege, Gottlob: Über Sinn und Bedeutung, S. 37
- Arbeit zitieren
- Maike Gecks (Autor:in), 2009, Sinn und Bedeutung bei Gottlob Frege, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/137536