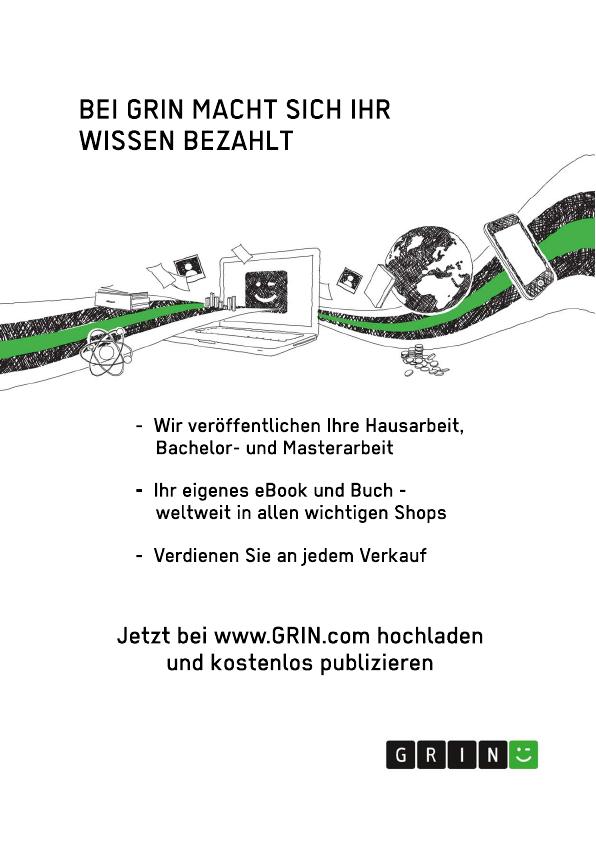1. Einführung
Im Blickfeld einer baldigen Bundestagswahl und unter Berücksichtigung der Umfrageergebnisse, die Verlust der großen Volksparteien an Wählerschaft vorhersehen, ist die Bedeutung kleiner Parteien nicht zu unterschätzen. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands befindet sich seit geraumer Zeit in einem Abwärtstrend der Wählergunst, zudem treten immer mehr Mitglieder aus der Partei aus. Nicht nur die relativ neue Linkspartei könnte von diesem Stimm- und Sympathieverlust profitieren, sondern auch eine Partei, die sich in einem Zeitraum von mehr als zwei Jahrzehnten in der deutschen Parteienlandschaft festgesetzt hat, sowohl eine langjährige Erfahrung in der Oppositionsrolle, als auch der Regierungsverantwortung vorweisen kann. Seit dem Einzug in den Deutschen Bundestag 1983 und den ersten Erfahrungen auf Länderregierungsebene ab 1985 sind Bündnis 90/ Die Grünen aus den bundesdeutschen Parlamenten nicht mehr wegzudenken. Hierbei ist es interessant zu untersuchen, was sich für die Grünen als Regierungspartei verändert hat. Offensichtlich haben verschiedene innerparteiliche Entwicklungsprozesse auf struktureller, ideologischer und praktischer Ebene stattgefunden. Konsens besteht weitgehend darin, dass diese notwendig waren, um die Handlungsfähigkeit im parlamentarischen Betrieb, insbesondere in der Regierungsverantwortung, aufrechterhalten oder gar verbessern zu können. Übereinstimmend werden auch basisdemokratische Parteielemente als langfristig hinderlich bei dringlichen, erforderlichen Entscheidungsfindungen betrachtet. Daraus leitet sich eine zentrale These ab: Das Modell der Basisdemokratie der Grünen ist im repräsentativen Parlamentarismus gescheitert.
Im Folgenden meiner Seminararbeit werde ich einige Aspekte, Grundlagen und Problematiken beleuchten, um diese These analysieren zu können. Anfänglich widme ich mich hierzu...
Inhaltsverzeichnis
1.Einführung
2.Einflüsse und Prägungen bei der Parteigründung
2.1. Historische Konzepte der Basisdemokratie
2.1.1. Formen der “grass roots“
2.1.2. Direkte Demokratie im Sinne Rousseaus
2.2. Ursprüngliches Selbstverständnis als Bewegungspartei/Antipartei-Partei
3.Die Umsetzung basisdemokratischer Ideen anhand von parteiinternen Regularien
3.1. Rotationsprinzip
3.2. Imperatives Mandat
3.3. Trennung von Amt und Mandat
4.Das Scheitern nach 1998
4.1. Handlungsfähigkeit als Regierungspartei
4.2.Strukturelle Defizite
4.3. Ideologische Differenzen
5.Fazit
Literaturverzeichnis
1. Einführung
Im Blickfeld einer baldigen Bundestagswahl und unter Berücksichtigung der Umfrageergebnisse, die Verlust der großen Volksparteien an Wählerschaft vorhersehen, ist die Bedeutung kleiner Parteien nicht zu unterschätzen. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands befindet sich seit geraumer Zeit in einem Abwärtstrend der Wählergunst, zudem treten immer mehr Mitglieder aus der Partei aus. Nicht nur die relativ neue Linkspartei könnte von diesem Stimm- und Sympathieverlust profitieren, sondern auch eine Partei, die sich in einem Zeitraum von mehr als zwei Jahrzehnten in der deutschen Parteienlandschaft festgesetzt hat, sowohl eine langjährige Erfahrung in der Oppositionsrolle, als auch der Regierungsverantwortung vorweisen kann. Seit dem Einzug in den Deutschen Bundestag 1983 und den ersten Erfahrungen auf Länderregierungsebene ab 1985 sind Bündnis 90/ Die Grünen aus den bundesdeutschen Parlamenten nicht mehr wegzudenken. Hierbei ist es interessant zu untersuchen, was sich für die Grünen als Regierungspartei verändert hat. Offensichtlich haben verschiedene innerparteiliche Entwicklungsprozesse auf struktureller, ideologischer und praktischer Ebene stattgefunden. Konsens besteht weitgehend darin, dass diese notwendig waren, um die Handlungsfähigkeit im parlamentarischen Betrieb, insbesondere in der Regierungsverantwortung, aufrechterhalten oder gar verbessern zu können. Übereinstimmend werden auch basisdemokratische Parteielemente als langfristig hinderlich bei dringlichen, erforderlichen Entscheidungsfindungen betrachtet. Daraus leitet sich eine zentrale These ab: Das Modell der Basisdemokratie der Grünen ist im repräsentativen Parlamentarismus gescheitert.
Im Folgenden meiner Seminararbeit werde ich einige Aspekte, Grundlagen und Problematiken beleuchten, um diese These analysieren zu können. Anfänglich widme ich mich hierzu den Entwicklungslinien der basisdemokratischen Strukturen bei den Grünen. Dafür werde ich verschiedene historische Konzepte vorstellen und die Kerngedanken für die ursprüngliche Bewegung der Grünen und die Ursprungsgedanken aufzeigen. Dies ist insofern sinnvoll, als dass es ein theoretisches Fundament ermöglicht, auf dem das anfängliche Selbstverständnis der Grünen zur Parteigründung und in den ersten Parteijahren besser nachvollzogen werden kann. Nur so ist es möglich, eine Vorstellung der Grundideen von Basisdemokratie als Ausgangspunkt der weiteren Betrachtung zu erhalten. Daraufhin erscheint es mir sinnvoll, die basisdemokratischen Elemente in der Parteistruktur vorzustellen, da sie die praktischen Übertragungsversuche und Umsetzungsmethoden eines theoretischen Konstrukts in die Tagespolitik aufzeigen. Der Grundgedanke dieses Vorgehens ist hierbei, weitere Betrachtungsmöglichkeiten zu entwickeln, die es wiederum zu analysieren gilt. Die unterschiedlichen Ausgestaltungsformen der parteiinternen Regularien, wie Rotationsprinzip, Imperatives Mandat oder auch Trennung von Amt und Mandat weisen bestimmte Effekte auf, die es zu differenzieren gilt. Die daraus vorgegangenen Probleme, dienen dann im folgenden vierten Kapitel als Analysegrundlage, um darzulegen, auf welchen Ebenen die Strukturen der Grünen gescheitert sind und zu welchen grundsätzlichen Veränderungen der Parteiorganisation sie geführt haben. Der Schwerpunkt meiner Betrachtung liegt in der Phase der bundespolitischen Regierungsverantwortung ab 1998. Besonders die Aspekte der Handlungsfähigkeit bzw. Handlungsunfähigkeit, als auch Probleme auf struktureller und ideologischer Basis fallen ins Gewicht. Die Beurteilung der internen Differenzen der Grünen und die Komplikationen bezüglich ihrer Außenwirkung lassen mich letztendlich zu meinem Fazit kommen.
2.Einflüsse und Prägungen bei der Parteigründung
2.1. Historische Konzepte der Basisdemokratie
„Das wichtigste Merkmal des basisdemokratischen Modells ist – zumindest seinem theoretischen Anspruch nach - der Verzicht auf Entscheidungen, die Einzelnen oder Minderheiten ein Verhalten aufzwingen, das sie nicht akzeptieren können. Mit anderen Worten, dieses System verzichtet auf jede Art von Zwang. Es ist seinem Anspruch nach ein gewaltfreies System der politischen Willensbildung.“[1][2]
Hauptkritikpunkte der grünen Gründungsmitglieder waren sowohl die Formen der Machtanhäufung und des Machtausbaus, die im bestehenden parlamentarischen und parteipolitischen System offensichtlich vorzufinden sein, als auch die mangelnde parteiinterne Demokratie, wie man sie in den Parteien und Fraktionen von CDU/CSU, SPD und FDP vorfände. Aus grüner Perspektive erfolge es fast zwangläufig, dass Macht korrupt mache, besonders wenn sie in den Händen einiger weniger läge. Deshalb galt es Umsetzungsmöglichkeiten zu finden, die Macht auf die Schultern möglichst vieler zu verteilen, dezentral zu funktionieren und somit jeder Form von Hierarchie entgegenzuwirken.[3]
2.1.1. Formen der “grass roots“
Ideengeschichtlich geht dieser Begriff aus den sogenannten „Graswurzelbewegungen“[4] hervor. Vorhaben dieser kleinen organisierten Gruppen war es den gewöhnlichen parteipolitischen Meinungsbildungsprozess umgehen zu wollen. Der politische Wandel sollte durch engagierte Äußerungen und Pläne von Bürgern gegenüber unflexiblen staatlichen Organisationen erreicht werden. Anliegen einiger Initiativen war es, gesellschaftliche Alternativen zum Bestehenden aufzubauen und basale Veränderungen im System zu bewirken. Erste Organisationsformen fanden sich in den Bürgerrechtsbewegungen der USA in den 60er und 70er Jahren wieder und wurden über die Studentenbewegungen und anderen neuen Bewegungen in die Bundesrepublik Deutschland importiert. Strukturelle Merkmale der Graswurzeldemokratie sind kleine, überschaubare Einheiten in der Größenordnung von zehn bis fünfzehn Personen, die in der Lage sind ihre Entscheidungen gemeinschaftlich zu treffen. Eine hierarchische Gliederung wird abgelehnt, das heißt, das Graswurzelmodel strebt eine dezentrale Organisation an, in der die einzelnen Gruppen autonom und eigenverantwortlich handeln sollen. Entschlussfindungen erfolgen nach dem Konsensprinzip. Hierbei ist hervorzuheben, dass der Anspruch erhoben wird, dass jede Entscheidung von allen Mitgliedern der Gruppen gleichberechtigt getroffen werden sollte.[5]
2.1.2. Direkte Demokratie im Sinne Rousseaus
Bereits in Jean-Jacques Rousseaus Werk „ In Der Gesellschaftsvertrag oder Die Grundsätze des Staatsrechtes“ aus dem Jahre 1758 werden direktdemokratische Elemente erwähnt, die von den Grünen aufgegriffen worden sind. Laut Rousseau müsste im Idealfall eine größtmögliche Einheit von Regierenden und Regierten hergestellt werden. Er nimmt hierbei eine Unterscheidung zwischen Gemeinwillen, Gesamtwillen und Sonderwillen vor, wobei der letztere das individuelle Interesse des Einzelnen beschreibt und die Gesamtheit aller Sonderwillen den Gesamtwillen bildet. Der Gemeinwillen zeichnt sich dadurch aus, dass er nicht irrt und das Beste für die Gemeinschaft darstellt. Aus diesem Grund seien Parteien und ihre Delegierten abzulehnen, da sie die Teilgesellschaften förderten und somit dem Volk seine ihm zustehende Souveränität rauben. Repräsentation steht somit im Widerspruch zur Freiheit und Selbstbestimmung eines Volkes.[6]
2.1.3. Volksherrschaft der Räte
Auslöser für die Beschäftigung mit diesem Modell war die Kritik am Parlamentarismus und damit verbunden eines angeblichen Demokratiedefizits. Rätedemokratie ist unmittelbar mit sozialistischen Herrschaftsentwürfen in Verbindung zu bringen und stellt keine Ergänzung zur repräsentativen Demokratie dar, sondern ein alternatives Gesellschaftskonzept, das in seinen Ursprüngen bei Karl Marx zu finden ist. Grundcharakteristika sind unter anderem eine stringente Meinungsbildung von unten nach oben, die dadurch ermöglicht wird, dass man sogenannte Basisgruppen gründet, die durch aktive Einbeziehung an elementaren politischen Entscheidungen beteiligt werden, zweitens eine Vergabe aller öffentlichen Positionen nur durch Wahl, drittens eine jederzeit mögliche Absetzbarkeit aller gewählten Vertreter, viertens eine Angleichung des Gehalts der Delegierten an das Durchschnittseinkommen der Urwähler und fünftens geringe Wiederwahlchancen der Abgeordneten durch die Umsetzung der Ämterrotation, um Korruption und Machtanhäufung Einhalt zu gebieten.[7]
2.2. Ursprüngliches Selbstverständnis als Bewegungspartei und Antipartei-Partei
Um die Sichtweise der Grünen auf sich selbst besser verstehen zu können, muss man die historische Entwicklung aus der Tradition heterogener Protest- und Bewegungsgruppierungen miteinbeziehen. Einig war man sich jedoch in der Wahrnehmung als verlängerter Arm der Bürgerinitiativen im Parlament agieren zu können. Die Verankerung der Partei in den Bewegungen sollte gewissermaßen das „Standbein“ darstellen, die Vernetzung und Verflechtung der Partei innerhalb des institutionellen Machtgefüges sollte als eine Art „Spielbein“ funktionieren. Parlamentsarbeit hatte demzufolge nachgeordnete, vielmehr dienende Funktion um die höheren Ziele aus den Protest- und Bürgerbewegungen umsetzen zu können. Die Partei erfüllte auf legislativer Ebene die Funktion eines Sprachrohrs für die Ideen und Vorhaben von außerparlamentarischen Akteuren. Nahezu alle Parteigründungmitglieder waren selbst Teile einer Bewegung oder in Bürgerinitiativen beheimatet. Dies führte zu dem Versuch direktdemokratische Elemente anhand von Satzungen und Verordnungen in die Parteiorganisation einfließen zu lassen. Die prinzipielle Offenheit der Partei für alle beliebigen Strömungen fand ihre Selbstbegrenzung in der grundlegenden herrschaftskritischen Sichtweise.[8]
Ein zweiter wichtiger Anknüpfungspunkt, der einen Konsens ermöglichte, war neben der Selbstbetrachtung als Bewegungspartei, das gemeinsame Ablehnen der etablierten Parteien und eine damit verbundene Verweigerungshaltung gegenüber deren politischen Stil und Politikverständnis. Die Selbstbezeichnung als „Antipartei-Partei“ durch Mitbegründerin Petra Kelly sollte die Andersartigkeit der neuen Partei unterstreichen und die Differenz zu den vorhanden Parteikonzepten verdeutlichen. Die Grünen verstanden sich selbst als notwendige Ergänzung auf dem parteipolitischen Spielbrett, was man anhand der Formulierung in der Präambel ihres ersten Partei- und Bundesprogramms herauslesen kann.
„Wir sind die Alternative zu den herkömmlichen Parteien. Hervorgegangen sind wir aus einem Zusammenschluss von grünen, bunten und alternativen Listen und Parteien. Wir fühlen uns verbunden mit all denen, die in der neuen demokratischen Bewegung mitarbeiten: den Lebens-, Natur- und Umweltschutzverbänden, den Bürgerinitiativen, der Arbeiterbewegung, christlichen Initiativen, der Friedens- und Menschenrechts-, der Frauen- und Dritte-Welt-Bewegung.“[9]
Die Gründung einer Partei erfolgte als Mittel zum Zweck um die Einflussmöglichkeiten der Bewegungen verstärken zu können und bundespolitisch Legitimation zu erhalten. Es erfolgte eine Verlagerung des Wirkungsrahmens der Bewegung von außerparlamentarischer Aktionsweise in die Institutionen.
„Mit ihrer zunächst regionalen, dann bundesweiten Konstitution als Partei am Ende der 70er/Anfang der 80er-Jahre haben sich die Grünen auf den staatlich institutionalisierten politischen Machterwerb objektiv eingelassen. Es ist bekannt, daß sie sich dies nur sehr allmählich auch subjektiv in voller Breite eingestanden haben.“[10]
[...]
[1] Sammelbegriff für Formen politischer Beteiligung, bei denen politische Entscheidungen direkt vom Volk getroffen werden oder neben den etablierten Parteien auch andere politische Gruppen (z.B. Verbände) und spontane Vereinigungen (z.B. Bürgerinitiativen) die politischen Entscheidungen beeinflussen und gestalten können. (Vgl. http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=VFYJHM).
[2] Sternstein, Wolfgang: Keine Macht für niemand!, Opladen 1984, S. 290.
[3] Ermer, Isabel: Vom „entfant terrible“ zur staatstragenden Partei. Die innerparteiliche Strukturanpassung der Bundespartei Bündnis 90/Die Grünen an das politische System der Bundesrepublik, S. 32f.
[4] Politische oder gesellschaftliche Initiative, die aus der Basis der Bevölkerung entsteht.
[5] Vgl. Ermer, Isabel: Vom „entfant terrible“ zur staatstragenden Partei. Die innerparteiliche Strukturanpassung der Bundespartei Bündnis 90/Die Grünen an das politische System der Bundesrepublik, S. 36f..
[6] Vgl. Ermer, Isabel: Vom „entfant terrible“ zur staatstragenden Partei. Die innerparteiliche Strukturanpassung der Bundespartei Bündnis 90/Die Grünen an das politische System der Bundesrepublik, S. 38f.
[7] Vgl. Ermer, Isabel: Vom „entfant terrible“ zur staatstragenden Partei. Die innerparteiliche Strukturanpassung der Bundespartei Bündnis 90/Die Grünen an das politische System der Bundesrepublik, S. 39f.
[8] Vgl. Ebd., S. 28ff.
[9] http://www.bpb.de/popup/popup_quellentext.html?guid=00138056715885783849375010710261.
[10] Lamla, Jörn: Grüne Politik zwischen Macht und Moral, Frankfurt am Main 2002, S.73.
- Quote paper
- Alexander Christian Pape (Author), 2009, Scheitern der Basisdemokratie im repräsentativen Parlamentarismus am Beispiel der Grünen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/137416