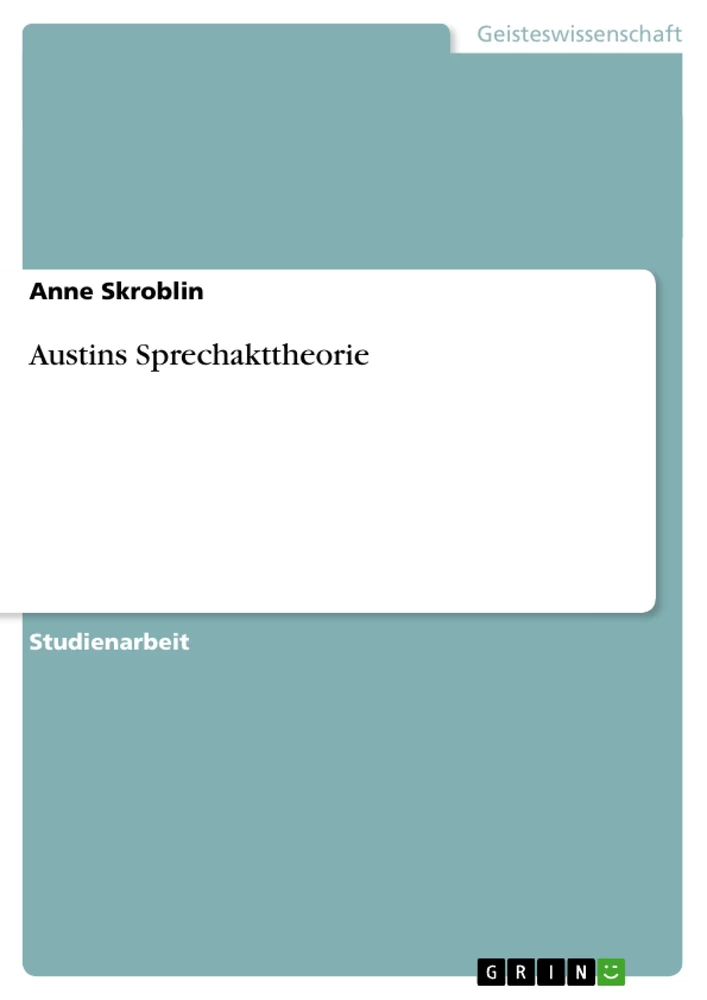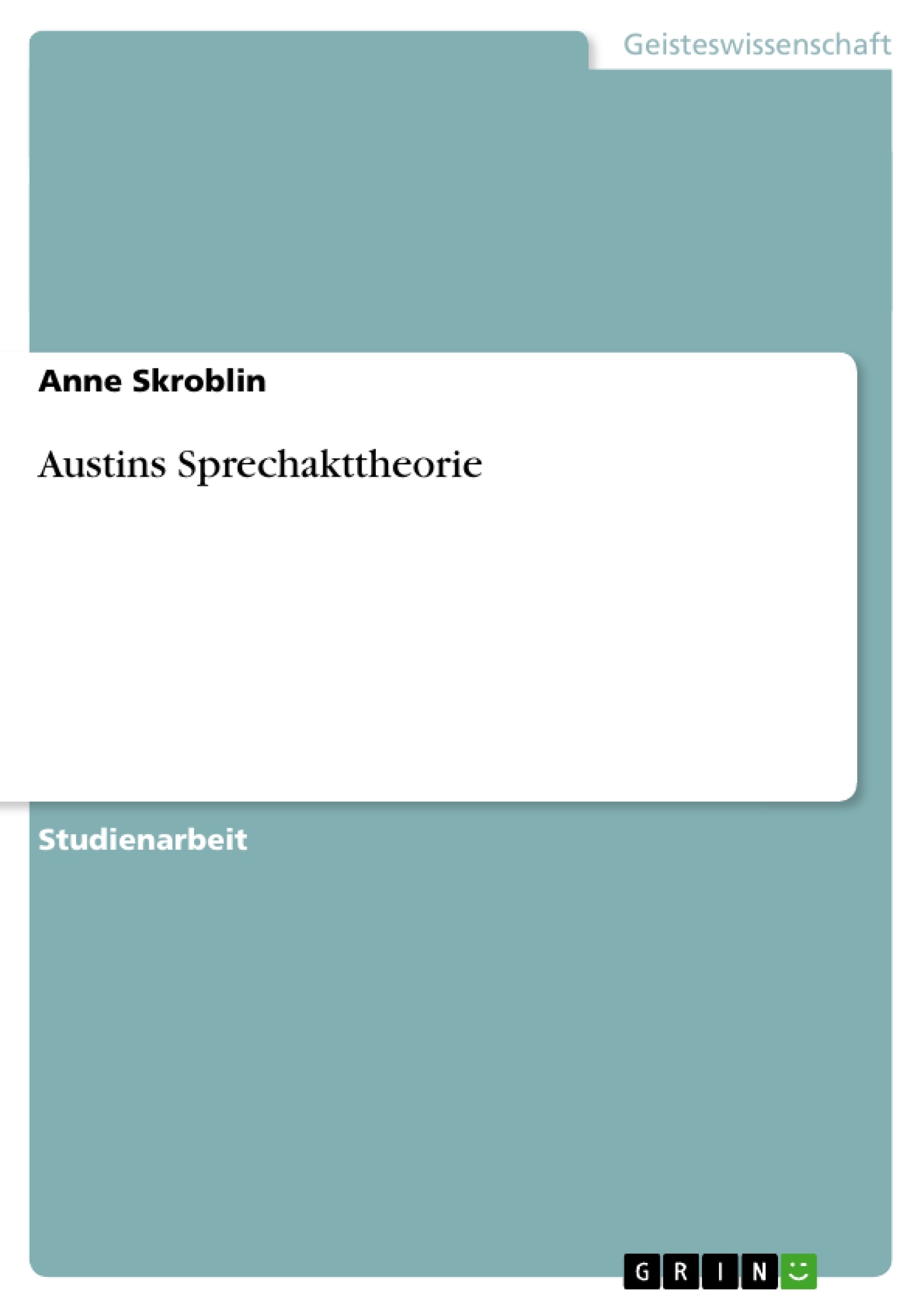Als der Philosophieprofessor John Langshaw Austin im Jahre 1955 in Oxford anfing, seine Vorlesung zu halten, war er sich noch nicht darüber im Klaren, dass er damit die bisherigen Theorien in der Sprachphilosophie (und Sprachwissenschaft) größtenteils entwerten und revolutionieren würde.
Austin ahnte am Beginn seiner Vorlesung, dass es möglich ist, ‚to do things with words’. Nun, da er im Laufe seiner Vorlesung die Möglichkeit eine strikten Differenzierung zwischen performativen und konstativen Äußerungen aufgeben musste, stellte sich die Frage: Tut man vielleicht etwa immer etwas mit Worten? Austin verstand – und das ist das Revolutionäre, dass alle (!) Äußerungen Handlungen sind. Handlungen können jedoch nicht wahr oder falsch sein. Sie glücken oder missglücken.
Ausgehend von dieser Erkenntnis entwickelte Austin seine Sprechakttheorie (die später von seinem Schüler John Searle weiterentwickelt wurde).
In dieser Arbeit wird zum einem Austins Erkenntnisweg während dieser Vorlesung skizziert: Über den Versuch, eine Taxonomie zwischen performativen und konstativen Äußerungen aufzustellen; über die Einsicht, dass auch konstative Äußerungen eigentlich implizit performativ sind; hin zur Aufgabe dieses Versuchs mit der Konsequenz, alles Äußern als Handeln aufzufassen und somit die Sprechakttheorie zu begründen.
Zum anderen wird besonders die Sprechakttheorie an sich mitsamt ihren Teilakten beleuchtet und mittels Beispielen, Schaubildern und einer Zeichnung erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Das Problem
- 2 Austins Weg zur Sprechakttheorie
- 2.1 Performative versus konstative Äußerungen
- 2.1.1 Performative Äußerungen
- 2.1.1.1 Über das Glücken und Missglücken von performativen Äußerungen
- 2.1.1.2 Verdeutlichung durch Lycan
- 2.1.1.3 Explizit performative Äußerungen versus implizit performative Äußerungen
- 2.1.2 Der performative und konstative Teil in Äußerungen
- 2.1.3 Die Konklusion
- 3 Austins Sprechakttheorie
- 3.1 Die Teilakte in Austins Sprechakttheorie
- 3.1.1 Der lokutionäre Akt
- 3.1.1.1 Der phonetische Akt
- 3.1.1.2 Der phatische Akt
- 3.1.1.3 Der rhetische Akt
- 3.1.1.4 Ergo
- 3.1.2 Der illokutive Akt
- 3.1.2.1 Illokutionäre Rollen
- 3.1.3 Der perlokutive Akt
- 3.2 Der Sprechakt im Ganzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Austins Sprechakttheorie. Ziel ist es, die Entstehung und zentralen Aspekte der Theorie nachzuvollziehen und zu erklären. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Abgrenzung performativer von konstativen Äußerungen gelegt.
- Die Unterscheidung zwischen performativen und konstativen Äußerungen
- Das Glücken und Missglücken performativer Sprechakte
- Die drei Teilakte des Sprechakts (lokutionär, illokutionär, perlokutiv)
- Explizite und implizite Performative
- Die Bedeutung von Konventionen für den Erfolg von Sprechakten
Zusammenfassung der Kapitel
1 Das Problem: Der einführende Abschnitt beschreibt das zentrale Problem, das Austin mit seiner Theorie adressiert: die Existenz von Äußerungen, die weder wahr noch falsch sind, aber dennoch bedeutungsvoll sind. Als Beispiele werden Trauungs- und Taufformeln genannt. Diese „performativen“ Äußerungen vollziehen Handlungen und unterscheiden sich grundlegend von „konstativen“ Äußerungen, die deskriptiv sind und einen Wahrheitswert besitzen. Der Abschnitt legt den Grundstein für Austins Theorie, indem er die Notwendigkeit einer neuen Perspektive auf sprachliche Äußerungen aufzeigt.
2 Austins Weg zur Sprechakttheorie: Dieses Kapitel verfolgt die Entwicklung von Austins Denken. Es beginnt mit der Unterscheidung zwischen performativen und konstativen Äußerungen. Performative Äußerungen, wie z.B. „Ich taufe dieses Schiff“, vollziehen Handlungen. Ihre Gültigkeit hängt von Kontextfaktoren und der Einhaltung bestimmter Konventionen ab. Das Kapitel beleuchtet die Kriterien für das Gelingen und Misslingen performativer Äußerungen und führt Lycans Beispiel „I double“ ein, um die Problematik der Wahrheitswert-Zuordnung bei performativen Äußerungen zu verdeutlichen. Schließlich wird die Unterscheidung zwischen expliziten und impliziten Performativen eingeführt.
Schlüsselwörter
Sprechakttheorie, John L. Austin, performative Äußerungen, konstative Äußerungen, Illokution, Lokution, Perlokution, Sprechakte, Konventionen, Handlung, Gelingen, Misslingen.
Häufig gestellte Fragen zu "Austins Sprechakttheorie"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit John L. Austins Sprechakttheorie. Sie untersucht die Entstehung und zentralen Aspekte der Theorie, insbesondere die Unterscheidung zwischen performativen und konstativen Äußerungen.
Was sind die Hauptthemen der Arbeit?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: die Unterscheidung zwischen performativen und konstativen Äußerungen, das Gelingen und Misslingen performativer Sprechakte, die drei Teilakte des Sprechakts (lokutionär, illokutionär, perlokutiv), explizite und implizite Performative sowie die Bedeutung von Konventionen für den Erfolg von Sprechakten.
Welche Problematik wird in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit adressiert das Problem der Existenz von Äußerungen, die weder wahr noch falsch sind, aber dennoch bedeutungsvoll sind. Austin nennt Beispiele wie Trauungs- und Taufformeln, die Handlungen vollziehen ("performative" Äußerungen) im Gegensatz zu deskriptiven Äußerungen mit Wahrheitswert ("konstative" Äußerungen).
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel, die Austins Weg zur Sprechakttheorie nachvollziehen. Kapitel 1 ("Das Problem") führt in die Thematik ein. Kapitel 2 ("Austins Weg zur Sprechakttheorie") analysiert die Unterscheidung zwischen performativen und konstativen Äußerungen, das Gelingen und Misslingen performativer Äußerungen und die Unterscheidung zwischen expliziten und impliziten Performativen. Kapitel 3 ("Austins Sprechakttheorie") beschreibt detailliert die drei Teilakte (lokutionär, illokutionär, perlokutiv) und den Sprechakt im Ganzen.
Was sind performative und konstative Äußerungen?
Performative Äußerungen sind Äußerungen, die selbst Handlungen vollziehen (z.B. "Ich taufe dich"). Konstative Äußerungen hingegen sind deskriptiv und haben einen Wahrheitswert (z.B. "Der Himmel ist blau").
Welche Rolle spielen die drei Teilakte (Lokution, Illokution, Perlokution)?
Austins Sprechakttheorie unterscheidet drei Teilakte: den lokutionären Akt (die Äußerung selbst), den illokutionären Akt (die Handlung, die mit der Äußerung vollzogen wird) und den perlokutiven Akt (die Wirkung der Äußerung auf den Hörer).
Was bedeutet das Gelingen und Misslingen von Sprechakten?
Das Gelingen oder Misslingen eines Sprechakts hängt von verschiedenen Faktoren ab, u.a. vom Kontext, der Einhaltung von Konventionen und der Erfüllung bestimmter Bedingungen. Die Arbeit untersucht diese Kriterien im Detail.
Welche Rolle spielen Konventionen in Austins Theorie?
Konventionen spielen eine zentrale Rolle für den Erfolg von Sprechakten, insbesondere bei performativen Äußerungen. Die Einhaltung bestimmter sozialer und sprachlicher Konventionen ist oft eine Voraussetzung für das Gelingen eines Sprechakts.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sprechakttheorie, John L. Austin, performative Äußerungen, konstative Äußerungen, Illokution, Lokution, Perlokution, Sprechakte, Konventionen, Handlung, Gelingen, Misslingen.
- Quote paper
- Anne Skroblin (Author), 2004, Austins Sprechakttheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/137016