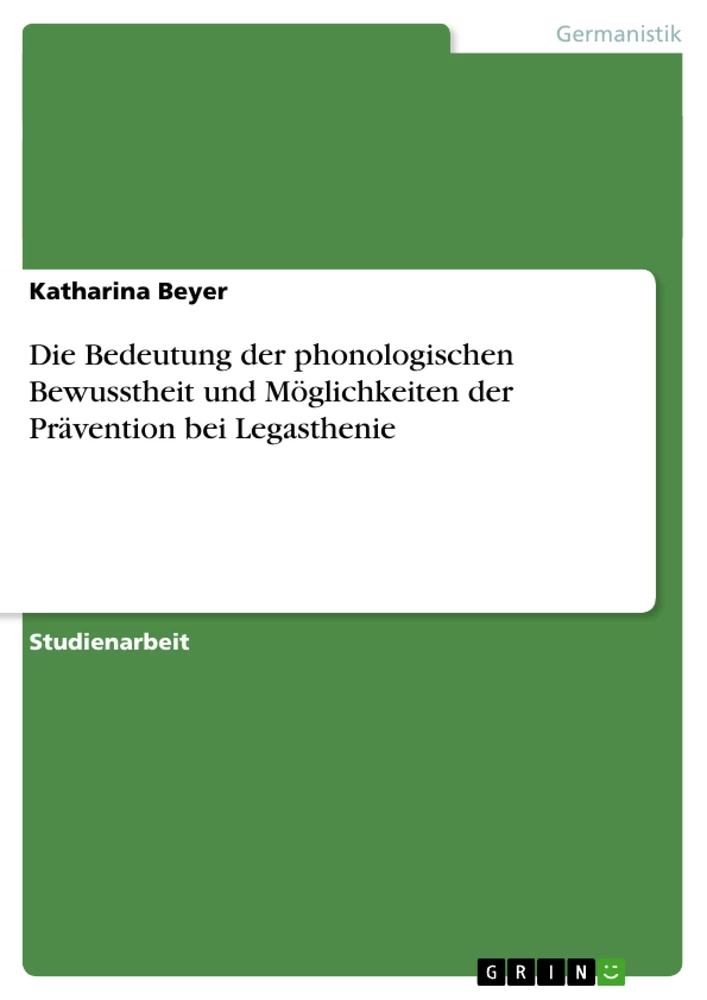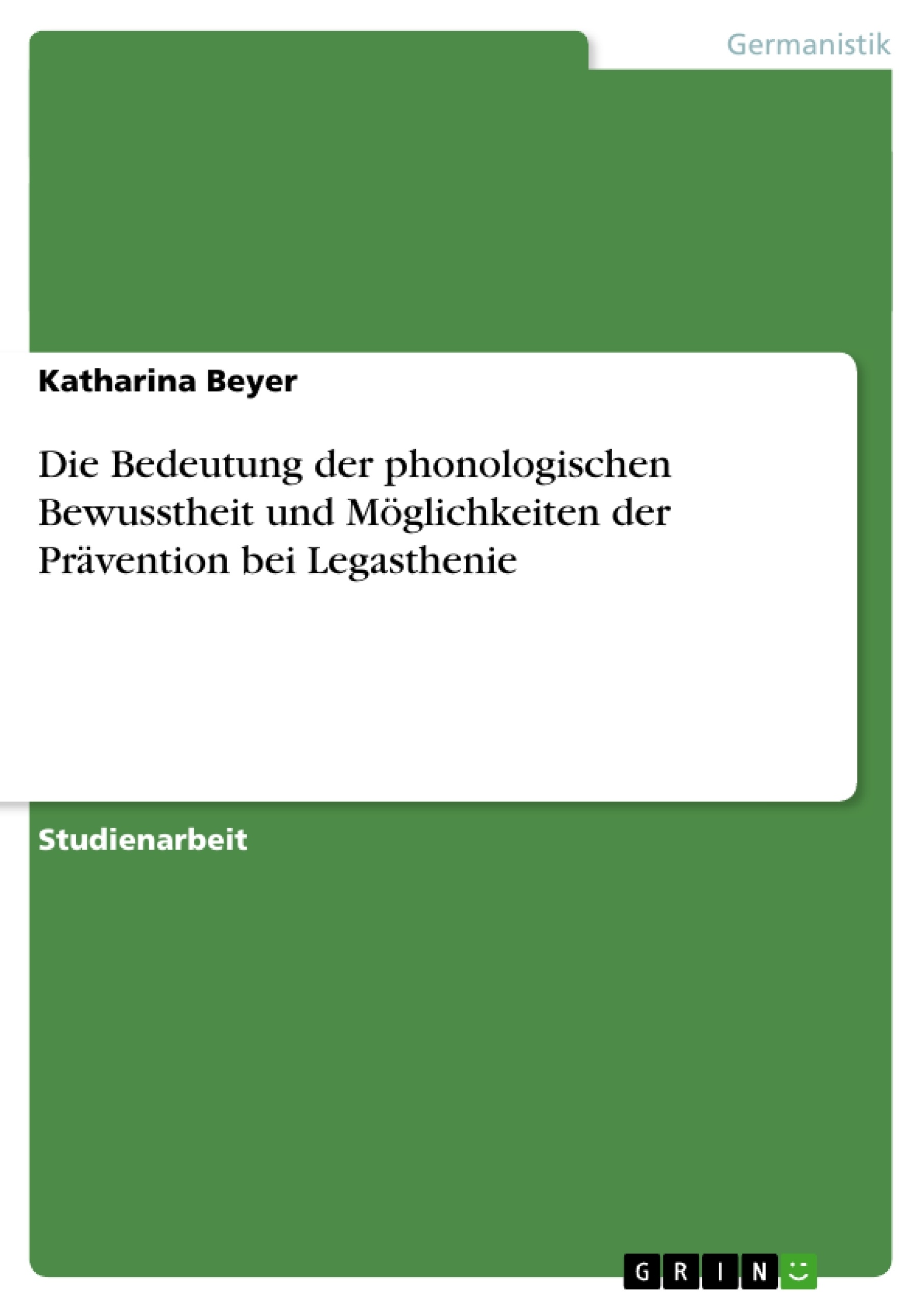Lesen und Schreiben sind in der Gesellschaft des 21. Jh. unabdingbare Fertigkeiten für den Zugang zu Wissen und Bildung, ein erfolgreiches Leben im Beruf und ein soziales Leben in der Gesellschaft. Ohne Schriftsprachkenntnisse werden elementare Aufgaben in Leben und Alltag, wie etwa das Orientieren anhand von Straßenschildern, Lesen von Busfahrplänen, der Erwerb des Führerscheins oder Nutzung von Computern, zu scheinbar unüberwindbaren Hürden, die die Lebensqualität einschränken und bedrohen. Dementsprechend substantiell ist ein erfolgreicher Schriftspracherwerb in der Grundschule, der für gewöhnlich auch ohne größere Schwierigkeiten von Statten geht. Doch nicht jedes Kind erlernt diese Schlüsselkompetenzen problemlos – was geschieht, wenn ein Kind zu den 2- 4 % (Schnitzler 2008, S. VI.) gehört, die mit einem gestörten Schriftspracherwerb kämpfen? Der Druck, der aus einer solchen Situation erwächst, ist für das Kind, die Eltern, Lehrer und Erzieher unermesslich: Der Schulerfolg scheint langfristig gefährdet und eine Lösung dringend nötig.
Blickt man in Ratgeberliteratur für Betroffene oder wissenschaftliche Forschungsliteratur, so taucht ein Begriff häufig im Zusammenhang mit Legasthenie oder LRS auf: die phonologische Bewusstheit. Entsprechend beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit der Bedeutung der phonologischen Bewusstheit und Möglichkeiten der Prävention bei Legasthenie.
Im ersten Kapitel soll die Begrifflichkeit Legasthenie und Lese-Rechtschreib- Schwäche definiert und näher erläutert werden. In Kapitel 2 wird die phonologische Bewusstheit und ihre Auffächerung in verschiedene Teilkompetenzen beleuchtet, die für das weitere Verständnis der Arbeit vonnöten sind. Ferner ist es essentiell, die ungestörte Entwicklung der phonologischen Bewusstheit im Vorschul- und Grundschulalter differenziert zu betrachten (Kapitel 3). In Kapitel 4 werden die Phasen des ungestörten Schriftspracherwerbs nach Frith (1985) und Günther (1986) (Brandenburger 2009, S. 35) erläutert und in ihrer Entwicklung in Zusammenhang mit der phonologischen Bewusstheit betrachtet. Insbesondere der alphabethischen Phase soll hier eine besondere Gewichtung zufallen. In der Forschung ist man sich einig, dass die phonologische Bewusstheit eine wichtige Rolle bei Schriftspracherwerb spielt,
allerdings nicht darüber, welcher Natur dieser Zusammenhang ist. In Kapitel 5 wird die Natur der Beziehung von phonologischer Bewusstheit und (gestörtem) Schriftspracherwerb [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Legasthenie und LRS - Eine Begriffserklärung
- Phonologische Bewusstheit
- Phonologische Bewusstheit i. e. S. und phonologische Bewusstheit i. w. S.
- Teilkomponenten der phonologischen Bewusstheit
- Voraussetzungen für metalinguistische Bewusstheit
- Die Entwicklung der phonologischen Bewusstheit
- Entwicklung im Vorschulalter und am Schulanfang
- Entwicklung im Grundschulalter
- Stufen des ungestörten Schriftspracherwerbs
- Stufen des Schriftspracherwerbs nach Frith und Günther
- Phonologische Bewusstheit und die alphabetische Phase
- Die Natur der Beziehung von phonologischer Bewusstheit und (gestörtem) Schriftspracherwerb
- Die Konsequenz: Förderungskonzepte der phonologischen Bewusstheit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung der phonologischen Bewusstheit für den Schriftspracherwerb und Möglichkeiten der Prävention bei Legasthenie. Sie beleuchtet die Begrifflichkeiten Legasthenie und LRS, analysiert die phonologische Bewusstheit und ihre Entwicklungsphasen, sowie deren Zusammenhang mit dem Schriftspracherwerb. Schließlich werden Förderkonzepte zur Prävention vorgestellt.
- Definition und Abgrenzung von Legasthenie und LRS
- Erläuterung der phonologischen Bewusstheit und ihrer Teilkomponenten
- Entwicklung der phonologischen Bewusstheit im Vorschul- und Grundschulalter
- Zusammenhang zwischen phonologischer Bewusstheit und Schriftspracherwerb
- Fördermöglichkeiten und Präventionskonzepte
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung betont die essentielle Bedeutung von Lese- und Schreibfähigkeiten im 21. Jahrhundert und hebt die Herausforderungen hervor, die ein gestörter Schriftspracherwerb für Kinder, Eltern und Pädagogen darstellt. Sie führt in die Thematik der phonologischen Bewusstheit ein, die im Zentrum der Arbeit steht.
Legasthenie und LRS - Eine Begriffserklärung: Dieses Kapitel differenziert zwischen Legasthenie und Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) anhand der gängigen Diskrepanzdefinition, die auf der Intelligenzleistung basiert. Die Kritik an dieser Definition, insbesondere die Problematik unterschiedlicher IQ-Testergebnisse und die Frage der Homogenität der Gruppen, wird diskutiert. Die Arbeit verwendet die Begriffe im Folgenden synonym.
Phonologische Bewusstheit: Das Kapitel definiert die phonologische Bewusstheit als einen wichtigen Teilbereich der phonologischen Informationsverarbeitung und einen Risikofaktor für Lese-Rechtschreib-Schwächen. Es unterscheidet zwischen phonologischer Bewusstheit im engeren und weiteren Sinne, wobei der Fokus auf dem bewussten Umgang mit den phonologischen Struktureinheiten der Sprache liegt.
Schlüsselwörter
Legasthenie, LRS, Lese-Rechtschreib-Schwäche, phonologische Bewusstheit, Schriftspracherwerb, Prävention, Förderung, metalinguistische Bewusstheit, alphabetische Phase.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Phonologische Bewusstheit und Schriftspracherwerb
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung der phonologischen Bewusstheit für den Schriftspracherwerb und Möglichkeiten der Prävention bei Legasthenie/LRS. Sie analysiert die phonologische Bewusstheit, ihre Entwicklungsphasen und den Zusammenhang mit dem Schriftspracherwerb. Schließlich werden Förderkonzepte zur Prävention vorgestellt.
Was sind Legasthenie und LRS? Wie werden sie in dieser Arbeit definiert?
Die Arbeit differenziert zwischen Legasthenie und Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) anhand der gängigen Diskrepanzdefinition, die auf der Intelligenzleistung basiert. Die Kritik an dieser Definition, insbesondere die Problematik unterschiedlicher IQ-Testergebnisse und die Frage der Homogenität der Gruppen, wird diskutiert. Die Arbeit verwendet die Begriffe im Folgenden synonym.
Was ist phonologische Bewusstheit?
Phonologische Bewusstheit wird als wichtiger Teilbereich der phonologischen Informationsverarbeitung und Risikofaktor für Lese-Rechtschreib-Schwächen definiert. Es wird zwischen phonologischer Bewusstheit im engeren und weiteren Sinne unterschieden, wobei der Fokus auf dem bewussten Umgang mit den phonologischen Struktureinheiten der Sprache liegt.
Wie entwickelt sich die phonologische Bewusstheit?
Die Arbeit beschreibt die Entwicklung der phonologischen Bewusstheit im Vorschul- und Grundschulalter. Sie beleuchtet die Entwicklungsphasen und deren Bedeutung für den Schriftspracherwerb.
Welchen Zusammenhang gibt es zwischen phonologischer Bewusstheit und Schriftspracherwerb?
Die Arbeit untersucht den engen Zusammenhang zwischen phonologischer Bewusstheit und dem Schriftspracherwerb. Sie zeigt auf, wie die phonologische Bewusstheit die alphabetische Phase des Schriftspracherwerbs beeinflusst.
Welche Fördermöglichkeiten und Präventionskonzepte werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt verschiedene Förderkonzepte zur Prävention von Lese-Rechtschreib-Schwächen vor, die auf der Förderung der phonologischen Bewusstheit basieren.
Welche Themen werden in den einzelnen Kapiteln behandelt?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, Begriffserklärungen (Legasthenie/LRS), phonologischer Bewusstheit (inkl. Teilkomponenten und Entwicklung), Stufen des Schriftspracherwerbs, dem Zusammenhang von phonologischer Bewusstheit und Schriftspracherwerb, Förderkonzepten und einem Fazit. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis ist enthalten.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Legasthenie, LRS, Lese-Rechtschreib-Schwäche, phonologische Bewusstheit, Schriftspracherwerb, Prävention, Förderung, metalinguistische Bewusstheit, alphabetische Phase.
- Quote paper
- Katharina Beyer (Author), 2009, Die Bedeutung der phonologischen Bewusstheit und Möglichkeiten der Prävention bei Legasthenie, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/137009