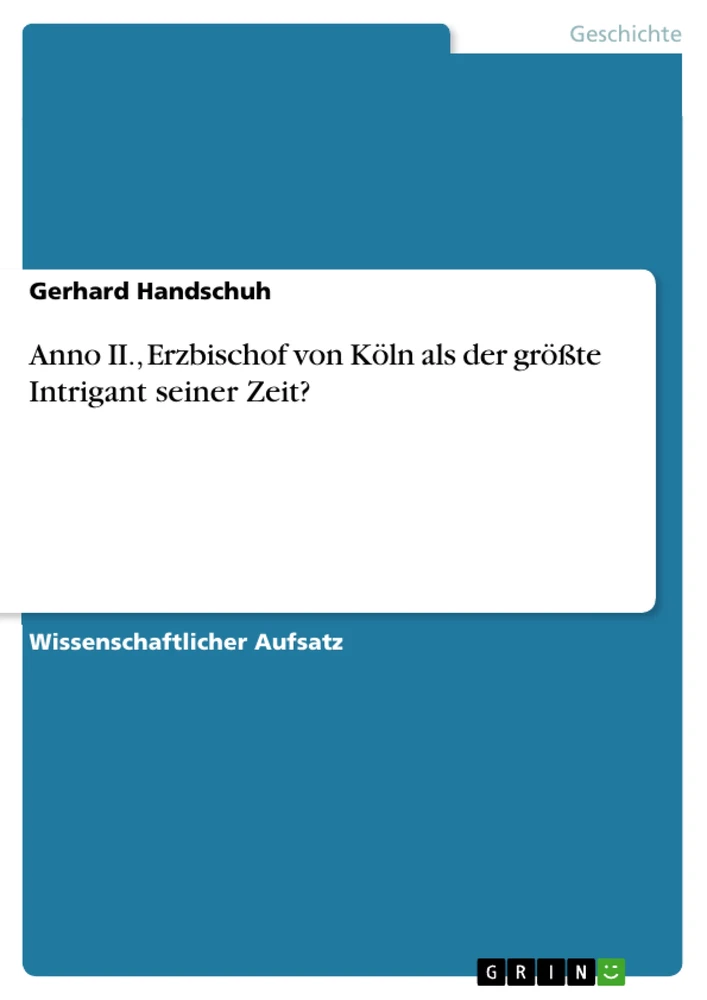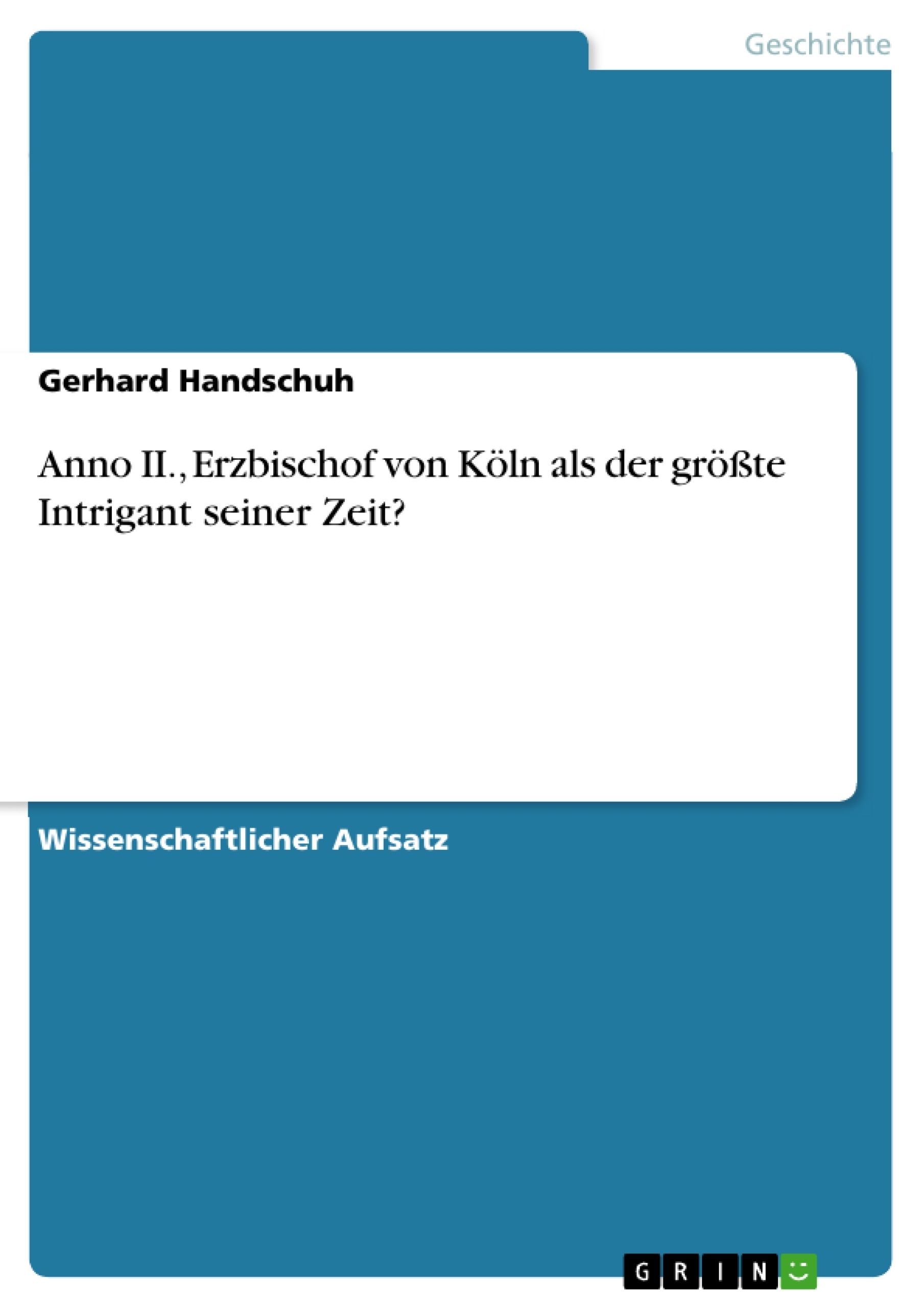Dieser Aufsatz geht der Frage nach, inwiefern Adam von Bremen zu Recht schreiben konnte, Anno sei in allen Verschwörungen seiner Zeit immer der Drahtzieher gewesen. Da die zeitgenössischen Quellen recht spärlich fließen, greift die Untersuchung auch auf Darstellungen und Haltungen der politischen Akteure zu, wo dies angebracht erscheint, um die politische Position Annos, seiner Helfer und deren Handeln klarzumachen.
Inhalt
Die Treffen von Andernach
Zur Chronologie
Zur politischen Bedeutung der Treffen
Zur Schilderung des Hoftags von Kaiserswerth im Frühjahr 1062 und des Hoftags von Tribur im Januar 1066
Zu den Autoren und der neueren Geschichtsschreibung
Zum Hoftag von Kaiserswerth 1062
Zur Motivation des Erzbischofs Anno von Köln als Exponent der Fürstengruppe in Kaiserswerth
Zur Bedeutung der geistlichen und weltlichen Fürsten während der Minderjährigkeit Heinrichs IV.
Zu den Quellen für den Hoftag von Tribur 1066
Die Ereignisse der beiden Hoftage im Vergleich
Literaturverzeichnis
Nimmt man den Magister Adam von Bremen beim Wort, wenn er schreibt: „In allen Intrigen seiner Zeit war er (Anno) außerdem immer der Drahtzieher,“1 dann lohnt es sich, diese Anschuldigung zu untersuchen, weil sie für eine Beurteilung des Kölner Erzbischofs und seine Politik beachtenswert ist. Immerhin handelt Adam von Bremen in seinem Gestenwerk als Zeitgenosse von einem der mächtigsten Bischöfe des 11. Jahrhunderts!
Allerdings mag Adam von Bremen nicht ganz unvoreingenommen gewesen sein, als er diesen Satz in die Gesta seines Erzbischofs Adalbert einfügte. Zu Adams Position muss man berücksichtigen, dass er dieses Urteil nicht in das Widmungsexemplar aufgenommen hat – vermutlich aus Rücksicht auf den neuen Erzbischof Liemar von Hamburg-Bremen, dem er sein Werk widmete und der Anno sowohl kannte, als auch mit ihm am Hof als Anhänger Heinrich IV. zusammenarbeiten musste. Dennoch spiegelt die harsche Kritik an Anno, der zum Zeitpunkt der Übergabe des Widmungsexemplars an Liemar noch am Leben war, die Stimmungslage unter den Bremer Kanonikern. Unvergessen war dort die Vertreibung Erzbischof Adalberts von Hamburg-Bremen vom Hof am Tag von Tribur im Januar 10662 mit all ihren negativen Folgen für das Erzbistum, die zu einer verbitterten Haltung des Domklerus in Bremen gegenüber dem Verursacher des Sturzes ihres Erzbischofs geführt haben mochten.
Dieser Aufsatz geht der Frage nach,3 inwiefern Adam von Bremen zu Recht schreiben konnte, Anno sei in allen Verschwörungen seiner Zeit immer der Drahtzieher gewesen. Da die zeitgenössischen Quellen recht spärlich fließen, greift die Untersuchung auch auf Darstellungen und Haltungen der politischen Akteure zu, wo dies angebracht erscheint um die politische Position Annos, seiner Helfer und deren Handeln klar zu machen.
Nach Gerd Althoff4 ist eine coniuratio - diesen Begriff übersetzt Trillmich mit „Intrige“ -zunächst eine nötige Beratung im kleinen Kreis über einen wichtigen Punkt der Reichspolitik, die der Meinungsbildung dient. Aus solchen coniurationes können Schwurgemeinschaften entstehen, die sich oft mit dem Mittel der Fehde gegen königliche Politik richten oder sie dienen der Sammlung Gleichgesinnter bzw. eines Netzwerkes zur Durchsetzung der eigenen Politik am Hof mit friedlichen Mitteln. Primär sind solche coniurationes ein legitimes und notwendiges Mittel der politischen Meinungsbildung und dienen der Kontrolle der Macht und der Teilhabe der Reichsfürsten an den Reichsgeschäften. Wie sich aus dem Kontext des Eingangszitates ergibt, versteht der Autor den Begriff coniuratio jedoch durchaus negativ, denn er wirft Anno im selben Zusammenhang Treuebruch vor.5 Betrachtet man Annos Reichspolitik, dann fallen hierzu die Andernacher Treffen, der Hoftag von Kaiserswerth im Frühjahr 1062 und die Vertreibung Erzbischof Adalberts von Hamburg-Bremen vom Hof in Tribur 1066 ins Auge. Die nur schlecht belegten Andernacher Treffen lassen auf den ersten Blick den Verdacht von Intrigen aufkommen, weil sich hier geistliche und weltliche lothringische Fürsten zu wenig klaren Verhandlungen zusammenfanden.
Die Treffen von Andernach
Zur Chronologie
Erzbischof Anno von Steußlingen, der von März 1054 an Propst des von Kaiser Heinrich III. gegründeten und bevorzugten Stifts S. Simon und Judas in Goslar war,6 erhielt nach dem Tod Erzbischof Hermanns II. (gest. 11.02.1056) aus dem Hochadelsgeschlecht der Ezzonen aus der Hand des Herrschers Ring und Stab und wurde vermutlich vor dem 03. März 1056 zum Kölner Erzbischof geweiht.7 Bereits kurz darauf nahm der neue Erzbischof am Hoftag in Kaiserswerth teil,8 wo das Erzbistum Köln Güter aus dem Erbe der Königin Richeza von Polen und damit aus dem Eigengut der Ezzonen auf der Basis von Prekarienverträgen erhielt.9 Ende Juni 1056 begab sich Anno zu Hoftagen nach Trier und im September nach Goslar.10
Der unverhoffte Tod Kaiser Heinrichs III. am 05. Oktober 1056 konnte für die Erzdiözese und ihren Erzbischof Anno nicht ohne Konsequenzen bleiben, weil sich die Regentin Kaiserin Agnes für ihren unmündigen Sohn, den schon als Kind gekrönten König Heinrich IV., bei ihrer Vormundschaftsregierung besonders auch auf die Reichsbischöfe stützte. Annos Stellung als Kölner Erzbischof und Erzkanzler für Italien11 bedeutete, dass er nicht nur der Ordinarius einer der bedeutendsten Städte des Reiches nördlich der Alpen war und damit über ein hohes Ansehen und Macht verfügte, sondern auch eine wichtige Kirchenprovinz im Westen des Herrschaftsgebiets der Kaiserin Agnes verwaltete und Ansprechpartner für italienische Verhältnisse war. Schon aus diesen Gründen war an eine permanente Entfremdung von der Reichsregierung nicht zu denken, ohne dass die Kaiserin Schaden für das Reich in Kauf nahm,12 was sie sich nicht leisten konnte, wenn sie für ihren Sohn die Herrschaft erhalten wollte. Vielmehr musste ihre Politik auf Ausgleich und Sicherung der Westgrenze des Reiches bedacht sein.
Wie so häufig im 11. Jahrhundert haben wir nur durch Zufall Nachricht von den beiden Andernacher Treffen, weil die königsfreundliche Iocundi translatio S. Servatii, die wohl um 1088 entstand,13 berichtet, dass die Familie des Heiligen Servatius in Maastricht beabsichtigte, anlässlich dieses Andernacher Fürstentreffens gegen ihren Vogt zu klagen. Das genaue Datum des Treffens ist leider nicht überliefert, doch ging die Forschung bisher davon aus, dass das erste vor dem Hoftag in Köln (5. bis 6. Dezember 1056) stattfand.14 Zu diesem Treffen kamen in Andernach am Rhein, wo die Kölner Kirche einen Hof besaß, Erzbischof Anno mit Erzbischof Eberhard von Trier (1047-1066), Herzog Gottfried dem Bärtigen von Oberlothringen (1048-1069), Pfalzgraf Heinrich (1045 – nach 1063?)15 und anderen nicht namentlich genannten lothringischen Großen zu Verhandlungen mit dem Ziel zusammen, die Minderjährigkeitsregierung der Kaiserin Agnes zu unterstützen.
Die bisherige Chronologie für die Andernacher Treffen beruhte auf den Daten, die durch die Möglichkeit der dortigen Anwesenheit entsprechend dem Itinerar von Pfalzgraf Heinrich und Herzog Gottfried vorgegeben war. Nachdem aber klar ist, dass Pfalzgraf Heinrichs Fehde mit dem Erzbistum Köln 1063 stattfand,16 kann man sein Todesdatum frühestens für 1063 ansetzen, wodurch sich für die Andernacher Treffen das Zeitfenster um drei Jahre erweitert. Dadurch ergibt sich eine neue, sachlich begründete Perspektive für einen an der politischen Lage orientierten Zeitpunkt dieser Zusammenkünfte.
Die Annahme, dass es für Erzbischof Anno nötig erschien, ein zweites Treffen mit den Großen Lothringens nach der Übernahme der Reichsgeschäfte als Regent im Frühjahr 1062 einzuberufen, um den minderjährigen König Heinrich IV. bzw. Anno bei der Regierung zu unterstützen, lässt sich nicht von der Hand weisen. Diesem Datum stünde die ein Jahr später erfolgte Entfremdung Annos und Pfalzgraf Heinrichs nicht entgegen. Denn nachdem Königin Richeza 1063 gestorben und auf Veranlassung Annos in St. Maria ad gradus in Köln bestattet worden war, hatten sich die politischen Verhältnisse am Niederrhein zu Ungunsten des Pfalzgrafen verschoben: Die Begräbniskirche Richezas in Köln und damit die Erzdiözese erhielt das Gut Klotten an der Mosel, Erzbischof Anno konnte über die Vogteirechte Klottens und die Burg Cochem, den Wohnsitz Heinrichs, verfügen. Die Folge war dessen Fehde mit dem Erzbistum, seine Gefangennahme, die Abtretung der Siegburg und sein Tod.17
Von der Sachlogik her würde das zweite Andernacher Treffen kurz nach der Regierungsübernahme Annos im Jahr 1062 gut passen. Das erste Treffen müsste nicht vor, sondern könnte auch nach dem Kölner Hoftag terminiert werden. Zwar hätte ein Treffen vor dem Hoftag sich die Unterstützung und Treue des Oberlothringischen Herzogs versichern und den Hoftag vorbereiten können, aber nach Herzog Gottfrieds offizieller Rehabilitierung durch den Hoftag hätte Anno mehr Rückhalt für sein Anliegen zur Unterstützung der Minderjährigkeitsregierung der Kaiserin Agnes erhalten.
Wenn man den in der Quelle vorgegebenen zeitlichen Abstand von drei Jahren nicht wörtlich nimmt, immerhin schrieb der Autor mehr als 30 Jahre später, wäre daher ein Treffen kurz nach der Wiederaufnahme Herzog Gottfrieds bei Hof und ein zweites kurz nach der Übernahme der Reichsgeschäfte durch Anno im Jahr 1062 durchaus plausibel.
Da die klageführende Maastrichter Delegation im Vorfeld Kenntnis von dem ersten Treffen hatte, kann es sich nicht um eine gegen Heinrich IV. und Agnes gerichtete Intrige oder um eine geheime Zusammenkunft der lothringischen Großen gehandelt haben. Auch ist klar, dass Anno der Einladende war, fand die Zusammenkunft doch auf einem Hof der Kölner Kirche statt. Folglich finden wir Erzbischof Anno hier kurz nach seiner Erhebung in Diensten des Reiches und der Vormundschaftsregierung in einer prominenten Vertrauensstellung tätig.
Zur politischen Bedeutung der Treffen
Die politische Einstellung der Quelle entspricht der dargestellten Haltung und dem Verhalten der genannten Teilnehmer an den beiden Andernacher Treffen:18 Gottfried der Bärtige,19 Herzog von Oberlothringen 1044-1046, wurde nach seinen Fehden von 1045 und 1047, die dazu dienen sollten, seinen Anspruch auf die Herzogswürde auch von Niederlothringen durchzusetzen, auf Betreiben Papst Victors bei dem Hoftag vom 5. und 6. Dezember 1056 in Köln20 wieder in die Gunst Heinrichs IV. aufgenommen. Er kann als Kenner der Verhältnisse am Niederrhein gelten, hatte er doch mit König Heinrich I. von Frankreich und Balduin von Flandern, sowie Hermann von Hennegau und Dietrich von Holland zusammen gegen den Kaiser gekämpft, um seine Rechte auf das Herzogtum Niederlothringen wahrzunehmen. Wollte man die westliche Flanke des Reichsgebiets sichern, dann war er zusammen mit dem ebenfalls in Köln wieder in Gunst aufgenommenen Balduin von Flandern und den Erzbischöfen von Trier und Köln ein wichtiger, weil kenntnisreicher und mächtiger Garant gegen die Bedrohung der Grenze. Während man von dem zweiten Treffen derselben Politiker nur das Faktum selbst weiß, kann man dem ersten bescheinigen, dass es zur Vorbereitung der Zusammenarbeit und Einbeziehung ehemaliger Gegner in die Reichspolitik diente und dass Erzbischof Anno seinen Beitrag dazu leistete.
Eine angemessen ehrende Belohnung für ihre Dienste an der Westgrenze des Reiches erfuhren Erzbischof Eberhard von Trier und Herzog Gottfried im Jahr 1065 anlässlich der Schwertleite König Heinrichs IV. in Worms. Weder die Erzbischöfe Anno von Köln noch Adalbert von Hamburg-Bremen noch der Mainzer Erzbischof Siegfried I., sondern der Erzbischof von Trier war der Zelebrant der kirchlichen Feier, während Herzog Gottfried der Bärtige als Schildträger in herausragender Stellung fungierte und im selben Jahr die Herzogswürde von Niederlothringen erlangte.21 Es ergibt sich damit für die Teilnehmer an der Andernacher Konferenz der lothringischen Großen, dass ihre namentlich genannten Exponenten in der angegebenen Zeit königsnahe Unterstützer der Regentschaft waren. Das trifft besonders auch auf Anno von Köln zu, der sowohl in Andernach als auch bei dem Reichstag in Köln als Gastgeber fungierte.
Zur Schilderung des Hoftags von Kaiserswerth im Frühjahr 1062 und des Hoftags von Tribur im Januar 1066
An diesen beiden jeweils einen Politikwechsel einleitenden und für die Reichsregierung bedeutsamen Ereignissen während der Regierung des jungen Königs Heinrichs IV. war nach unseren Quellen Erzbischof Anno von Köln in herausragender Position beteiligt. Beide Ereignisse kann man als conspirationes im negativen Sinn, als Intrigen oder Verschwörungen bezeichnen.
Lampert von Hersfeld22 erzählt zu den Ereignissen in Kaiserswerth 1062, dass die Fürsten an der Bevorzugung des Bischofs Heinrich II. von Augsburg durch die Kaiserin Agnes Anstoß nahmen. Als Grund der Bevorzugung brachte Lampert sogar „unzüchtige Liebe“ ins Spiel.23 An Maßnahmen der Fürsten, die für Abhilfe dienen sollten, nennt der Autor häufige Zusammenkünfte, Lässigkeit bei der Pflichterfüllung gegenüber der Vormundschaftsregierung, Stimmungsmache gegenüber der Kaiserin sowie vor allem die Absicht der Entmachtung des Augsburger Bischofs Heinrich, den jungen König der Kaiserin zu entziehen und die Verwaltung des Reiches selbst zu übernehmen. Zur Vorbereitung des Ganzen brachte der Kölner Erzbischof Anno ein besonders prächtiges Schiff nach Kaiserswerth24, auf das der junge König gelockt wurde. Nach einem erfolglosen Fluchtversuch brachten ihn die Verschwörer – neben Anno wurden Graf Ekbert und Herzog Otto von Bayern namentlich genannt – nach Köln, wohin der übrige Hof am Ufer folgte. Nach Lampert war die Motivation Annos mehr der persönliche Ehrgeiz als das Beste für das Reich. Selbst für den Autor muss allerdings das Verhalten der Kaiserin verwunderlich gewesen sein, die sich auf ihre Güter zurückzog und der Welt entsagen wollte. Von einem Klostereintritt berichtet Lampert jedenfalls hier nicht.
Auch 1066 hielten nach Lamperts Darstellung die Fürsten unter dem Vorsitz der Erzbischöfe von Mainz und Köln häufig Versammlungen ab,25 um gegen Erzbischof Adalbert von Hamburg-Bremen vorzugehen, der als enger Vertrauter des Königs eine tyrannische Herrschaft anstrebte. Nach dem Autor boykottierten die Bischöfe und weltlichen Fürsten den Königshof, der längere Zeit in Goslar geblieben war, indem sie kaum mehr Lebensmittel lieferten. Sie unterstellten Adalbert, dass er unter Umgehung der Einflussnahme der Fürsten den König isolieren wollte. Das Ziel der Verschwörer war es, bei einem Reichstag in Tribur den König zu zwingen, entweder abzudanken oder seine Freundschaft zum Bremer Erzbischof aufzugeben und ihn seiner Stellung als Mitregent zu entheben.26
Adalberts Vertreibung vom Hof ließ sich auch durch Winkelzüge des Erzbischofs nicht verhindern, doch konnte der König wenigstens Adalberts Sicherheit vorläufig gewährleisten. Lampert schließt seine Darstellung der Ereignisse in Tribur mit den Worten: „So kam die Verwaltung der Staatsgeschäfte wieder an die Bischöfe in der Weise, dass jeder nach der Reihe die Anordnung treffen sollte, die für den König und das Reich erforderlich waren.“27
Anders als Lampert bringt der Codex Laureshamensis die Ereignisse von Tribur 1066 eng mit der Bereicherung Adalberts von Bremen in Verbindung, der von Heinrich IV. die Klöster Corvey und Lorsch zugesagt erhalten hatte.28 Die längere Abwesenheit Adalberts vom Hof in Tribur, um das Kloster Lorsch persönlich in Besitz zu nehmen, verschaffte den Fürsten Zeit, sich einhellig auf die Vertreibung Adalberts vom Hof und aus der Nähe zum König zu verständigen
Zu den Autoren und der neueren Geschichtsschreibung
Die wohl wichtigste erzählerische Quelle für die Hoftage von Kaiserswerth 1062 und Tribur 1066 dürften Lampert von Hersfelds Annalen sein, die 1078/79 verfasst wurden.29 Dass dieser Autor nicht in allen Schilderungen zuverlässig ist,30 ist schon länger ein offenes Geheimnis. Seine Annalen erweisen ihn als einen Gegner Heinrichs IV., der für die Rechte der Fürsten an der Mitregierung des Reiches eintritt, Hofklatsch liebt und auch Beispielerzählungen mit propagandistischem Zweck (exempla) benützt.31 Erzbischof Anno hat Lamperts Sympathie dort, wo er für Klöster und Mönche eintritt sowie in allen Situationen, die geeignet sind, Kritik an Heinrich IV. zu üben.32 Darum ist es erstaunlich, dass Adam von Bremen, einer unserer kenntnisreichsten Autoren für diese Zeit, obwohl er den Kölner Erzbischof sonst auch kritisiert, im Gegensatz zu mehreren anderen Autoren über die Vorgänge auf dem Hoftag in Kaiserswerth im Frühjahr 1062 nichts berichtet. Vermutlich sah er im Verhalten Annos in Kaiserswerth nichts so Verwerfliches, dass es sich gelohnt hätte, den Blick von seinem Erzbistum Hamburg-Bremen auf die Reichsebene abschweifen zu lassen, da sein Erzbischof von den Entwicklungen in Kaiserswerth später profitierte und dem Ziel sowie den Beteiligten dieser conspiratio nahestand.
Anders als Johannes Fried,33 der kein Vertrauen zu Lamperts Schriften hat, urteilt Hans-Werner Goetz34 eher zurückhaltend, wenn er feststellt, dass Lampert die „christlich-monastischen und politischen Werte“ aus der Regierungszeit Heinrich III. schützen möchte. Da Lamperts Annalen eine der Hauptquellen für die Ereignissse in Kaiserswerth und Tribur darstellen, müssen sie trotz ihrer Tendenzen hier herangezogen werden.35
Was die Genauigkeit und Verlässlichkeit unserer Quellen angeht, ist zu bedenken, dass wir außer dem Brief des Petrus Damiani an Erzbischof Anno aus dem Jahr 106336 nur Autoren haben, die mit mehr als zehnjährigem Abstand über die Vorgänge in Kaiserswerth berichten. Anders als Georg Jenal37 nimmt die Forschung heute an, dass die Weissenburger Annalen nicht zeitgleich, sondern um 1075 verfasst sind,38 und dass Benzo von Alba zwischen 1075 und 1084 schrieb,39 während die Fortsetzung der Chronik Hermanns des Lahmen mit den meisten übrigen Quellen zwischen 1076 und 1090 anzusetzen ist.40 So besitzen wir an zeitnahen Informationen nur die kurze wohlwollende Notiz des Petrus Damiani, der Anno von Köln brieflich dazu bewegen wollte, die Papstfrage in Italien zu lösen, nachdem er so viel für Heinrich IV. geleistet hatte: „Du, ehrwürdiger Vater, hast den deinen Händen überlassenen Knaben bewahrt, hast sein Königreich gefestigt, hast dem Waisen das Reich aufgrund väterlichen Rechts wiedergegeben.“41 In diesem Brief ist weder von einer Entführung, noch von einem Staatsstreich oder einem anderen Gewaltakt die Rede, mittels deren sich Anno an die Spitze des Staates putschen wollte, um alleiniger Regent für den noch unmündigen König zu werden.
Wie Mechthild Black-Veldrup42 schon vor Jahren festgestellt hat, fehlte bis vor kurzem eine genauere Untersuchung zur „Entführung“ Heinrichs IV., die immer wieder in der Forschung erwähnt wurde, obwohl die Motive der Tat nicht ausreichend geklärt waren. Während Gerd Althoff von dem Einfluss Annos redet,43 ist Rudolf Schieffer44 vorsichtiger und sieht Anno als Führer einer Gruppe von Reichsbischöfen, die wegen der Papstfrage den jungen König entführten. Tilman Struve vertritt45, Lamprecht folgend, als Motiv Annos für den Königsraub dessen Herrschsucht.
Gerd Althoff geht davon aus, dass die Regenten während der Minderjährigkeit Heinrichs IV. zu informellen und eigenwilligen Praktiken neigten, „mit denen sie Willensbildung im exklusiven Kreis und ohne Beteiligung der Gesamtheit der Fürsten betrieben und dabei den minderjährigen König zum Spielball ihrer Interessen machten.“46 Diese Motivation aus Eigennutz und Herrschsucht bezieht er mit Georg Jenal besonders auf die Ereignisse in Kaiserswerth und Tribur,47 nennt namentlich Kaiserin Agnes und die Erzbischöfe Anno von Köln sowie Adalbert von Hamburg-Bremen. Ferner stellt Althoff fest, dass sowohl geistliche als auch weltliche Fürsten sich durch königliche Schenkungen und Übertragungen ohne allgemeine Beratung bereichert hätten,48 und dass dann die Reaktion der „Gesamtheit“ der Fürsten heftig ausfiel.49
Angesichts der Diversität der Meinungen der Historiker50 über die Motivation Annos und der Fürstengruppe ist es angebracht, sowohl die Ereignisse in Kaiserswerth,51 als auch in Tribur auf die Absichten und Ziele der Politik der Fürsten zu untersuchen. Dabei ist mit einer Multikausalität für den Politikwechsel und Parallelen für beide Hoftage zu rechnen.
Zum Hoftag von Kaiserswerth 1062
Aufgrund der Quellenlage wissen wir leider weder für die Hoftage von Kaiserswerth (1062) noch für Tribur (1066) über die tatsächlichen Vorgespräche, Abläufe und Auseinandersetzungen zwischen den beteiligten Parteien Bescheid. Darum ist hier eine Beschränkung auf Fakten und Ergebnisse angebracht sowie auf die Ziele der Fürsten, insoweit sie überliefert sind, weil sie durchgesetzt werden konnten. Von den augenfälligen Parallelen zwischen beiden Ereignissen könnte man auf Kaiserswerth als Vorlage für Tribur schließen und daher bieten sich Rückschlüsse von Kaiserswerth auf Tribur an.
Wie ihre Ergebnisse zeigen, richtete sich die Kaiserswerther Verschwörung der Fürsten unter Anführung Annos im Frühjahr 1062 gegen den bevorzugten Ratgeber der Kaiserin Agnes, Bischof Heinrich II. von Augsburg und dessen Politik.52 Sie erfolgte in einem Moment der Schwäche des Königtums infolge der Minderjährigkeit des Königs und der Regentschaft der Kaiserin,53 die um ein gottgefälliges Leben führen zu können, den Schleier genommen hatte. Bevor Bischof Heinrich II. als alleiniger Regent für die sich als Folge der Schleiernahme54 aus der Öffentlichkeit zurückziehende Kaiserin eingesetzt werden konnte, zwang die Fürstengruppe um Anno den Augsburger Bischof auf dem Höhepunkt seiner Macht zum Rückzug vom Hof und ermöglichte es Agnes eine Zeit lang auf ihren Gütern ein Gott geweihtes Leben zu führen. Die Bischöfe und weltlichen Fürsten sorgten auf diesem Reichstag in Kaiserswerth für die Möglichkeit einer angemessenen Erziehung des jungen Königs, setzten Anno, - vielleicht sogar mit Zustimmung der Kaiserin - und wenig später auch Erzbischof Adalbert von Hamburg-Bremen zusammen mit Erzbischof Anno von Köln als Regenten ein unter Mitwirkung vor allem der Bischöfe an der Reichsregierung. Die Gruppe um Anno revidierte politischen Fehlentscheidungen Bischof Heinrichs II. von Augsburg wie die Festlegung auf den der Mehrheit der Fürsten nicht genehmen Papst Cadalus55 und veranlasste einen Ungarnfeldzug unter der allgemeinen Leitung Erzbischof Adalberts von Hamburg-Bremen.56 Für diese Art der vorübergehenden Reichsregierung für einen unmündigen König fehlten den Zeitgenossen die adäquaten verfassungsrechtlichen Begriffe, so dass Adam von Bremen Adalbert und Anno als consules bezeichnet,57 während Urkunden nach dem Reichstag von Allstedt im Juni 1063, der Adalbert neben Anno als Regenten einsetzte, Anno magister und Adalbert patronus nennen. Offensichtliches Ziel der Fürstengruppe um Anno war es, dass dieser zunächst in der Funktion eines Regenten die Aufgabe als patronus et magister, später als magister zusammen mit Adalbert von Bremen als patronus Heinrich IV. die Herrschaft erhalten und die Politik Heinrichs III. unter Mitwirkung der Fürsten und dabei vor allem der Bischöfe fortsetzen solle.58
Neben einer Gruppe von in den Quellen nicht namentlich genannten Bischöfe und Fürsten außer Anno waren Graf Ekbert von Braunschweig, Herzog Otto von Bayern und vielleicht Erzbischof Siegfried von Mainz und Herzog Gottfried von Lothringen beteiligt. Mitwisser waren vermutlich Markgraf Dedi und Bischof Gunther von Bamberg.59 Das Vorgehen dieser Fürstengruppe um Anno von Köln richtete sich nicht gegen den jungen König und nicht gegen die Kaiserin Agnes als Regentin, sondern gegen den Bischof Heinrich II. von Augsburg und seine Stellung als Favorit und alleinigen bzw. vorherrschenden Berater der Kaiserin, seine Bereicherung an Reichsgut ohne die Mitwirkung der Fürsten und die Gefahr von einsamen Entscheidungen von allgemeiner Tragweite für das Reich, mit denen die Mehrheit der Fürsten nicht einverstanden war. Dass die Kaiserin Agnes mit dem Ergebnis des Reichstags von Kaiserswerth leben konnte, zeigt sich deutlich daran, dass sie ihren Sohn nicht zurückverlangte, sondern kurze Zeit später an den Hof zurückkehrte und mit Anno und Adalbert zusammenarbeitete.60
Zur Motivation des Erzbischofs Anno von Köln als Exponent der Fürstengruppe in Kaiserswerth
Um das Vorgehen der Fürsten um Anno zu kennzeichnen, sollte man für 1062 nicht von Königsraub, Entführung oder Staatsstreich im heutigen Sinn reden, sondern von einer Übernahme der Erziehung des jungen Königs und der Regentschaft Annos, die so offen gehandhabt wurde, dass er nach kurzer Zeit das Amt als „Doppelspitze“ mit Erzbischof Adalbert, der viel Hof- und Kriegserfahrung hatte, teilen konnte. Dies spricht ebenso gegen den Vorwurf der Herrschsucht Annos wie sein späteres Zurücktreten nach der Schwertleite Heinrichs IV.61
Auch zeugt das von Historikern gern in Frage gestellte Verfahren,62 den Bischof, in dessen Diözese der König sich befand, an der Regelung der Reichsangelegenheiten zu beteiligen, nicht für Herrschsucht der Regenten.63 Adam von Bremen lässt seinen Erzbischof Adalbert als Rechtfertigung für die alleinige Leitung der Staatsgeschäfte selbst sagen „er habe es nicht mitansehen können, dass die Leute seinen Herrn und König wie einen Gefangenen umherzerrten“.64 Offensichtlich bestimmten die Regenten, zu denen Adalbert selbst gehörte, die Reisen des unmündigen Königs, um die Repräsentation des Königs und die Mitwirkung der Bischöfe und Fürsten an der Reichsregierung sowohl allgemein, als auch an Hoftagen zu gewährleisten. Indem Adalbert die königliche Repräsentation nach der Schwertleite einschränkte, hielt er andere Bischöfe und Fürsten vom König möglichst fern und behinderte deren Teilhabe an Beratung und Mitregierung. So verrät uns das Zitat Adams Adalberts politische Intention, alleiniger Berater des Königs zu sein, verweist aber auch auf ein bis zur Schwertleite mehr oder weniger funktionierendes System der Beteiligung mindestens der jeweiligen Ortsbischöfe an den politischen Entscheidungen im Reich.
Bereits 1063 wurde unter Mitwirkung des Erzbischofs Siegfried von Mainz Erzbischof Adalbert von Hamburg-Bremen als Mitregent, zunächst wohl mit eigenem Aufgabenfeld als patronus wegen des Ungarnfeldzugs, anlässlich des Hoftages von Allstedt im Juni 1063 eingesetzt.65 Aber auch wenn unsere Quellen dies nicht ausdrücklich erwähnen, war Anno den Fürsten auf den Hoftagen mit Sicherheit Rechenschaft schuldig. Die Gründe für Adalberts Regierungsbeteiligung dürften sowohl in Misstrauen gegenüber einem Erstarken Annos als auch in einer nötigen Arbeitsteilung zu suchen sein, da Anno 1064 in Italien die Papstfrage lösen sollte, während Adalbert mit dem König einen Ungarnfeldzug unternahm und man jeweils einen Regenten mit den laufenden Aufgaben zur Stabilisierung der Regentschaft nördlich der Alpen benötigte.
Zur Bedeutung der geistlichen und weltlichen Fürsten während der Minderjährigkeit Heinrichs IV.
Nach dem Tod Heinrichs III. (5. Oktober 1056) stand Kaiserin Agnes der Verwandte und Vertraute des Kaisers, Papst Viktor II. (1055-1057), der zugleich Bischof von Eichstätt war, ausgleichend und friedensstiftend zur Seite.66 Mit seinem Eingreifen in die Politik des Reiches schuf er ein Vorbild zur Unterstützung der Regentschaft der Kaiserin Agnes, indem er die Anhänger der Reform unter den Fürsten und die Fortsetzung der Politik Heinrichs III. stärkte. Je weniger stabil die Regentschaft sich später erwies, desto mehr waren die geistlichen und weltlichen Fürsten auf einander angewiesen, wenn sie die Verhältnisse im Reich ausgeglichen halten wollten.67 Dies galt umso mehr, als Papst Viktor II. schon 1057 verstarb und die Kaiserin aufgrund ihrer Berater die Verbindung zur Reform in Rom zu verlieren drohte: Wohl in Abwesenheit des Kölner Erzbischofs und Erzkanzlers für Italien, anerkannte Agnes Ende 1061 in Basel den Bischof Cadalus von Parma als Papst Honorius II., der von den Reformgegnern unterstützt wurde, gegen den schon zuvor in Rom gewählten Reformpapst Alexander II.68 Dass die Regentin bewusst ein Papst-Schisma verursacht hatte, zeigt deutlich, dass Bischof Heinrich II. von Augsburg als ihr erster Berater das königliche Recht der Einsetzung von Päpsten über deren Eignung oder Zugehörigkeit zur Reformbewegung stellte.
Annos Vorrang unter den Fürsten blieb auch nach Kaiserswerth nur „relativ“,69 doch muss man bedenken, dass der Kölner Erzbischof die Würde des Erzkanzlers für Italien innehatte sowie das Recht der Königskrönung in Aachen.70 Neben kirchlichen Privilegien besaß der Kölner Erzbischof die volle Stadtherrschaft in Köln mit all ihren zur Verfügung stehenden Mitteln,71 einer der wichtigsten und größten Städte Europas im 11. Jahrhundert. Allerdings befand sich die Kölner Kirche in ständiger Konkurrenz mit den Trierer und Mainzer Erzbischöfen. Annos Kollegen, Siegfried von Mainz (1060 -1084) und Eberhard von Trier (1047-1066) standen während der Zeit der Minderjährigkeit Heinrichs IV. auf dessen Seite, Eberhard war sogar seit dem Andernacher Treffen mit Anno verbündet. Allerdings geriet Eberhard um 1060 in einer Auseinandersetzung mit Graf Konrad I. von Luxemburg in eine längere Gefangenschaft, aus der er erst durch päpstliche Intervention freikam.72 Über eine Mitwirkung Eberhards in Kaiserswerth im Jahr 1062 ist nichts bekannt. Es ist daher fraglich, ob er anwesend war.
Anders verhält es sich bei Siegfried von Mainz (1060-1084), der von Kaiserin Agnes begünstigt das Amt des Mainzer Erzbischof erhalten hatte und vorher Abt von Fulda gewesen war. Ob Siegfried in Kaiserswerth anwesend war und wie er sich verhielt muss offen bleiben, weil als einzige unserer Quellen der Annalista Saxo ihn erwähnt, der aber hier nicht vertrauenswürdig erscheint.73 Lampert von Hersfeld andererseits vermerkt zum Jahr 1063: „Die Erziehung des Königs und die gesamte Regierung lag in den Händen der Bischöfe, unter ihnen hatten die Erzbischöfe von Mainz und Köln überragenden Einfluss.“74 Daraus folgt, dass Siegfried von Mainz zumindest nach dem Reichstag von Kaiserswerth – wie von einem Erzkanzler für Reichsangelegenheiten nicht anders zu erwarten – Einfluss auf die Regentschaft unter Anno genommen hat. Und wenn Adam von Bremen über den Reichstag von Allstedt schreibt: „ Adalbertus et Anno episcopi consules declarati sunt “,75 dann zeigt seine Ausdrucksweise das Ergebnis von Beratung und Beschlussfassung durch geistliche und weltliche Fürsten, die es für notwendig hielten, dass Anno sowohl entlastet, als auch stärker kontrolliert wurde. Die Darstellung der besonderen Eignung Adalberts für dieses Amt bei Lampert76 verdeckt die Motivation Siegfrieds, sich sowohl von der direkten Verantwortung im innen- und außenpolitischen Bereich als auch der Erziehung des Königs zurück zu ziehen. So erwuchs Anno trotz des Zurücktretens des Mainzer und des Trierer Erzbischofs von 1063 an in Adalbert von Hamburg-Bremen ein nicht zu unterschätzender Rivale, der seinen Einfluss und seine Macht beschränkte.
Für den Kölner Erzbischof als Exponent der mit der Politik des Bischofs Heinrichs II. von Augsburg unzufriedenen Fürstengruppe in Kaiserswerth war von besonderer Bedeutung, dass er als Kanzler für Italien das Schisma aufzulösen und die Verbindung zur Reformpartei im Sinne Heinrichs III. herzustellen bestrebt war. Als ehemaliger magister scholarum war er in besonderer Weise dazu geeignet, für die Erziehung des jungen Königs zu sorgen. Auch war und blieb er als höchstrangiger Erzbischof ein Schwergewicht bei der Beratung des Königs, nicht zuletzt wegen seiner guten Vernetzung im Episkopat und mit den weltlichen Fürsten, was ihm sowohl Zuneigung als auch Ablehnung einbrachte, wie sich in den erzählenden Quellen zeigt.77 Triebfeder seines Handelns waren Treue zu Heinrich III. und seiner Politik, Pflichtgefühl gegenüber der Regentschaft der Kaiserin, dem jungen König Heinrich IV. und den Reichsangelegenheiten. Zu einer gelungenen königlichen Reichsverwaltung gehörte die Teilhabe der geistlichen und weltlichen Fürsten an den Entscheidungen des Königs, um Frieden, Recht und Ordnung im Reich zu gewährleisten. Angesichts der Belastungen, die das Amt eines Regenten mit sich brachte, sollte man weniger die negativ besetzte Herrschsucht als vielmehr die besondere Position als Kölner Erzbischof, die Verantwortung und die Eignung Annos als Motivation annehmen.
Die auffallend häufige Erwähnung der Bischöfe in der Historiographie während der Zeit der Regentschaft dürfte für die geistlichen Autoren des 11. Jahrhunderts in dem Wissen begründet sein, dass es zu den Aufgaben eines Bischofs aufgrund der christlich-antiken Wurzel ihres Amtes gehörte,78 die Armen, Witwen und Waisen zu schützen.79 In dieser Schutzpflicht lag eine Amtspflicht der Bischöfe, neben die auch die Verpflichtung als Lehensträger des Königs trat. Die Bildung und Förderung hervorragender Kleriker in der Hofkapelle, besonders aber die Auswahl und Nähe zum König weisen auf besondere Eignung zur Verwaltung hin. Adam von Bremen ist sich dieser Aufgabe des Bischofs bewusst, denn er bescheinigt seinem Erzbischof Adalbert Liebe zum Reich80 als Pflicht und Treue bis zum Tod.81 Man wird nicht fehlgehen, wenn man auch Anno Treue zu Heinrich III. und seinem Erben und Liebe zum Reich zugesteht, ebenso wie den Schutz und die bestmögliche Erziehung des unmündigen Königs.
Offensichtlich war es die Meinung der weltlichen Großen, dass ein unverheirateter Regent als Vertreter des Königs auf Zeit, auch angesichts seiner Bildung und Bindung an das Königshaus ein besserer Reichsverweser war als ein hoher Adliger, der für seine Familie und Hausmacht sorgen musste. Dies resultierte in der Macht der Kirche in der Zeit der salischen Reform, die im Bewusstsein des hohen Adels verankert war. In ihren Augen hat Anno in Kaiserswerth keine Intrige, keine Verschwörung zum Bösen oder zur Alleinherrschaft angezettelt und durchgeführt, sondern er hat im Sinne einer starken Gruppe von Großen im Reich82 und vermutlich auch zumindest zum Teil im Sinne der Kaiserin das Amt eines Regenten auf sich genommen und Reichspolitik im Sinne dieser Gruppe ausgeübt. Als ehemaliger magister scholarum in Bamberg war Anno in den Augen des Hofes bestens geeignet, die Erziehung des jungen Königs zu übernehmen.
Zu den Quellen für den Hoftag von Tribur 1066
Vier Jahre später hatte sich eine ähnlich krisenhafte Situation in der Reichsregierung dadurch ergeben, dass Erzbischof Adalbert von Hamburg-Bremen in die Position des alleinigen Ratgebers und Favoriten des nun mündigen jungen Königs eingetreten war. Die Großen des Reiches hielten daher die Zeit für gekommen, erneut unter Führung Annos, Fehlentwicklungen, die in ihren Augen eingetreten waren, zu stoppen. Nach unseren Quellen forderte die Fürstenopposition ultimativ die Entfernung Adalberts vom Hof oder den Rücktritt des Königs, und damit hätte die Form der Regierung mit dem König und seinen Beratern aus dem Hochadel den Zustand der Reichsregierung unter Heinrich III. widergespiegelt. Das Ergebnis dieses Eingreifens der Fürsten in die königliche Politik bedeutete zwar für kurze Zeit eine Stärkung der Macht Annos und die Teilhabe von mehr Fürsten an der Beratung, auf längere Sicht jedoch die Abwendung Heinrichs IV. von den Weggefährten der Minderjährigkeitsregierung.83
Für die Absetzung und Vertreibung Adalberts im Jahre 1066 stehen uns hauptsächlich drei zeitgenössische Autoren zur Verfügung,84 die allerdings mehr als 10 Jahre nach dem Ereignis über Erzbischof Adalberts Vertreibung vom Hof informieren. Zunächst zu nennen wären dabei Lampert von Hersfelds Annalen zum Jahr 1066,85 die von Verweigerung der Abgaben für den Hof in Goslar berichten, von Adalbert auf der Höhe seiner Macht, der an der Seite des Königs dort trotz des Mangels an Nahrungsmitteln durchhält, um nicht an einem anderen Ort im Reich Macht an einen Bischof oder Adligen abgeben zu müssen.86 Als Anführer der Verschwörung sieht Lampert die Erzbischöfe von Mainz und Köln,87 die nach Lampert den Reichstag von Tribur einberufen,88 bei dem Adalbert aus dem Rat des Königs und aus seiner Umgebung entfernt werden sollte. Bedeutsam ist Lamperts hier mit Genugtuung wiederholter Verweis auf eine in seinen Augen richtig funktionierende Reichsregierung, bei der die Bischöfe, je nachdem in welchem Bistum der König sich aufhielt, bei Anordnungen für das Reich gehört werden sollten.89
Anders als Lampert war Adam von Bremen über die Vorgänge in Tribur wohl bestens informiert, war er doch zwischen Mai 1066 und April 1067 und damit kurz nach der Vertreibung Adalberts vom Hof nach Bremen gekommen und hatte das Unglück der Hamburg-Bremer Kirche nach dem Sturz des Erzbischofs miterlebt.90 Es lag jedoch nicht im Interesse seiner Gesta Hammaburgensis ecclesiae Pontificum seinen Erzbischof allzu sehr zu kritisieren und über solche ihm unangenehmen Vorgänge der Reichspolitik und im Detail die Fehler Adalberts zu berichten.91 Auch schreibt Adam bewusst selektiv, wenn es um Fakten geht, die er für die Hamburger Kirche für schädlich hält.92
Eng verbunden mit dem Sturz Adalberts ist laut dem Codex Laureshamensis die maßlose Bereicherung, die der Erzbischof auf Kosten des Reiches in Form von Übertragungen der Reichsabteien Corvey und Lorsch an die Hamburg-Bremer Kirche geplant hatte,93 die Hinhaltetaktik des Abtes Udalrich und die Abwehr durch die Vasallen und Ministerialen des Klosters. Adalberts wohl längere Abwesenheit von Tribur um Kloster Lorsch selbst in Besitz zu nehmen ermöglichte es nach dem Codex Laureshamensis den Verschwörern, sich auf ein Vorgehen gegen Adalbert zu einigen.
Die Unterschiede in der Darstellung der Ereignisse in Tribur 1066 zwischen Lamperts Annalen und dem Codex Laureshamensis legen es nahe, die Glaubwürdigkeit der beiden Quelle zu überprüfen. Wie bereits Hans Delbrück festgestellt hat,94 ist Lamperts Darstellung der Ereignisse am Hof 1065/1066 nicht in allen Punkten zuverlässig. Das weist er sowohl für die Behauptung, Adalbert habe den König isolieren wollen nach, dem er die Aufenthalte vor Weihnachten 1065 in Sachsen und die Besuche des Hofes durch Fürsten gegenüberstellt.95 Die Notlage des Hofes erscheint in Anbetracht der Reisen in Sachsen und nach Mainz übertrieben, die frühe Ankündigung des Ultimatums der Fürsten bereits in Goslar klingt angesichts der Überraschung durch die Fürsten in Tribur unlogisch, ebenso wie der eilige Aufbruch des Königs, der in Ingelheim und Mainz Station machte. So entfällt das Überraschungsmoment in Tribur in Lamperts Darstellung.96 Das Streben nach dem Besitz der beiden reichen Abteien Corvey und Lorsch und die Position als alleiniger Berater des Königs reichen Lampert als Begründung der Vertreibung Adalberts vom Hof.
Näher an den tatsächlichen Ereignissen ist der Codex Laureshamensis, der behauptet, Adalberts Abwesenheit vom Hof habe den Fürsten Zeit verschafft, sich auf dessen Vertreibung zu verständigen. Der Widerstand des Abtes Udalrich von Lorsch,97 der zum Scheitern Adalberts beitrug, fand seine Belohnung im Jahr 1067,98 als Heinrich dem Kloster Schutz, Immunität und freie Abtswahl beurkundete.
Die Ereignisse der beiden Hoftage im Vergleich
Vergleicht man beide Quellen muss man feststellen, dass Lampert über die Vorgänge des Jahresendes 1056 in Sachsen nichts Verlässliches erzählt, über Tribur nur den Ort des Reichstags und die Entmachtung Adalberts und sein Entkommen mit Sicherheit zu berichten weiß. Der Rest der Erzählung gehört in das Reich der Fabel. Demgegenüber wissen die aufständischen Lorscher Mönche bedeutend wichtigere Tatsachen zu berichten.
Für beide Ereignisse, sowohl für Kaiserswerth 1062 als auch Tribur 1066, bieten sich schon auf den ersten Blick eine ganze Anzahl von Parallelen: Beide fallen in die Zeit der Regierung für den minderjährigen bzw. gerade mündig gewordenen König Heinrich IV., in beiden Fällen wird Anno als Drahtzieher der Intrigen genannt, in beiden Fällen wird ein bevorzugter Ratgeber bzw. ein Favorit gestürzt. In beiden Fällen war avaritia des Favoriten wenn möglich zu stoppen oder rückgängig zu machen, gab es innen- und italienpolitische Divergenzen. Neben dem Cadalus-Schisma stand in der Italienpolitik der Romzug Heinrichs IV. an, innenpolitisch das Emporkommen eines einzelnen Beraters und eventuell die Bevorzugung Erzbischof Adalberts bei Königlichen Schenkungen. Dies bezog sich auf Heinrich II. von Augsburg und Adalbert gleichermaßen. In beiden Fällen war die Hofintrige erfolgreich und Anno von Köln, wenn auch vielleicht nicht auf lange Sicht, der bevorzugte Nutznießer. In beiden Fällen ging der Erzbischof nicht allein, sondern zusammen mit einer Gruppe von geistlichen und weltlichen Reichsfürsten vor.
Ein genauerer Vergleich der beiden Ereignisse von Kaiserswerth 1062 und Tribur im Januar 1066 soll zeigen, ob die Beurteilung der zeitgenössischen Literatur des 11. Jahrhunderts und der Geschichtswissenschaft gerechtfertigt ist. Man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass während der Jahre der Minderjährigkeit Heinrichs IV. und bis 1066 wichtige Weichenstellungen für Reichsverfassung und Regierungsaktivitäten sowie Kontrolle der Macht, Allein- und Mitregierung vor allem hinsichtlich der Beratung und des Konsenses für ein geschwächtes Königtum erfolgten.99 Historisch greifbar wird die Unzufriedenheit mit der politischen Entwicklung und die Entschlossenheit der Fürsten bzw. einer starken Gruppe von ihnen zu einer Veränderung der Politik besonders deutlich in den Vorgängen auf den Fürstentagen in Kaiserswerth 1062 und in Tribur 1066. Zu dieser Gruppe gehörten die Erzbischöfe von Mainz, Köln, und wohl auch Trier,100 Salzburg und Hamburg-Bremen sowie, Fürsten wie Herzog Otto von Bayern, Gottfried von Oberlothringen und Markgraf Ekbert, der mit dem salischen Herrscherhaus verwandt war.101 In Kaiserswerth waren es neben Anno die in den Quellen genannten Herzöge Otto von Bayern, Rudolf von Schwaben, Berthold von Kärnten und Gottfried von Oberlothringen.102
Die Kontrolle der Macht, die die Reichsfürsten im 11. Jahrhundert ausübten und die in deren Teilhabe und Zustimmung zu bedeutenden Akten des Herrschers sowie dessen Beratung kulminierte, war während der Minderjährigkeit Heinrichs IV. gefährdet, wenn die Kaiserin Agnes als Regentin wegen der Schleiernahme nicht mehr öffentlich auftreten konnte und so eine Staatskrise anstand oder wenn ein einzelner Berater, in der Regel ein Bischof, die anderen Reichsfürsten aus dem Vertrauen des Königs verdrängte. Dies betrachteten die Reichsfürsten als Machtmissbrauch und eine Verletzung nicht nur ihrer Rechte der Mitwirkung an Entscheidungen, sondern auch Einbuße an Macht und Schmälerung ihres Ansehens, eine Verletzung ihres Stolzes, Selbstbewusstseins und ihrer Würde. Sowohl im Jahr 1062 als auch im Jahr 1066 attestieren die Quellen einen solchen Zustand der Regierung, da die Kaiserin Agnes ihren bevorzugten oder alleinigen Berater in Heinrich II. von Augsburg gefunden hatte, König Heinrich IV. im Jahr 1066 in Erzbischof Adalbert von Hamburg-Bremen. Ganz offensichtlich betrachteten die Fürsten während der Minderjährigkeit und der Anfangszeit der selbständigen Regierung Heinrichs IV. eine solche Konstellation der Entscheidungen und der damit verbundenen Macht als einen Missstand, gegen den man mehrheitlich entschlossen vorgehen musste.
Zwar erwarteten die Fürsten für ihre treue Unterstützung der königlichen Politik auch entsprechende Belohnungen,103 doch sollten sich diese in einem vom Hof akzeptierten Rahmen halten. Sowohl in Kaiserswerth als auch in Tribur gingen die Fürsten gegen den Nutznießer des Missbrauchs dieser Regel vor, besonders da Adalbert mit seinem Anspruch auf die Klöster Corvey und Lorsch weit über das Erträgliche hinausgegangen war. Aus seiner Position ist der Zugriff auf diese beiden sehr reichen Reichsklöster verständlich, weil er sein Erzbistum angesichts der Gefährdung durch den Dänenkönig, der ein eigenes Erzbistum anstrebte, auf Dauer zumindest finanziell abgesichert hätte. Das rasche Kassieren der königlichen Schenkung von Lorsch nach seinem Sturz zeigt die deutliche Durchsetzung der Macht der Fürsten gegenüber Adalbert und wohl auch dem König,104 wohingegen die anderen Fürsten die ihnen übertragenen Reichsabteien wenigstens vorläufig behalten und auch Heinrich von Augsburg nach Kaiserswerth seine Schenkungen behaupten konnte. Autokratisches Vorgehen, auch wenn es nur ansatzweise erfolgte, wurde offensichtlich von den Fürsten abgelehnt und je nach dem Grad seiner Ausführung unterschiedlich geahndet. Die Fürsten bewiesen nicht nur, dass ihnen an Beratung und Hilfe für den König lag, sondern auch an Verantwortung für das Reich und eigener realer Macht als Kontrollinstanz der Politik.
Die das Vorgehen der Fürsten auslösenden Elemente waren bei beiden Ereignissen weitgehend parallel gelagert. Der Frage der Lösung des Schismas entsprach in etwa der Forderung bzw. Ablehnung eines Romzugs des Königs, denn beides sollte auch der Stärkung der Reformpartei und des Reiches dienen. Auch die Gefährdung durch die Ungarn und Unordnung im Reich bzw. innere Sicherheit waren in beiden Fällen problematisch.
Anders als der Sturz Heinrichs von Augsburg gestaltete sich der Adalberts: Er konnte sich trotz der Bemühungen des Königs nicht gegen eine starke Opposition am Hof halten und musste Tribur in unrühmlicher Weise verlassen. Trotz seiner unbestreitbaren Verdienste als Regent musste er seine hervorragende politische und wirtschaftliche Position aufgeben, auf der Flucht außerhalb seiner Diözese Zuflucht suchen und machtlos mitansehen, wie die sächsischen Billunger und die Slawen sein Erzbistum verwüsteten. Der Grund für diese weitgehende Entmachtung lag vermutlich nicht nur in den oben genannten Missständen und der persönlichen Feindschaft der Adligen, auch nicht allein im Verlust des Schutzes durch den König, sondern wohl in einem weiteren politischen Vorhaben, das den Fürsten so unangenehm war, dass sie zu der heftigen Maßnahme der Vertreibung Adalberts vom Hof griffen: Als neues wirtschaftliches Element traten nach der Mündigkeit Heinrichs IV. die von Adalbert beabsichtigten Revindikationen hinzu, die Adam von Bremen erwähnt.105 Denn durch die Minderjährigkeitsregierung, die eine Schwächung der Reichsgewalt bedeutete, und die Vergabe so vieler Reichklöster waren die Einkünfte des Königs geschwächt. Er musste daher für einen Ausgleich sorgen, wenn die Zentralgewalt nicht auf Dauer geschwächt bleiben sollte.
Man kann dieses von der Forschung nicht ernst genug genommene Element der Reichspolitik Adalberts nicht mit der „Aneignung reichsunmittelbarer Abteien“ gleichsetzen,106 denn selbstverständlich war eine Rücknahme der sorgfältig geplanten Verteilung von 12 Abteien an die Fürsten nicht im Sinne Adalberts, der sich damit selbst geschadet hätte. Wenn man mit Hubertus Seibert annimmt, dass die Vergabe der Klöster an die Fürsten auch von Heinrich IV. ausging107 und dass der König Adalberts Politik zunächst erfolgreich fortsetzte, dann erklärt die heftige Reaktion des Lorscher Klosters die Ereignisse von Tribur nicht vollständig, an denen auch die Nutznießer der Klostervergabe beteiligt waren. Vielmehr wären als Grund für eine „alle“ Fürsten einigende Politik gegen Adalbert solche Revindikationen leicht denkbar, weil sie viele Fürsten betroffen hätten.108 Nach Adam von Bremens etwas hochfliegender Darstellung sollten um das Ziel ein goldenes Zeitalter zu erreichen alle Rechtsbrecher, Feinde des Königs und alle, die Kirchen ausgeraubt hätten, aus dem Reich Gottes ausgetilgt werden.109 Da sich fast alle Bischöfe und Großen des Reiches dieses Verbrechens schuldig gemacht hätten, führte dies nach Adam von Bremen zum einmütigen Hass der Fürsten mit der Konsequenz,“ut ille (solus) periret, ne ceteri periclitarentur“. 110 Es handelt sich bei beiden Ereignissen, die ein kraftvolles Eingreifen in die Reichspolitik durch die Fürsten herausforderten, jedenfalls nicht um ein monokausal begründetes Vorgehen, sondern um ein ganzes Bündel von Gründen und Befürchtungen im Lager der Fürsten.
Kraft seiner Stellung als Kölner Metropolit besaß Anno ein besonderes Gewicht im Rat, einen Vorrang, und ragte relativ aus den Großen des Reiches heraus, aber er war auch aufgrund seines ausgeprägten Netzwerkes unter den Bischöfen und Fürsten durch Verwandtschaft, Freundschaften und Lehensvergaben klug genug, das System der gemeinsamen Kontrolle zu nützen und keine Alleingänge zu versuchen. Dass Anno auch als Politiker Hervorragendes in einer Notsituation für König und Reich geleistet hat, steht außer Zweifel. Sein Ideal einer Reichsregierung entsprach dem Vorbild der Zeit Heinrichs III. Wann immer er dieses durch das Emporkommen eines Favoriten und damit die Teilhabe der Fürsten an der Macht und wichtigen Entscheidungen gefährdet sah, sah er sich verpflichtet, in einer führenden Position einzugreifen und Verantwortung für das Reich zu übernehmen. Adams Vorwurf, Anno sei in allen Intrigen seiner Zeit immer der Drahtzieher gewesen, sollte man daher als emotionalen Hamburger Vorwurf wegen der Vertreibung Adalberts und deren Folgen verstehen, der aus Hamburger Sicht zwar verständlich sein mag, aber einer Überprüfung nicht standhält.
Literaturverzeichnis:
Quellen:
ADAMI Bremensis Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum ed. B. Schmeidler MG i.u.schol. Hannover, Leipzig 1917. Dt. Übersetzung von Werner Trillmich in: Quellen des 9.und 11. Jahrhunderts zur Geschichte der Hamburgischen Kirche und des Reiches. Darmstadt 1968.
CODEX LAURESHAMENSIS ed. Karl Glöckner (Arbeiten der historischen Kommission für den Volksstaat Hessen, 1) Darmstadt 1929.
Die Briefe des Petrus DAMIANI ed. Kurt Reindel. In: MGH Briefe der dt. Kaiserzeit, 4,3. Nr.99. Petrus Damiani an Erzbischof Anno von Köln. Juni 1063.
LAMPERTI Monachi Hersfeldensis Opera, MGH SS. in us.schol., ed. Oswald Holder-Egger, Hannover/Leipzig. 1894. Frh. v. Stein-Gedächtnisausgabe Bd. XIII, Darmstadt 2011.
Die Regesten der Erzbischöfe von BREMEN, bearb. Otto Heinrich May, (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für die Provinz Hannover, Oldenburg, Braunschweig, Schaumburg-Lippe und Bremen. 11), Hannover 1928 Bd. I (787-1306).
Die Regesten der Erzbischöfe von KÖLN im Mittelalter, Bd. 1 (313-1099), bearb. von Friedrich Wilhelm Oediger, Publikationen der Ges. f. Rhein. Geschichtskunde, Bd. 21,. Düsseldorf 1978. (Nachdruck der Ausgabe Bonn 1954-1961.)
Ausgewählte SYNODEN Galliens und des merowingischen Frankenreichs, Sebastian Scholz, (HG), Freiherr-vom-Stein-Gedächtnisausgabe, Bd. 56, Darmstadt 2022.
Iucundi translatio S. SERVATII, ed. R. Koepke, MGH SS 12, 1856, S. 88-125.
Literatur:
ALTHOFF, Gerd: Kontrolle der Macht. Formen und Regeln politischer Beratung im Mittelalter, Darmstadt 2016.
DERS.: Heinrich IV. In: Heinrich IV. Vorträge und Forschungen, HG. DERS.: Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte Bd. LXIX, Ostfildern 2009.
DERS.: Die letzten Salier im Urteil ihrer Zeitgenossen, in: Christoph Stiegeman/Matthias Wemhoff (HG): Canossa 1077. Erschütterung der Welt. Geschichte, Kunst und Kultur am Aufgang der Romanik. Bd. I. Essays, München 2006.
DERS.: Heinrich IV. Gestalten des Mittelalters und der Renaissance. HG. Peter Herde, Darmstadt 2006.
DERS.: Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und Fehde. Darmstadt, 1997.
BLACK-VELTRUP, Mechthild: Kaiserin Agnes (1043-1077), Köln 1995.
DELBRÜCK, Hans: Über die Glaubwürdigkeit Lamberts von Hersfeld, Diss. Bonn 1878. Nachdruck: Forgotten Books, London 2018.
DESPY, Georges: G.III. der Bärtige, In: Lexikon des Mittelalters, Bd. VI, München 2003, Sp. 1601.
FRECH, Gustl: Die deutschen Päpste - Kontinuität und Wandel. In: Stefan Weinfurter und Martin Siefarth, In: Die Salier und das Reich, Bd. III, Sigmaringen 1992.
FRIED, Johannes: Canossa. Entlarvung einer Legende. Eine Streitschrift, Berlin 2012.
GIESEBRECHT, Wilhelm v.: Geschichte der dt. Kaiserzeit, Bd. 3, Braunschweig 1869. Reprint 2018.
GOETZ, Hans-Werner: Der Investiturstreit in der deutschen Geschichtsschreibung von Lampert von Hersfeld bis Otto von Freising, in: Christoph Stiegemann/Matthias Wemhoff (HG.): Canossa 1077. Erschütterung der Welt, Bd. 1, Essays, München 2006.
HANDSCHUH, Gerhard Peter: „Der Kölner, den man der Habsucht zieh, …“ Erzbischof Anno II. von Köln, Königin Richeza von Polen und das Erbe der Ezzonen. In: Geschichte in Köln Bd. 66, 2019.
DERS.: Body Snatching, Königsraub oder Staatsstreich? Die Entführung König Heinrichs IV. in Kaiserswerth: Der Versuch einer Rekonstruktion. In: Geschichte in Köln, Bd. 63, 2016.
JARETZKI, Thies Siebet: Die Vorstellungen vom Bischofsamt bei Adam von Bremen. Arbeiten zur Kirchen- und Theologiegeschichte Bd. 42. Leipzig 2014.
JENAL, Georg: Erzbischof Anno II. von Köln (1056-1075) und sein politisches Wirken. Ein Beitrag zur Geschichte der Reichs- und Territorialpolitik im 11. Jahrhundert. In: Monographien zur Geschichte des Mittelalters. HG. Karl Bosl und Friedrich Prinz, Bd. 8.I, 1974 und Bd. 8.II, 1975.
KARPF, Ernst: Ekbert. In: Lexikon des Mittelalters, München 2002. Bd. 3, Sp. 1761.
MEYER VON KNONAU, Gerold: Jahrbücher des deutschen Reiches unter Heinrich IV. und Heinrich V., Bd. 1, 1056 bis 1069, Leipzig 1890, Reprint 2018.
SCHIEFFER, Rudolf: Das Reformpapsttum seit 1046, in: Stiegemann/Wemhoff: Das Reformpapsttum seit 1046 (HG.): Canossa 1077. Erschütterung der Welt, Bd. 1, Essays, München 2006.
DERS.: Erzbischöfe und Kirche von Köln. In: Stefan Weinfurter und Frank Martin Siefarth (Hg): Die Salier und das Reich, Bd. II, Sigmaringen 1992.
SCHMIDT-WIEGAND, Ruth: Schutz, -herrschaft. In: Lexikon des Mittelalters,München 2003, Bd. VII, Sp. 1594f.
SEIBERT, Hubertus: Geld, Gehorsam, Gerechtigkeit, Gebet. Heinrich IV. und die Mönche. In: Gerd Althoff (HG), Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte Bd. LXIX, Ostfildern 2009, S. 308-315.
STRUVE, Tilmann: Die Entführung Heinrichs IV. in Kaiserswerth in bildlichen Darstellungen. Konstituierung eines Geschichtsbildes. In: DERS.: (HG). Die Salier, das Reich und der Niederrhein, Köln 2008.
DERS.: Lampert von Hersfeld,der Königsraub von Kaiserswerth im Jahr 1062 und die Erinnerungskultur des 19. Jahrhunderts, in: Archiv für Kulturgeschichte 88, 2006.
DERS.: Eberhard von Trier. In: Lexikon des Mittelalters, München 2003, Sp. 1322f.
DERS.: Persönlichkeit und Weltbild eines Geschichtsschreibers am Beginn des Investiturstreits. In: Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte 19, Marburg 1969 und 20, Marburg 1970.
VOLLRATH, Hanna: Konfliktwahrnehmung und Konfliktdarstellung in erzählenden Quellen des 11. Jahrhunderts. In: Die Salier und das Reich, Bd. III, Sigmaringen 1992.
WATTENBACH, Wilhelm, HOLTZMANN Robert: Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Die Zeit der Sachsen und Salier, Neuausgabe von Franz-Josef Schmale, Darmstadt 1978.
[...]
1 Adami Bremensis Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum ed. B. Schmeidler MG i.u.schol. Hannover, Leipzig 1917. Dt. Übersetzung von Werner Trillmich in: Quellen des 9.und 11. Jahrhunderts zur Geschichte der Hamburgischen Kirche und des Reiches. Darmstadt 1968, S. 137-499. Künftig bei deutscher Übersetzung: Trillmich mit Seitenangabe. Angaben zum Text Adams: Adam, Buch, Kapitel. Hier: Adam III, 34, S. 177, Z. 4-6: „praeterea per omnes suo tempore factae sunt, conspirationes semper erat medioximus.” Dieser Zusatz zum Widmungsexemplar A 1 findet sich allerdings nur in der Handschriftengruppe BC. Das dürfte auch der Grund sein, dass Trillmich „coniurationes“ mit Intrigen übersetzt.
2 Die Regesten der Erzbischöfe von Köln im Mittelalter, Bd. 1 (313-1099), bearb. von Friedrich Wilhelm Oediger, Düsseldorf 1978. Nachdruck der Ausgabe Bonn 1954-1961. Publikationen der Ges. f. Rhein. Geschichtskunde, Bd. 21. Nr. 953. Künftig zitiert: Oediger und Nr. - Ein genaueres Datum für den Tag von Tribur steht nicht zur Verfügung.
3 Vgl. dazu besonders die wichtige Monographie von Georg Jenal, Erzbischof Anno II. von Köln (1056-1075) und sein politisches Wirken. Ein Beitrag zur Geschichte der Reichs- und Territorialpolitik im 11. Jahrhundert. In: Monographien zur Geschichte des Mittelalters. HG. Karl Bosl und Friedrich Prinz, Bd. 8.I, 1974 und Bd. 8.II, 1975.
4 Vgl. Gerd Althoff: Kontrolle der Macht. Formen und Regeln politischer Beratung im Mittelalter, Darmstadt 2016, S. 325-334.
5 Adam III, 34, S. 177, Z.5-6: “At vero Coloniensis, vir atrocis ingenii, etiam violatae fidei arguebatur in regem;”
6 Oediger Nr. 843.
7 Ebd. Nr. 848.
8 Ebd. Nr. 850. Die Versammlung von Kaiserswerth dauerte vom 3. März 1056 bis zum 6. Mai desselben Jahres.
9 Vgl. dazu Gerhard Peter Handschuh: „Der Kölner, den man der Habsucht zieh, …“ Erzbischof Anno II. von Köln, Königin Richeza von Polen und das Erbe der Ezzonen. In: Geschichte in Köln Bd. 66, 2019, S.87-114.
10 Oediger, Nr. 851 und 854.
11 Ebd. Nr.852.
12 Tatsächlich zeigen Hoftage und Urkunden, dass Anno schon in der Anfangsphase seines Episkopats eng mit der Reichsregierung kooperierte. Vgl. Gerhard Peter Handschuh: Body Snatching, Königsraub oder Staatsstreich? Die Entführung König Heinrichs IV. in Kaiserswerth: Der Versuch einer Rekonstruktion. In: Geschichte in Köln, Bd. 63, 2016, S. 33-66. Hier: S.57-58.
13 Iucundi translatio S. Servatii, ed. R. Koepke, MGH SS 12, 1856, S. 88-125. Vgl. Wilhelm Wattenbach, Robert Holtzmann, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Die Zeit der Sachsen und Salier, Neuausgabe von Franz-Josef Schmale, Darmstadt 1978, S. 737-739.
14 Oediger Nr. 858.
15 Für diese Datierung vgl. Handschuh (Anm.9), S.106-108.
16 Ebd.
17 Vgl. ebd. S. 105-113.
18 Über das zweite Andernacher Treffen erfahren wir nur, dass es drei Jahre später mit denselben Teilnehmern stattfand. Der Termin wäre dann wohl irgendwann im Jahre 1059 gewesen. Vgl. MG SS 12, S. 114, Z. 37f. Inhaltlich wird nichts erwähnt. Der Termin von 1062 würde mehr Sinn machen.
19 Für Gottfried den Bärtigen vgl. Georges Despy: G.III. der Bärtige, In: Lexikon des Mittelalters, München 2003, Bd. VI, Sp. 1601.
20 Oediger Nr. 871.
21 Gerold Meyer von Knonau: Jahrbücher des deutschen Reiches unter Heinrich IV. und Heinrich V., Bd. 1, 1056 bis 1069, Leipzig 1890, Reprint 2018, S. 401 nennt den Schildträger den „angesehensten Lehnsträger der Krone“. Vgl. auch Wilhelm v. Giesebrecht: Geschichte der dt. Kaiserzeit, Bd. 3, Braunschweig 1869. Reprint 2018, S. 111.
22 Lampert von Hersfeld: Annalen: Lamperti Monachi Hersfeldensis Opera, MGH SS. in us.schol., Hg.. Oswald Holder-Egger, Hannover/Leipzig. 1894. Frh. v. Stein-Gedächtnisausgabe Bd. XIII, Darmstadt 2011. Übersetzung von Adolf Schmid. Für den Hoftag von Kaiserswerth vgl. S. 79-81.
23 Ebenda, S. 79.
24 Die Pfalz Kaiserswerth lag damals auf einer Insel im Rhein und war mit dem Schiff von Köln bequem zu erreichen.
25 Vgl. Lampert (Anm.22), S. 101: „conventicula”.
26 Ebd., S. 102: „a regni consortio”
27 Ebd.: „Sic iterum rerum publicarum administratio ad episcopos rediit, ut singuli suis vicibus, quid regni, quid rei publicae facta esset, previderent.
28 Vgl. Karl Glöckner: Codex Laureshamensis Arbeiten der historischen Kommission für den Volksstaat Hessen, 1) Darmstadt 1929, S. 265-452. Hier: S. 304.
29. Georg Jenal (Anm.3), S. 179 datiert die Entstehungszeit auf 1074-1076. Vgl. auch ders. S. 39. Dem ist die Forschung nicht gefolgt.
30 Vgl. ebenda S. XII-XV.
31 Vgl. ausführlicher zu Lampert Handschuh: Body Snatching (Anm.12), S.35-36. Vgl. Tilman Struve, Persönlichkeit und Weltbild eines Geschichtsschreibers am Beginn des Investiturstreits. In: Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte 19, Marburg 1969 und 20, Marburg 1970. Zu Exempla vgl. auch Hanna Vollrath: Konfliktwahrnehmung und Konfliktdarstellung in erzählenden Quellen des 11. Jahrhunderts. In: Die Salier und das Reich, Sigmaringen1992. Bd. III, S.294f.
32 Vg. Handschuh, Body Snatching (Anm.12), S. 35-36.
33 Vgl. Johannes Fried: Canossa. Entlarvung einer Legende. Eine Streitschrift, Berlin 2012, S. 81.
34 Hans-Werner Goetz: Der Investiturstreit in der deutschen Geschichtsschreibung von Lampert von Hersfeld bis Otto von Freising, in: Christoph Stiegemann/Matthias Wemhoff (HG.): Canossa 1077. Erschütterung der Welt, Bd. 1, Essays, München 2006, S. 49. Vgl. auch die ähnliche Auffassung bei Tilman Struve: Lampert von Hersfeld, der Königsraub von Kaiserswerth im Jahr 1062 und die Erinnerungskultur des 19. Jahrhunderts, in: Archiv für Kulturgeschichte 88 (2006), S. 251-278.
35 Eine ausführliche Diskussion für Kaiserswerth erübrigt sich hier, da sie bereits an anderer Stelle erfolgt ist. Vgl. Handschuh (Anm.12).
36 Vgl. Kurt Reindel: Die Briefe des Petrus Damiani. In: MGH Briefe der dt. Kaiserzeit, 4,3. Nr.99. Petrus Damiani an Erzbischof Anno von Köln. Juni 1063, S.97-100.
37 Vgl. Jenal (Anm.3), S. 177.
38 Vgl.Annales Weissemburgenses: https//www.geschichtsquellen.de/werk/448 (12.05.2022). Repertorium Fontium 2, 348.
39 Vgl. Benzo episcopus Albensis: Ad Heinricum IV Imperatorem libri VII, https//geschichtsquellen.de/werk/602. (12.05.2022) Repertorium Fontium 2, 486.
40 Vgl. Bertoldus monachus Augiensis: Chronicon, https//geschichtsquellen.de/werk/641. Repertorum Fontium 2,522. Zu den übrigen Quellen vgl. Jenal (Anm.3), S. 177-195.
41 Briefe des Petrus Damiani (Anm. 36), S. 99:“ Servasti, venerabilis pater, relictum tuis manibus puerum, firmasti regnum, restituisti pupillo patrum iuris imperium “ Im Text: Eigene Übersetzung.
42 Mechthild Black-Veldrup: Kaiserin Agnes (1043-1077), Köln 1995, S. 347 mit Anm.12.
43 Gerd Althof: Die letzten Salier im Urteil ihrer Zeitgenossen, in: Christoph Stiegeman/Matthias Wemhoff (Hg): Canossa 1077. (Anm.34). Vgl. auch: Ders. Kontrolle (Anm.4) S. 144.
44 Rudolf Schieffer: Das Reformpapsttum seit 1046, in: Stiegemann/Wemhoff (HG): Canossa 1077. (Anm.34), S.99-110, hier S. 106.
45 Tilmann Struve: Lampert von Hersfeld, (Anm.31), S. 251-278. Hier: S.255. Vgl. auch ders.: Die Entführung Heinrichs IV. in Kaiserswerth in bildlichen Darstellungen. Konstituierung eines Geschichtsbildes. In: Ders.: (HG). Die Salier, das Reich und der Niederrhein, Köln 2008, S. 233.
46 Althoff: Kontrolle (Anm.4) S. 142f.
47 Ebd. S. 143 mit Anm.357, allerdings auch mit Hinweis auf Ludwig das Kind zu Beginn des 10. Jahrhunderts.
48 Ebd.
49 Ebd.
50 Vgl. Gerd Althoff: Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und Fehde. Darmstadt, 1997, S. 143-152 sowie ders.: Heinrich IV. Gestalten des Mittelalters und der Renaissance. Hg. Peter Herde, Darmstadt 2006, S. 50-66.
51 Vgl. Handschuh: Body snatching (Anm.12) passim.
52 Ebd, S. 52-94.
53 Ebd, S. 43-46.
54 Zur Schleiernahme vgl. ebenda.
55 Zur Lösung der Papstfrage vgl. Oediger Nr. 931, 1064, Mai 31-Jun 1, Synode in Mantua.
56 Wohl 1063 Mitte September: RI III,2,3n.304.
57 Adam III, 34
58 Vgl. Handschuh: Body snatching (Anm.12), S. 64f. Zu patronus und magiste r vgl. Adam III,34 und 43.Vgl. auch zum Beispiel: MGH DD H IV Nr. 103, Allstedt 1063 Juni 27, S. 135-137 : patronus für Adalbert und Nr. 108 Goslar 1063 August 7, S. 142-143 magister für Anno. Vgl. auch Jenal (Anm.3), S. 224f, der auf den dilectu s Titel aufmerksam macht. Magiste r beinhaltete damals Lehrer, Regent und Reichsverwalter.
59 Vgl. Jenal (Anm.3), S. 181-183
60 Vgl. ebd., S. 223, die Urkunden, bei denen sie intervenierte. Das bedeutet, dass sie besonders Anfang und Mitte des Jahres 1064 am Hof war.
61 Ebd. S. 296 und 338f.
62 Vgl. z.B. Jenal (Anm.3), S.197f.
63 Vgl. Althoff: Kontrolle (Anm.4), S. 145f. Vgl. Lampert: Annalen (Anm.22), S. 75
64 Adam III, 47: „qui dominum et regem suum inter manus trahentium non posset videre captivum.”
65 Vgl. Oediger Nr. 910 mit Angabe der Quellen.
66 Vgl. oben und Gustl Frech: Die deutschen Päpste -Kontinuität und Wandel. In: Stefan Weinfurter und Martin Siefarth (Hg) (Anm.24), Bd. 2, S. 311ff.
67 Vgl. Rudolf Schieffer: Erzbischöfe und Kirche von Köln. In: Stefan Weinfurter und Frank Martin Siefarth (Hg): Die Salier und das Reich, (Anm.31), Bd. II, S. 9.
68 Ebenda, S.10. Vgl. auch RI plus Regg B Augsburg 1, n.285. 1061 Oktober 28, Basel.
69 Schieffer, (Anm.60), S.11.
70 Ebenda S.7.
71 Ebenda.
72 Vgl. Tilman Struve: Eberhard von Trier. In: Lexikon des Mittelalters, München 2003, Sp. 1322f.
73 Vgl. Jenal (Anm.3), S.181 mit Anm 25.
74 Lampert (Anm.22), S. 88: „Educatio regis atque ordinatio omnium rerum publicarum penes episcopos erat, eminebatque inter eos Moguntini et Coloniensis archiepiscoporum auctoritas”. Vgl. dazu auch Adam III, 34.
75 Adam III,34
76 Vgl. Lampert zu 1063 (Anm.22), S. 88: A quibus cum in partem consilii Adalbertus Premensis archiepiscopus assumptus fuisset, tum propter claritatem generis, tum propter aetatis atque archiepiscopatus praerogativam …”
77 Vgl. z.B. Adam III, 35, in Lampert von Hersfelds Annalen und öfter.
78 Vgl. Ruth Schmidt-Wiegand: Schutz, -herrschaft. In: Lexikon des Mittelalters (Anm. 19), Bd. VII, Sp. 1594f.
79 Vgl. auch Adam III, 66 für Erzbischof Adalbert und: Sebastian Scholz (Hg): Ausgewählte Synoden Galliens und des merowingischen Frankenreichs, Darmstadt 2022. Freiherr-vom-Stein-Gedächtnisausgabe, Bd. 56, S.41, 79, 303 und besonders 383.
80 Adam III, 40. Thies Siebet Jarecki: Die Vorstellungen vom Bischofsamt bei Adam von Bremen. Arbeiten zur Kirchen- und Theologiegeschichte Bd. 42. Leipzig 2014, S.192-203 geht leider hier darauf nicht ein.
81 Vgl. Adam III, 34.
82 Jenal (Anm.3), S. 178 nennt sie abwertend „Hintermänner“: Für Kaiserswerth sind namentlich bekannt: Graf Ekbert von Braunschweig, Herzog Otto von Bayern, Herzog Gottfried von Lothringen und eventuell Erzbischof Siegfried von Mainz.
83 Vgl. Gerd Althoff, Heinrich IV. In: Heinrich IV. Vorträge und Forschungen, Gerd Althoff (HG): Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte Bd. LXIX, Ostfildern 2009, S. 61ff. Vgl. auch Georg Jenal (Anm.3), S. 306.
84 Vgl. aber auch die Annales Weissemburgenses, die jedoch keine weiteren Erkenntnisse liefern. Vgl. Jenal (Anm.3) S. 303.
85 Lampert (Anm.22), S. 100-102.
86 Ebenda S.100.
87 Ebenda S. 101.
88 Hier irrt Lampert.
89 Ebenda S. 102. Vgl. auch ebenda S. 80 die Verfügung Annos, die wohl Lamperts Vorstellung von Reichsregierung entspricht.
90 Vgl. Adam III,4.
91 Vgl. Adam III, 47.
92 Vgl. Adam III,6 Gerade an der Schilderung der Feldzüge Adalbert zeigt Adam seine Arbeitsweise deutlich. Vgl. zur Problematik auch Günter Glaeske, Die Erzbischöfe von Hamburg-Bremen als Reichsfürsten (937-1258), Hildesheim 1962, S. 72-73.
93 Vgl. Karl Glöckner: Codex Laureshamensis (Arbeiten der historischen Kommission für den Volksstaat Hessen, 1) Darmstadt 1929, S. 265-452. Hier: S. 304.Zu den Schenkungen Heinrichs IV. an Adalbert vgl. Otto Heinrich May, Regesten der Erzbischöfe von Bremen, Hannover 1928 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für die Provinz Hannover, Oldenburg, Braunschweig, Schaumburg-Lippe und Bremen. 11), Bd.I (787-1306): Oschersleben, Sept. 6, 1065, Abteien Lorsch und Corvey, Nr. 309 und 310; Goslar, Okt. 16, 1065, Hof Duisburg mit Forst, Münze, Zoll, Nr. 313; Goslar Okt. 19, 1065, villa Sinzig mit Münze, Markt und Zoll, Nr. 314; Corvey, Dez. 8, 1065 Forst Herescephe, Nr. 316.
94 Hans Delbrück, Über die Glaubwürdigkeit Lamberts von Hersfeld, Diss. Bonn 1878. Nachdruck: Forgotten Books, London 2018, S. 17-20.
95 Ebenda, S. 17-18. Vgl. MGH DD H. IV Nr. 174, Corvey Nov. 19 sowie Nr. 175, Corvey Dez. 8, aber auch Oschersleben, Sept. 6, Nr. 168 und 169, Magdeburg, Sept. 8, N. 169. Weihnachten feierte Heinrich in Mainz, vgl. RI III, 2, 3, n. 430. Herzog Gottfried war am Hof, denn er erhielt Niederlothringen und wurde Vogt von Kloster Stablo, Goslar, Oktober 1065, vgl. RI III 2 ,3, n. 421.
96 Vgl. Hans Delbrück,(Anm.33), S. 19-20, und RI III, 2, 3, n. 431.
97 Vgl. RI III, 2, 3 n.417,422, 423, 424, 428 und 429.
98 MGH DD H. IV. Nr. 190, Wiehe 1067.
99 Vgl. Gerd Althoff: Spielregeln (Anm.50), S. 142-152.
100 Zumindest seit den Andernacher Treffen.
101 Vgl. Ernst Karpf, Ekbert. In: Lexikon des Mittelalters, München 2002. Bd. 3, Sp. 1761
102 Vgl. zu den Fürsten Jenal (Anm. 3), S. 177ff für Kaiserswerth und S. 304 ff für Tribur.
103 Vgl. Althoff: Spielregeln (Anm.50), S. 150. Man sollte hier mitbedenken, welche Kosten eine besondere Unterstützung des Königs für die Fürsten verursachte.
104 Vgl. RI, 2, 3 n.434
105 Adam III, 47.
106 Ebenda mit Anm. 203, S. 388.
107 Hubertus Seibert: Geld, Gehorsam, Gerechtigkeit, Gebet. Heinrich IV. und die Mönche. In: Gerd Althoff (HG): Heinrich IV. (Anm.76), S. 308-315.
108 Adam III, 47.
109 Ebenda.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Andernacher Treffen und welche Bedeutung haben sie?
Die Andernacher Treffen waren Zusammenkünfte lothringischer Fürsten, darunter Erzbischof Anno von Köln, Erzbischof Eberhard von Trier, Herzog Gottfried der Bärtige von Oberlothringen und Pfalzgraf Heinrich. Sie dienten der Unterstützung der Minderjährigkeitsregierung der Kaiserin Agnes nach dem Tod Heinrichs III. Die Treffen fanden in Andernach statt, wo die Kölner Kirche einen Hof besaß.
Wann fanden die Andernacher Treffen statt?
Das genaue Datum des ersten Treffens ist unbekannt, aber es wird vermutet, dass es kurz nach dem Hoftag in Köln (5.-6. Dezember 1056) stattfand. Ein zweites Treffen könnte im Frühjahr 1062 nach der Regierungsübernahme durch Anno stattgefunden haben.
Was war der Hoftag von Kaiserswerth 1062?
Der Hoftag von Kaiserswerth im Frühjahr 1062 war ein Ereignis, bei dem Fürsten unter Führung von Erzbischof Anno von Köln den Augsburger Bischof Heinrich II., den Favoriten der Kaiserin Agnes, entmachteten. Der junge König Heinrich IV. wurde der Kaiserin entzogen, um die Verwaltung des Reiches selbst zu übernehmen. Anno nutzte ein prächtiges Schiff, um den König nach Köln zu locken. Es wird oft als "Entführung" bezeichnet, obwohl die Motivationen komplex waren.
Was war der Hoftag von Tribur 1066?
Der Hoftag von Tribur im Januar 1066 war ein Reichstag, bei dem die Fürsten unter der Führung der Erzbischöfe von Mainz und Köln gegen Erzbischof Adalbert von Hamburg-Bremen vorgingen, der als enger Vertrauter des Königs eine tyrannische Herrschaft anstrebte. Die Fürsten zwangen den König, entweder abzudanken oder seine Freundschaft zu Adalbert aufzugeben und ihn seiner Stellung als Mitregent zu entheben.
Welche Rolle spielte Erzbischof Anno von Köln bei diesen Ereignissen?
Erzbischof Anno von Köln spielte eine zentrale Rolle bei den Andernacher Treffen, dem Hoftag von Kaiserswerth und dem Hoftag von Tribur. Er war ein einflussreicher politischer Akteur, der sowohl von Anhängern als auch von Kritikern umgeben war. Adam von Bremen beschuldigte Anno, in allen Intrigen seiner Zeit der Drahtzieher gewesen zu sein, was in diesem Aufsatz untersucht wird.
Wer waren die Hauptquellen für diese Ereignisse?
Die Hauptquellen für diese Ereignisse sind Lampert von Hersfeld, Adam von Bremen und der Codex Laureshamensis. Lampert von Hersfeld ist eine wichtige, aber nicht immer zuverlässige Quelle. Adam von Bremen war gut informiert über die Vorgänge in Tribur, während der Codex Laureshamensis die Rolle des Klosters Lorsch bei der Vertreibung Adalberts hervorhebt.
Welche Motive werden Erzbischof Anno zugeschrieben?
Die Motive Erzbischof Annos sind umstritten. Einige sehen ihn als einen machthungrigen Politiker, der das Beste für das Reich wollte, während andere ihn als einen ehrgeizigen Mann sehen, der seine persönlichen Interessen verfolgte. Zu seinen Motiven zählten Treue zu Heinrich III., Pflichtgefühl gegenüber der Regentschaft der Kaiserin, dem jungen König Heinrich IV. und den Reichsangelegenheiten.
Welche Bedeutung hatten die geistlichen und weltlichen Fürsten während der Minderjährigkeit Heinrichs IV.?
Die geistlichen und weltlichen Fürsten spielten eine entscheidende Rolle bei der Regierung des Reiches während der Minderjährigkeit Heinrichs IV. Sie waren auf gegenseitige Unterstützung angewiesen, um die Verhältnisse im Reich ausgeglichen zu halten und die Reichspolitik mitzugestalten.
Gab es Parallelen zwischen dem Hoftag von Kaiserswerth und dem Hoftag von Tribur?
Ja, es gab mehrere Parallelen. Beide Ereignisse fielen in die Regierungszeit des minderjährigen bzw. gerade mündig gewordenen Königs Heinrichs IV. In beiden Fällen wird Anno als Drahtzieher genannt, und in beiden Fällen wurde ein bevorzugter Ratgeber bzw. Favorit gestürzt. Zudem spielten innen- und italienpolitische Divergenzen eine Rolle.
- Quote paper
- Gerhard Handschuh (Author), 2023, Anno II., Erzbischof von Köln als der größte Intrigant seiner Zeit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1368396